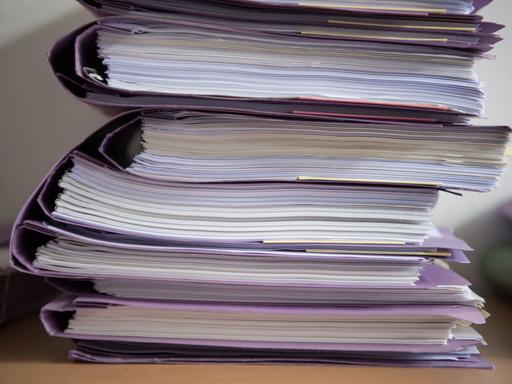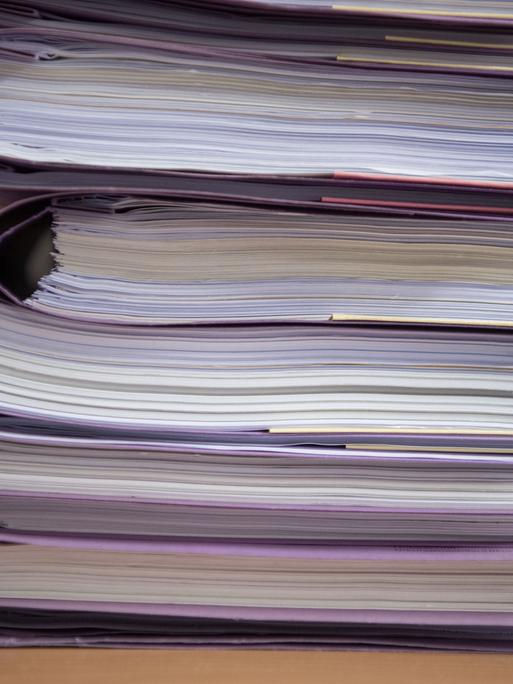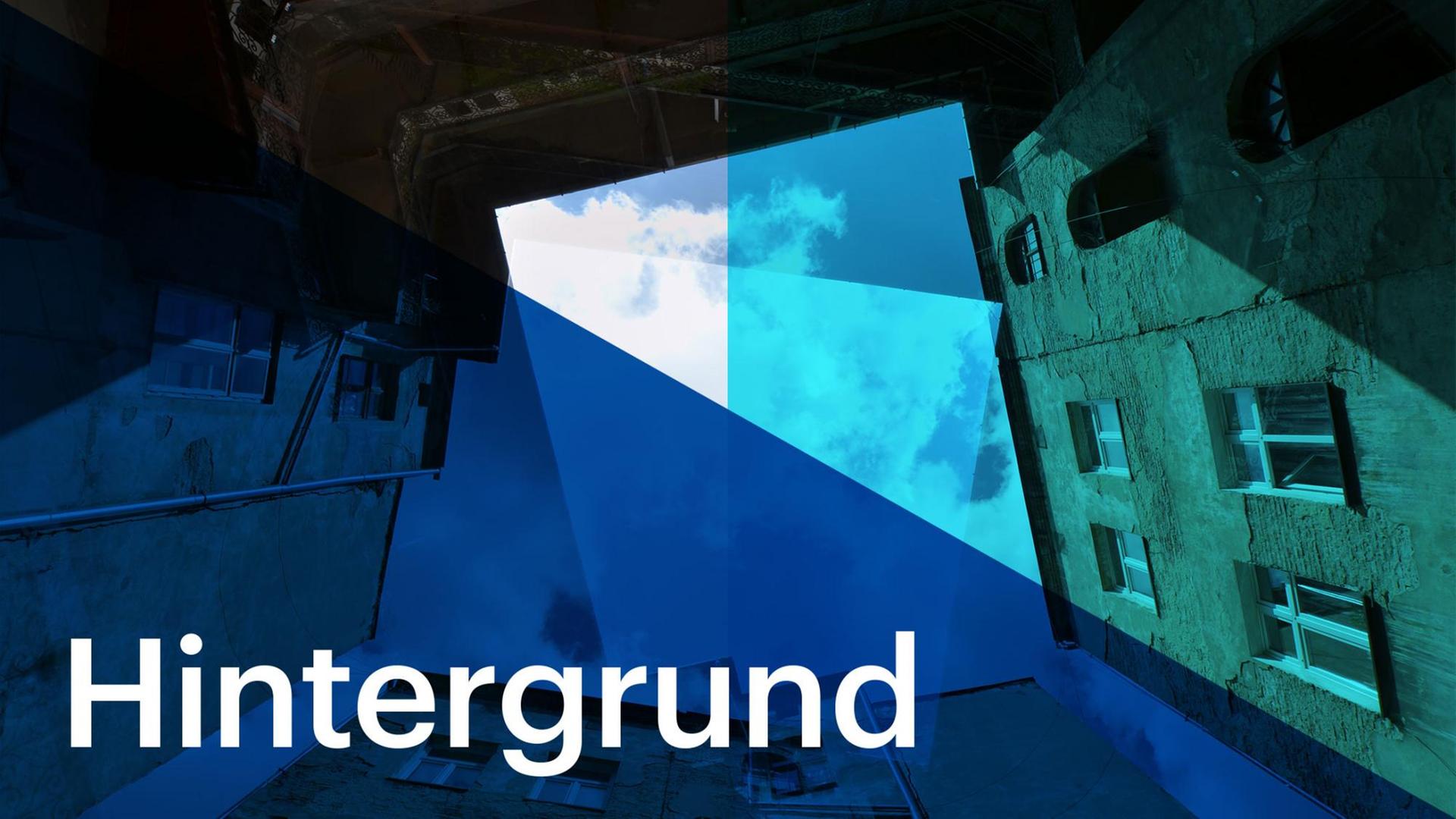Ob staatliche Verträge, Terminpläne von Ministern oder E-Mails. Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) verpflichtet Behörden zur Herausgabe von amtlichen Dokumenten. Vor allem für Journalistinnen und Journalisten ist der Zugang zu solchen Informationen essenziell. Viele Recherchen, von der gescheiterten Pkw-Maut bis zur Maskenaffäre, bauen auf Auskünften aus solchen Anfragen.
Die Union stellt das Gesetz nun offenbar infrage. Zumindest so, wie es bisher gilt. In einem öffentlich gewordenen Verhandlungspapier der künftigen Koalitionäre heißt es: „Das Informationsfreiheitsgesetz in der bisherigen Form wollen wir hingegen abschaffen.“ Der Satz steht in blauer Schrift und Klammern, was darauf hindeutet, dass es sich um einen Vorschlag von CDU und CSU handelt, bei dem es bislang keine Einigung mit der SPD gibt. Trotzdem stößt die Formulierung schon jetzt auf massive Kritik. Organisationen wie Lobbycontrol, der Deutsche Journalistenverband (DJV) und die Online-Plattform Frag den Staat sehen die demokratische Kontrolle in Gefahr.
Doch was genau regelt das Informationsfreiheitsgesetz? Wie wichtig ist es für den Investigativ-Journalismus in Deutschland, aber auch für Bürgerinnen und Bürger? Und warum sehen selbst Verfechter dringenden Handlungsbedarf?
Was regelt das Informationsfreiheitsgesetz?
Laut dem IFG haben alle Bürgerinnen und Bürger das Recht auf amtliche Informationen von Bundesbehörden. Und zwar voraussetzungslos, also ohne Begründung. Das Gesetz ist seit Januar 2006 in Kraft, seitdem müssen Behörden auf Antrag staatliche Dokumente herausgeben – zum Beispiel Verträge, Terminpläne von Ministern oder E-Mails.
In besonderen Fällen darf die Akteneinsicht verweigert werden. Etwa sieht das IFG den Schutz von besonderen öffentlichen Belangen, den Schutz behördlicher Entscheidungsprozesse, personenbezogener Daten und auch den Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen vor. Allerdings müssen die angefragten Behörden begründen, warum sie sich auf diese Ausnahmen berufen. Nicht selten müssen Ansprüche auf Aktenzugang vor Gericht erstritten werden.
Wie wichtig ist das Recht auf staatliche Informationen?
Das IFG ist ein wichtiger Beitrag zur Pressefreiheit. Viele politische Skandale der vergangenen Jahre wurden von Journalistinnen und Journalisten aufgedeckt, die für ihre Arbeit das Recht auf amtliche Informationen nutzten. Nach Ansicht von Investigativ-Journalist Daniel Drepper vom Netzwerk Recherche hat das Gesetz zahlreiche Recherchen überhaupt erst möglich gemacht. Denn anhand der Dokumente könne „Schwarz auf Weiß“ belegt werden, was passiert sei, sagt Drepper, und es ließen sich konkrete Verantwortlichkeiten festmachen.
Auch aus Sicht von Arne Semsrott vom Internetportal „Frag den Staat“ ist das IFG nicht mehr wegzudenken aus der journalistischen wie aus der aktivistischen Arbeit. „Das ist ein Kernpfeiler der Demokratie“, so Semsrott. Allein über die 2011 gegründete Plattform seien um die 300.000 Anfragen an Behörden gestellt worden.
Als Beispiel für politische Skandale, die in den vergangenen Jahren auch mithilfe des IFG aufgedeckt wurden, nennt Arne Semsrott etwa die Maskenaffäre um Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sowie den Wirbel um den Atomausstieg in Deutschland und die Frage, wie „ergebnisoffen“ Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grüne) einen Weiterbetrieb prüfen ließ.
Allerdings gehe es in den Anfragen oft auch um „ganz Alltägliches“, sagt der Journalist und Aktivist. Etwa um das Gutachten zu einer geplanten Verkehrsumgehung oder den Bauplan für die Erweiterung eines Schulgebäudes. Das IFG ermögliche es Bürgerinnen und Bürgern, mitzudiskutieren und, wenn aus ihrer Sicht nötig, gegen Behördenhandeln zu protestieren. Kurz: Es gehe um Kommunikation „auf Augenhöhe“.
Welche Folgen hätte die Abschaffung des Gesetzes?
Würde das Gesetz ersatzlos gestrichen, hätte das Folgen für den Journalismus, aber auch für die Demokratie in Deutschland insgesamt, sagt Daniel Drepper. Die Recherche würde umständlicher, weil Journalistinnen und Journalisten anders an Informationen kommen müssten. Ohne das Recht auf staatliche Informationen müssten sie stärker als bisher auf Menschen setzen, die bereit sind, Dokumente herauszugeben, obwohl sie dadurch möglicherweise Amtsgeheimnisse brechen. Eine solche Quellenarbeit sei zwar ohnehin zentraler Bestandteil journalistischer Arbeit, sagt Drepper, jedoch deutlich aufwendiger und nicht immer erfolgreich.
Deutliche Worte fand auch DJV-Chef Mika Beuster. Er warnte: „Wer die Transparenz einschränken möchte, hat offensichtlich etwas zu verbergen und gefährdet damit den Journalismus und die Demokratie zugunsten von Machterhalt und undurchsichtigen Machenschaften.“ Auch die Organisation Lobbycontrol teilte als Reaktion auf die Formulierung im Verhandlungspapier mit, der Zugang zu behördlichen Informationen sei essenziell für demokratische Kontrolle.
Philosophie-Wechsel in der Kommunikation
Ein Ende der Informationsfreiheit auf Bundesebene würde zudem weit über die journalistische Arbeit hinaus spürbar, ist Daniel Drepper überzeugt. Er sieht in den Unionsplänen einen grundlegenden Philosophie-Wechsel in der Kommunikation zwischen Behörden und Bürgerinnen und Bürgern.
Mit dem Gesetz hätten alle die Chance, das Behördenhandeln nachzuvollziehen und Einsicht zu nehmen, so Drepper. Ohne leide die öffentliche Diskussion insgesamt. Aus Sicht von Arne Semsrott könne zudem allein das Wissen darum, dass wegen des IFG Informationen auf Anfrage rausgegeben werden müssen, bereits einen Einfluss auf das Verhalten in den Behörden haben.
Wo gibt es Handlungsbedarf?
Trotzdem sehen Drepper und Semsrott durchaus Luft nach oben, was die Transparenz und den Zugang zu amtlichen Informationen in Deutschland angeht. So kritisiert Daniel Drepper zum Beispiel, dass Antworten oft monatelang auf sich warten ließen, und einige Behörden versuchten, Anfragen gar nicht zu beantworten. Seit einigen Jahren gibt es deshalb Forderungen nach einer Weiterentwicklung des IFG. 2022 hat ein zivilgesellschaftliches Bündnis - dem unter anderen Frag den Staat und Netzwerk Recherche angehören - einen Entwurf für ein Bundestransparenzgesetz vorgelegt. Ziel ist es, Behörden dazu zu verpflichten, Informationen wie Gutachten und Studien oder Verträge der öffentlichen Hand von sich aus online zu veröffentlichen.
Vorbild für die Regelung ist ein Gesetz in Hamburg. Dort würden „bestimmte Verträge ab bestimmten Summen“ grundsätzlich auf einem für alle zugänglichen Portal veröffentlicht, sagt Drepper. Die Informationen müssten also nicht erst nach einer Anfrage rausgesucht und digitalisiert werden. Ergo würden Anfragen weniger als Belastung empfunden. Ähnlich argumentiert Semsrott: „Wenn es darum geht, Bürokratie abzubauen, den Aufwand zu verringern, dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit und das ist Digitalisierung.“ Wenn der Staat verpflichtet würde, viele interne Informationen von sich aus zu veröffentlichen, brauche es keine Anfragen mehr. Obendrein hätten dann auch die Behörden einfacher Zugriff auf ihre eigenen Informationen.
Amthor sieht "Imbalance"
Als Reaktion auf die Kritik am Vorstoß der Union sagte Philipp Amthor (CDU) im NDR, es gehe nicht um ein ersatzloses Streichen des Gesetzes, sondern um eine Novellierung. Amthor ist Verhandlungsleiter der Arbeitsgruppe "Bürokratieabbau, Staatsmodernisierung, moderne Justiz", aus deren Feder der Satz im Koalitionspapier stammt. Eine Überarbeitung sei nötig, weil man eine „Imbalance“ festgestellt habe. So würden zum Beispiel Auskunftsrechte der Presse regelmäßig zurückfallen hinter Auskunftsansprüche der Bürger, zitiert der NDR den CDU-Politiker.
Kritiker weisen auch daraufhin, dass Amthor seine eigene Geschichte mit dem IFG hat. Amthor machte 2020 Schlagzeilen wegen Lobbyismus-Vorwürfen um die IT-Firma Augustus Intelligence und war auch durch eine IFG-Anfrage unter Druck geraten.
Journalist Drepper bezweifelt, dass die Union Veränderungen im Sinne einer verbesserten Transparenz plane. So hätten CDU und CSU stets „auf der anderen Seite“ gestanden, sagt er mit Blick auf den Vorschlag eines Bundestransparenzgesetzes. Auch deshalb werde die öffentlich gewordene Formulierung, das IFG „in seiner bisherigen Form“ abschaffen zu wollen, eher als Schritt zu weniger Transparenz und Informationsfreiheit interpretiert.
irs