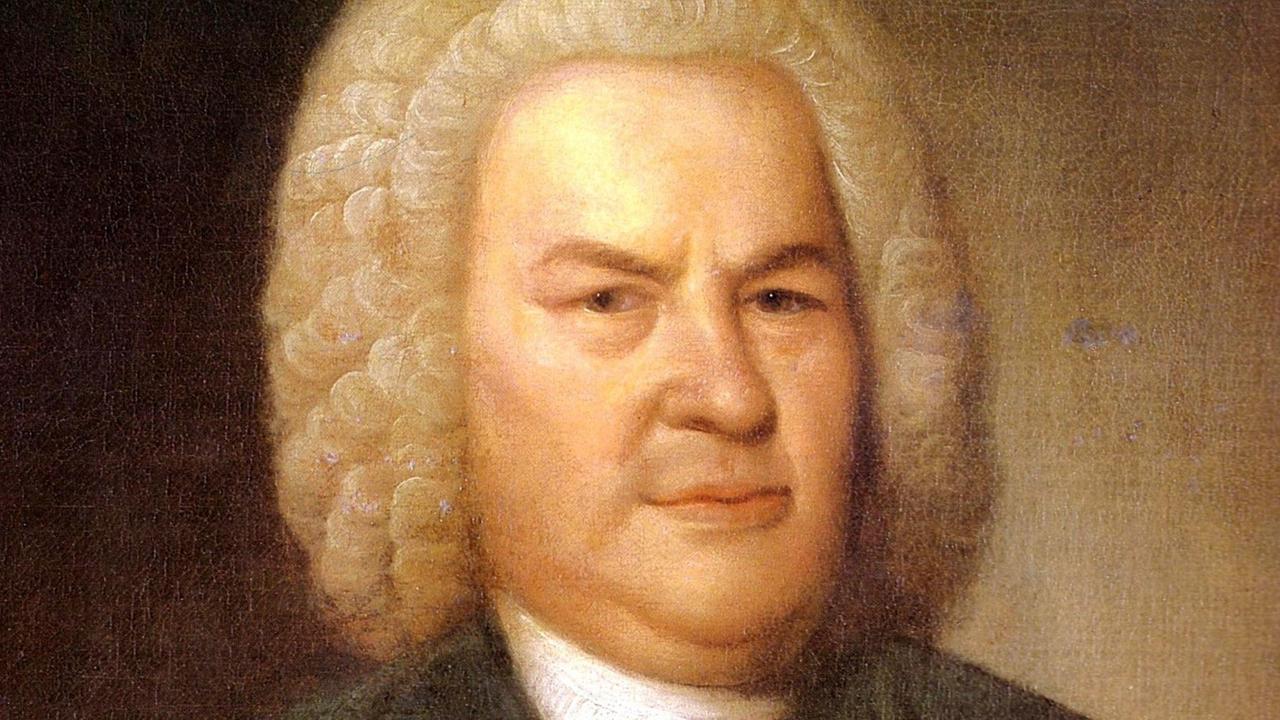Musikwettbewerbe sind Gerüchteküchen. Einflussreiche Juroren im Dienst mächtiger Musik-Institutionen und im Hintergrund tätige Musik-Agenten würfeln miteinander die Gewinner aus. Das ist der Kern des Gerüchts. Wahr ist, es gibt einen Dreiklang – Juilliard, Gnessin, Steinway, könnte man ihn nennen –, der die Welt der Klavierwettbewerbe dominiert. Steinway & Sons liefern die Instrumente, und aus der New Yorker Juilliard School oder vom Moskauer Gnessin-Institut kommen zuverlässig die aussichtsreichsten Kandidaten für die ersten Plätze. Sicher, es gibt Ausnahmen. Aber auch die China International Music Competition zeigt das vertraute Bild. Und dass ein Chinese diesen Wettbewerb gewinnen musste – stand es nicht auch schon vorher fest? Es war der erste Wettbewerb seiner Art in China und das Preisgeld – 150.000 US-Dollar allein für den Sieger – das, was man eine Ansage nennt: Von einem ›Wettbewerb der Wettbewerbe‹ spricht sogar Arie Vardi, Pianist und Klavierprofessor mit Legendenstatus, in Peking als Mitglied der Jury dabei. Vielen potenziellen Kandidaten, die seine Schüler sind, blieb genau aus diesem Grund die Teilnahme verwehrt. Eine Legende auch: Wettbewerbsdirektor Richard Rodzinski.
"Wie zuvor bei Cliburn und in Moskau gibt es auch hier eine Management-Garantie für den Gewinner. Sicher, es geht um Ruhm und Ehre, aber was die Wettbewerbsteilnehmer wirklich suchen, ist ein Sprungbrett für ihre Karriere, mehr Konzertmöglichkeiten und dass sich ihnen die Türen öffnen. Ich denke, das ist das Wichtigste, was ein Wettbewerb leisten kann."
Die Gerüchteküche brodelt
Rodzinski hat den texanischen Van-Cliburn-Wettbewerb geleitet, danach war er beim Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau und hat dort erst einmal aufgeräumt – mit den Gerüchten und ihren Ursachen. Nach Peking wurde er geholt, um dergleichen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Blütenweiße Wettbewerbe freilich, sagt Rodzinski selbst, wird es niemals geben. Aber auch kein Künstler von Rang setzt seinen Ruf aufs Spiel, um als Mitglied einer Jury an Mauscheleien mitzuwirken. Chef-Jurorin Yoheved Kaplinsky weist jeden Verdacht der Einflussnahme, von welcher Seite auch immer, weit von sich: "Der Schlüssel zu allem ist, eine Jury zusammenzustellen, der man vertrauen kann. Es gibt viel Misstrauen gegenüber China. Aber der Präsident des Konservatoriums kam zu mir und sagte: Ich will den bestmöglichen Wettbewerb, einen Wettbewerb, in dem es um Kunst und um nichts anderes geht."
Die Gerüchte sind trotzdem da. Schnell hat sich herumgesprochen: Zwei der letzten Drei – wenn auch mit niemandem aus der Jury direkt verbandelt – kommen wie Kaplinsky von der Juilliard School, und der dritte, ein Gnessin-Schüler, steht bereits bei jener international tätigen Künstleragentur, mit der nicht nur dieser Wettbewerb kooperiert, fest unter Vertrag. Als die Chefjurorin die Entscheidung verkündet, geht ein Raunen durch die Reihen und der Applaus ist dürr: Alexander Malofeev, 17, als Sieger des Tschaikowsky-Junioren-Wettbewerbs aus Russland angereist, und der US-Amerikaner Mackenzie Melemed, 24, auch er mit reichlich Wettbewerbserfahrung und Wunderkind-Vergangenheit, kommen in die letzte Runde, gemeinsam mit dem 18-jährigen Kanadier Tony Siqi Yun. Letzteren hatten viele im Finale erwartet, abzulesen an den beifälligen Mienen der bis zur Verkündung noch im Saal verbliebenen Zuhörer. Malofeev und Melemed hingegen eher nicht. "Eher nicht" ist die niedrigste Kategorie im vierstufigen Bewertungssystem der Jury. Sie sah es anders, obwohl Malofeev in der Vorrunde das d-Moll-Konzert von Mozart in einer Weise behandelt hatte, dass man meinte, Zeuge der Geburt eines sechsten Beethoven-, wenn nicht Prokofjew-Konzerts gewesen zu sein. Untadelig, aber auch etwas uninspiriert hatte Melemed Mozarts A-Dur-Konzert gespielt, ohne zu zeigen, was er wirklich kann. Die Sache und letztlich auch das Publikum besser im Griff hatten die dann überraschenderweise ausgeschiedenen Mitbewerber, allen voran Leonardo Colafelice aus Italien und Arseny Tarasevich-Nikolaev aus Russland, der Enkel von Tatiana Nikolaeva. Wie Colafelice pflegt er einen eleganten, in seinem Fall zuweilen das Saloneske streifende, immer jedoch blühenden und auch die heiteren Seiten der Wiener Klassik auskostenden Klavierton.
Jury überraschte ein zweites Mal
Nach dem Grad der Tätschel-Intensität beim Abschiedsgruß des Dirigenten En Shao am Pult des Academia-Orchesters zu urteilen, sah er die beiden nach ihrem Auftritt in einer Favoritenrolle. Kaum weniger aussichtsreich Sandro Nebieridze, 18, aus Georgien, der die etwas härtere Gangart pflegt. Doch auch er war es dann – wieder in den Augen der Jury – nur "möglicherweise" oder "eher nicht". Malofeev und Melemed hingegen hatten offenbar in den Vorrunden so stark aufgetrumpft, dass sich bei der Jury-Mehrheit die höchste Kategorie der Empfehlung fürs Weiterkommen festgesetzt hatte: "Ja, absolut, diesen Kandidaten möchten wir wieder hören!".
Im Finale dann hatten die Drei Gelegenheit, auch die Skeptiker im Publikum auf die Seite der Jury zu ziehen. The Philadelphia unter Yannick Nézet-Séguin: Wegen dieses Orchesters, das aus Anlass der Feier chinesisch-amerikanischer Beziehungen in Peking gastierte, hatte man den Wettbewerbstermin auf Mai 2019 festgelegt und dafür eine Vorlaufzeit von nur neun Monaten in Kauf genommen. Tony Yun, der den besten Kontakt zum Orchester gefunden hatte, der junge Kanadier und Pekinger Lokalmatador, erhielt den großen Preis – in echten Dollars; hätte er einen chinesischen Pass, würde er ihm nur in Renmimbi, der Landeswährung, ausgezahlt.
Das Preisgeld des königlichen Wettbewerbs in Brüssel nimmt sich dagegen fast bescheiden aus: 25.000 Euro. Unvergleichlich aber ist das Renommee. Wer hier gewinnt, steht auf einer Stufe mit Vorgängern wie David Oistrach, Vadim Repin und Nikolaj Znaider. Auch Ray Chen, der Sieger von 2012, gehört inzwischen international zur ersten Garde. Dass die diesjährige Preisträgerin, Stella Chen, wie er einen chinesischen Nachnamen trägt, ist natürlich Zufall. Und auch wieder nicht. Denn er steht dafür, dass sich die jahrzehntelange Dominanz der russischen Geigerschule in eine chinesische mit amerikanischem Ostküstenakzent verwandelt hat. Ein Tschaikowsky-Konzert ohne Fehlgriff in solide gefasster Klangschönheit sicherte Chen den Sieg vor dem favorisierten Timothy Chooi, Gewinner des Joseph-Joachim-Wettbewerbs 2018, mit seiner reichlich exaltierten Darbietung desselben Werks. Der hohe Frauenanteil im Violin-Finale entsprach dem Gesamtteilnehmerfeld: rund 70 Prozent. Davon ist die Klavier-Wettbewerbsszene, siehe Peking und demnächst Moskau mit Alexander Malofeev als heißem Titelaspiranten, meilenweit entfernt.