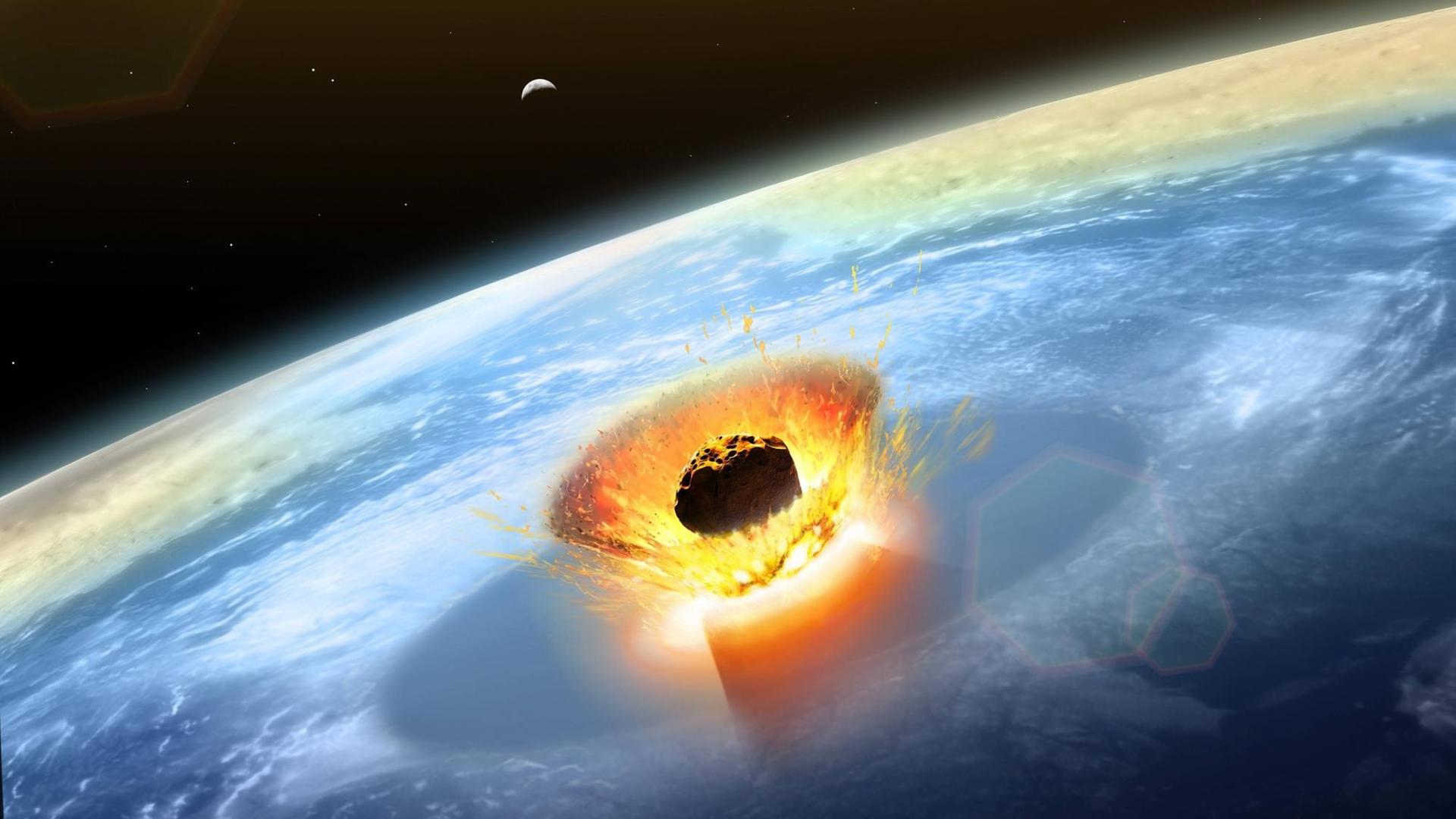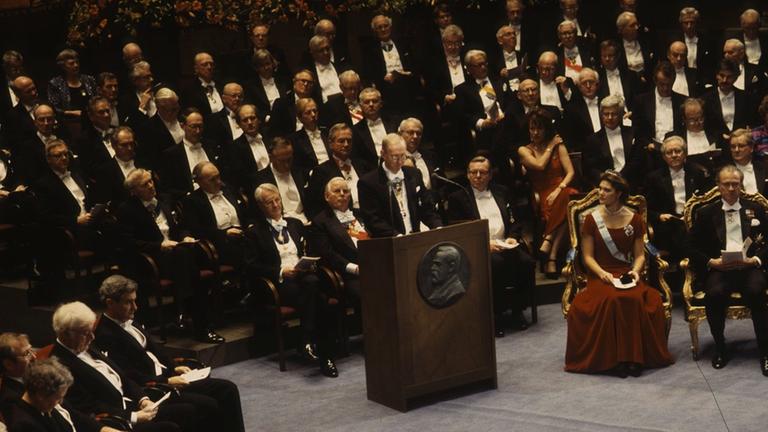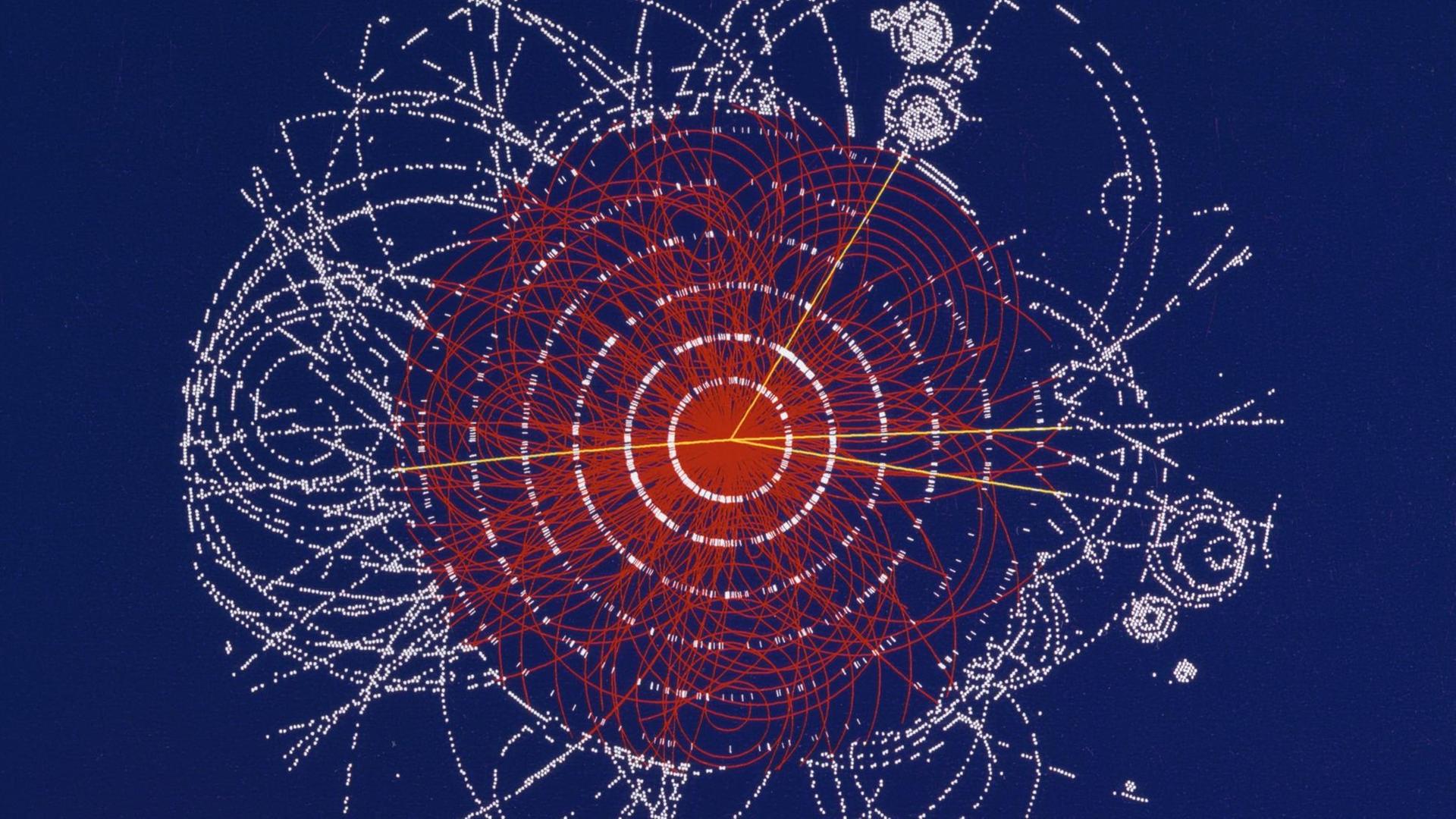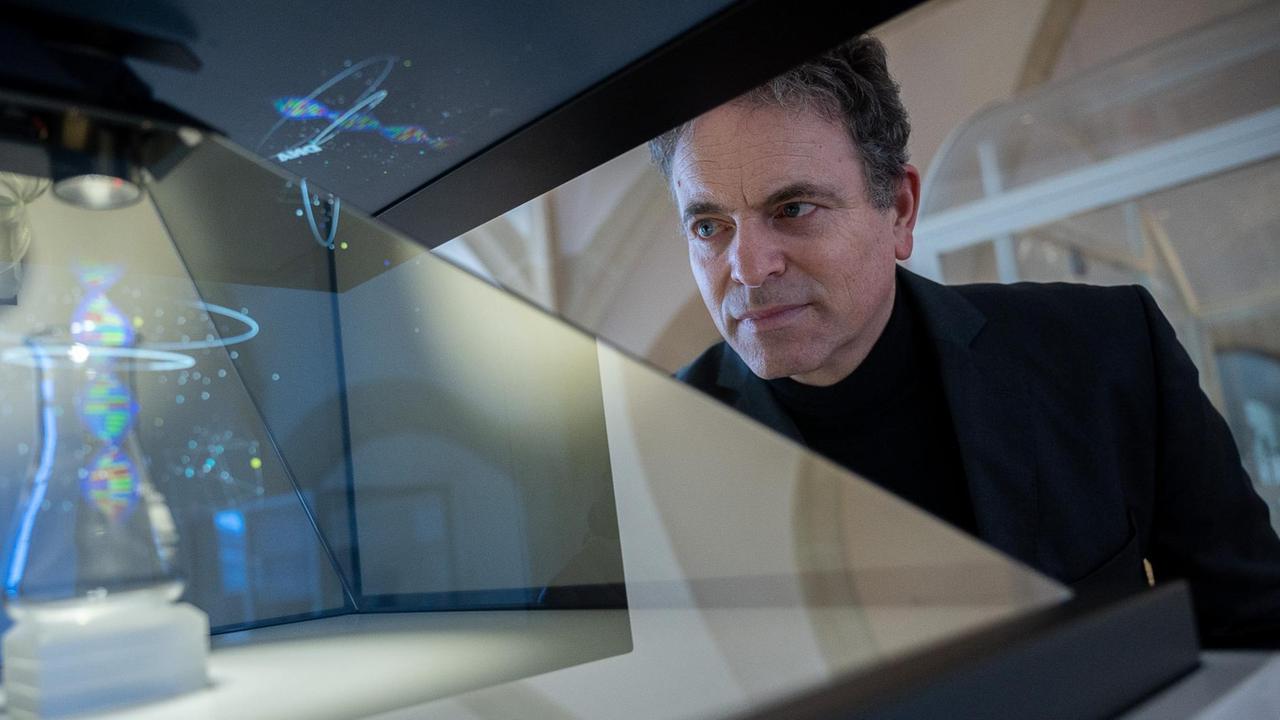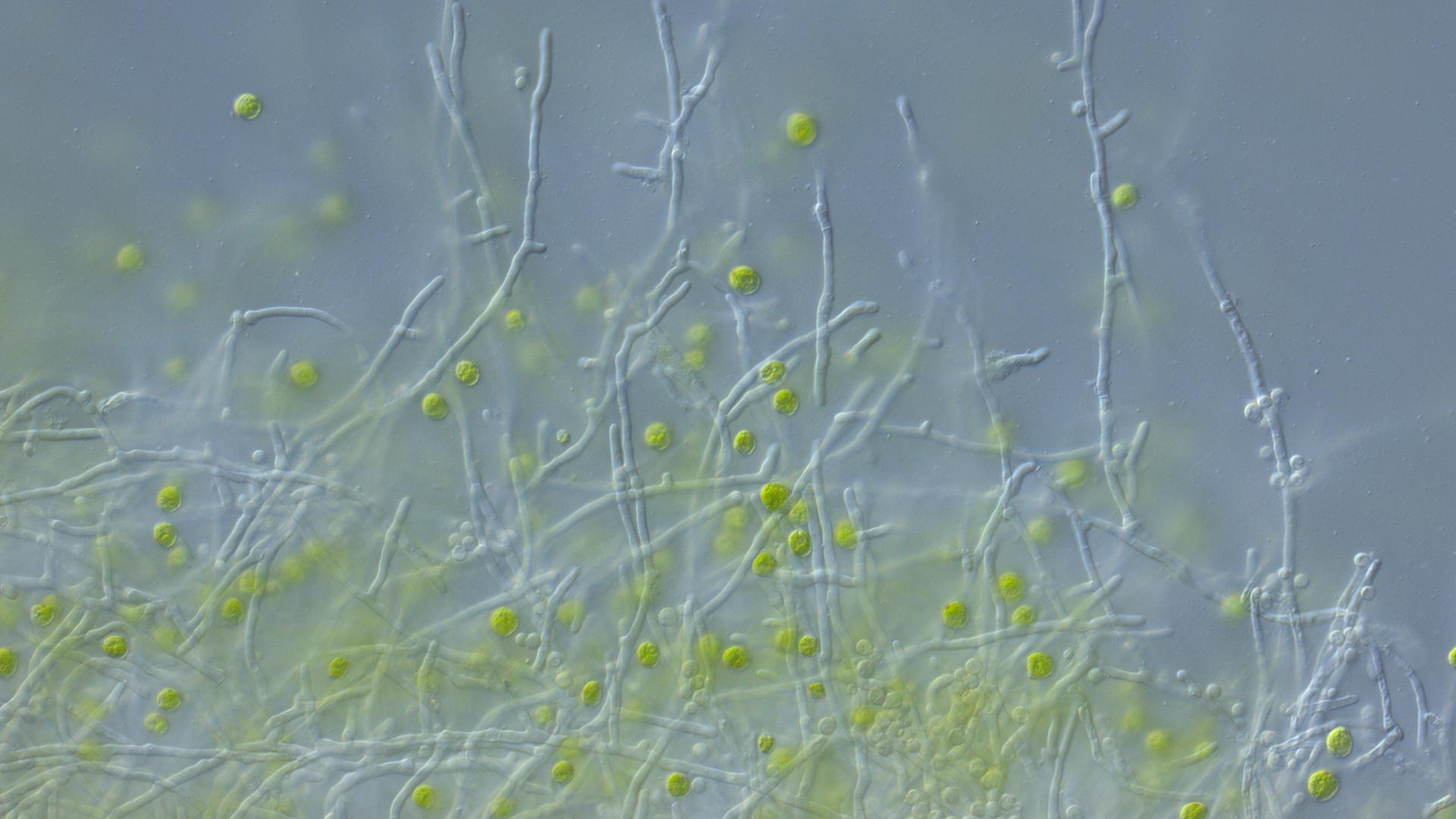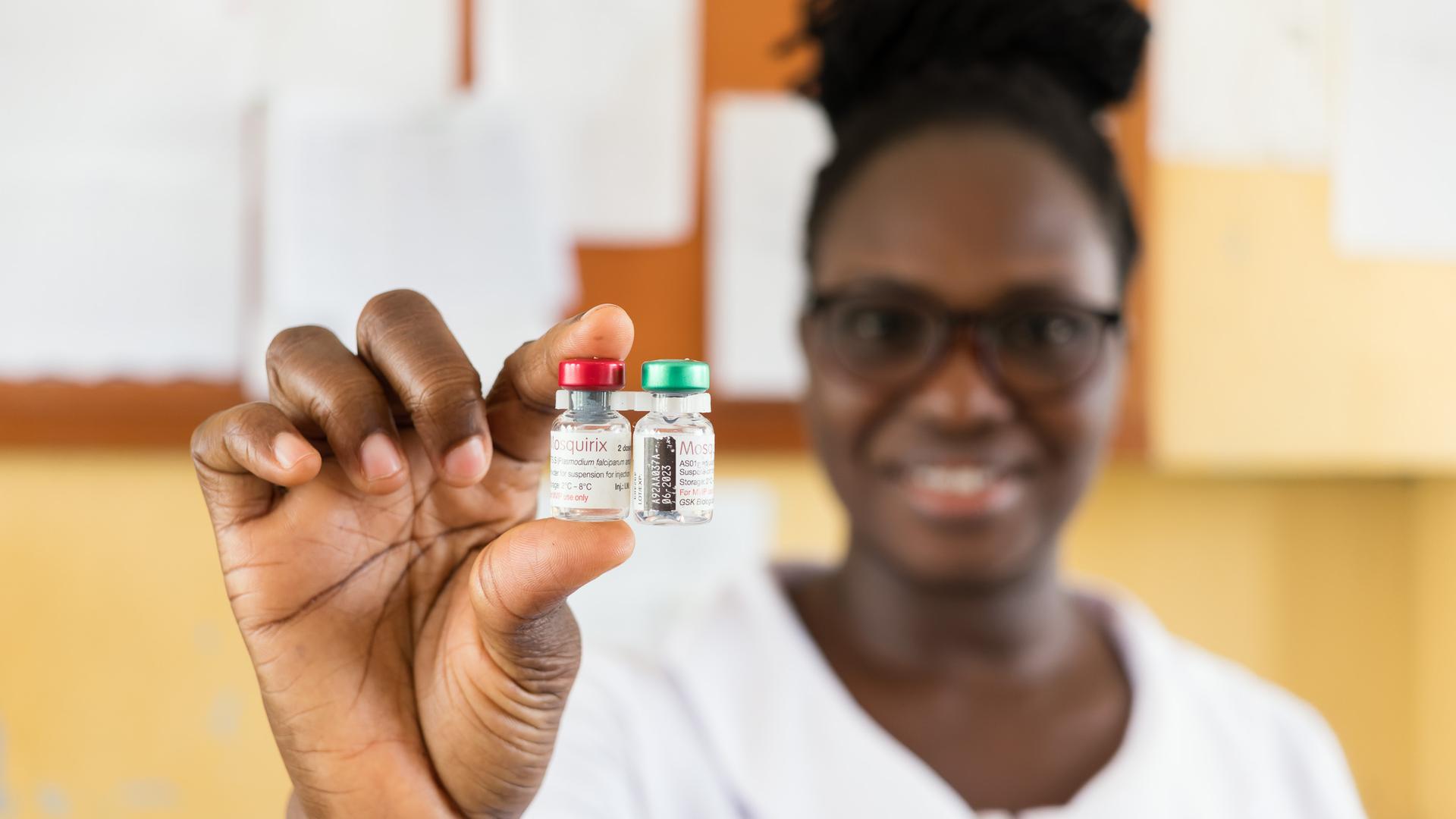Mit steigenden Corona-Zahlen wächst die Sorge vor erneuten Schulschließungen. Brandenburg überlegt aktuell, die Schulpflicht aufzuheben. Tatsächlich sind die Inzidenzen bei den Schülerinnen und Schülern besonders hoch. Bei den 10- bis 19-Jährigen liegt die Inzidenz bundesweit bei fast 600.
"Bei den Unter-15-Jährigen brodelt es genauso wie bei den Bis-35-Jährigen"
Aber was steckt eigentlich hinter dieser fast 600? Welche Rolle spielen Schülerinnen und Schüler im aktuellen Pandemiegeschehen? Jan Mohring, Mathematiker am Fraunhofer Institut in Kaiserslautern sagte im Dlf, die hohen Zahlen bei Schülerinnen und Schülern seien auch darauf zurückzuführen, dass in der Altersgruppe von 0 bis 14 die Entdeckungsrate doppelt so hoch sei wie bei der folgenden Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen. "Das heißt, die jungen Kinder sind nicht die Treiber, sondern die werden einfach stärker entdeckt", so Mohring.
Das Interview im Wortlaut:
Jan Mohring: Ja, also ich muss so ein bisschen ausholen vorneweg, wie wir solche Fragen überhaupt beantworten. Und mit unseren Modellen versuchen wir immer, die Wirklichkeit nachzuspielen, das heißt, wir haben dort Modellparameter und an denen drehen wir so lange rum, bis unsere vorhergesagte Ausbreitungsdynamik dieselben gemeldeten Fälle ausspuckt wie die, die auch beim RKI auflaufen. Und die wesentlichen Modellparameter sind dort natürlich die Kontaktraten zwischen den verschiedenen Altersgruppen, Impfraten, solche Dinge, aber eben auch, ganz wichtig, die Entdeckungsrate pro Altersgruppe. Ja, und dabei kommt dann was ganz Interessantes raus.
"Die jungen Kinder sind nicht die Treiber"
Wenn man sich die gemeldeten Zahlen anguckt, dann sieht man eindeutig, bei der Altersgruppe 0 bis 14, da ist die Ansteckungsrate etwa doppelt so hoch wie bei der folgenden Altersgruppe, den 15- bis 34-Jährigen. Und der naheliegende Gedanke wäre ja dann auch, okay, die ungeimpften Kinder, das sind die Treiber der Pandemie. Aber wenn wir jetzt gucken, was unser Modell ausspuckt, das sagt eine andere Begründung, das sagt nämlich, die Entdeckungsrate ist bei den Jungen doppelt so hoch wie bei der folgenden Altersgruppe. Das heißt, die jungen Kinder sind nicht die Treiber, sondern die werden einfach stärker entdeckt, und das ist der Grund.
Kathrin Kühn: Das bedeutet, wir können die Inzidenzen zwischen diesen Altersgruppen gar nicht so eins zu eins einfach vergleichen.
"Schüler werden noch wesentlich häufiger getestet"
Mohring: Ja, genau, weil die Inzidenzen beziehen sich ja immer auf die gemeldeten Zahlen, und wenn jetzt aber in der einen Altersgruppe viel mehr entdeckt werden, dann haben die eine höhere Inzidenz, obwohl tatsächlich sich das unter diesen Bevölkerungsanteilen nicht stärker ausbreitet. Also man darf sich nicht immer darauf verlassen, was gemeldet wird, sondern man muss sich immer überlegen, was brodelt denn da unter der Oberfläche tatsächlich? Und dort zeigt sich: Das brodelt bei den Unter-15-Jährigen genauso wie bei den Bis-35-Jährigen. Da ist kaum ein Unterschied. Bloß die Jungen, die werden halt viel öfter entdeckt, weil sie viel stärker getestet werden.
Mehr zum Thema Impfpflicht
Kühn: Da sprechen Sie jetzt die Schultestungen an, also, dass mittlerweile ja eigentlich überall flächendeckend gescreent wird bei den Jüngeren.
Mohring: Ja, das ist so. In manchen Bundesländern hatte man das mal ausgesetzt. Also zum Beispiel in Thüringen hatte man das zwei Wochen nach den Sommerferien dann ausgesetzt, das war nicht so toll. In Rheinland-Pfalz wurde die Testrate jetzt von zwei Mal pro Woche … Die letzte Woche wurde dann auf nur einmal runtergesetzt. Das war auch nicht so toll. Aber insgesamt ist es so: Schüler werden noch wesentlich häufiger getestet als der Rest der Gesellschaft, ist also ein guter Indikator, was tatsächlich unter der Oberfläche so brodelt. Und dort ist halt ganz wichtig: Es werden eigentlich nur die Ungeimpften getestet im Gegensatz zu früher. Also früher waren alle Kinder ungeimpft und da wurden alle getestet, das war ein Super-Monitor, was wirklich passiert, jetzt ist das nur noch ein eingeschränkter Monitor, weil wir wirklich nur noch die Ungeimpften sehen, und die Geimpften Kinder, die man jetzt nicht mehr testet, die können es ja auch haben. Deswegen ist das aus meiner Sicht eher ein bisschen verhängnisvoll, dass man nur die Ungeimpften noch testet.
"Je mehr ich teste, desto besser ist das"
Kühn: Was könnte uns das denn für einen Vorteil verschaffen, wenn jetzt doch wieder alle Kinder und Jugendlichen in der Altersgruppe getestet werden? Erkennen Ihre Modelle da auch positive Effekte möglicherweise?
Mohring: Im Endeffekt ist der Netto-Effekt: Wenn man Leute viel testet, dann sieht man am Anfang erst mal viel mehr, da erschrickt man. Aber langfristig, wenn man viel entdeckt, dann werden viele in Quarantäne genommen, diese ganzen Leute können nicht mehr die Reste ihrer Virenlast abwerfen. Man entdeckt auch bei Kindern deren Eltern und deren Familienangehörige, die sind dann häufig auch noch infiziert. Also im Endeffekt: Je mehr ich teste, das gilt nicht nur für Schüler, je mehr ich teste, desto besser ist das, dass man die Pandemie in den Griff bekommt. Bei den Schülern, da ist es leider so, die sind jetzt die Opfer unserer Gesellschaft, also die müssen immer alles ausbaden, oder besser gesagt, die Schüler, die wissen noch, dass man nicht egoistisch ist, und die ziehen das mit, weil die ihre Eltern und Omas und Opas schützen wollen. Diesen Mangel an Egoismus, den würde ich mir gerne auch mal für die älteren Generationen wünschen, ja.
Entdeckungsrate sinkt stark in höheren Altersgruppen
Kühn: Können Sie denn etwas zu dem Dunkelfeld in den älteren Altersgruppen sagen? Also wie sieht das da möglicherweise aus? Wenn wir jetzt eher in Richtung einer Vollerfassung bei den Jüngeren in Teilen kommen können, wie viel wissen wir dann nicht bei den Älteren?
Mohring: Ja. Also wir haben das mal nachgeprüft, was unsere Modellanpassung da so ausspuckt. Wenn man verschiedene Altersgruppen hat, dann kann man ausrechnen, wie ungefähr die relative Entdeckungsrate ist oder die relative Dunkelziffer, und das sage ich Ihnen jetzt mal.
Nehmen wir die nächste Altersgruppe, die Altersgruppe 15 bis 34, dort sagt unsere Modellanpassung, dass dort die Entdeckungsrate ungefähr nur 50 Prozent von dem beträgt, wie sie bei den ganz jungen Kindern bis 14 gemessen wird, also nur 50 Prozent dort. Und dann ein bisschen besser wird es in der Elterngeneration, sagen wir so, da ist die Entdeckungsrate noch 63 Prozent von den ganz jungen Kindern, und bei den Über-60-Jährigen dann so ungefähr 58 Prozent, das sagt unsere Modellanpassung. Ganz grob gesagt: Junge Schüler haben eine gewisse Entdeckungsrate, und die danach folgenden Altersgruppen haben ungefähr noch die Hälfte davon.
"Im Netto-Effekt ist es besser, die Schulen offen zu lassen"
Kühn: Sehr spannend. Das habe ich so in der Form noch nie gehört. Was heißt das denn jetzt? Was wäre, wenn man die Schulen jetzt schließt? Was sagen Sie dazu?
Mohring: Ja, das ist jetzt nicht so, dass wir da keine Erfahrung hätten. Es gab in Bayern eine Studie von einer Arbeitsgruppe um den Herrn Kauermann, der hat genau das untersucht. Also damals stand zur Debatte, in Bayern sollen Schulen geschlossen werden oder lieber doch offen gelassen werden. Und in manchen Landkreisen wurde das eine gemacht, in anderen das andere. Und da kam dann raus, dass im Netto-Effekt es besser ist, Schulen offen zu lassen. Man hat ja zwei Effekte. Also wenn man die Schulen schließt, dann können die Kinder niemanden mehr oder können sich weniger untereinander anstecken. Und der andere Effekt ist: Wenn ich sie offen lasse, dann entdecke ich mehr und dann kann ich mehr in Quarantäne nehmen. Und vorneweg ist ja nicht klar, welcher dieser beiden Effekte der stärkere ist. Aber diese Studie von dem Herrn Kauermann hat eben eindeutig für Bayern gezeigt: Netto-Effekt ist es besser, die Schulen offen zu lassen und eine höhere Entdeckungsrate zu haben. Also alle Beispiele, die es gibt in der Vergangenheit, zeigen immer: Schließen ist schlechter als Schulen offen lassen und viel testen.
Kühn: Dann die abschließende Frage. Wenn man jetzt also auf die Idee kommt, Schulen zu schließen als vielleicht einer der letzten Schritte, heißt das, gleichzeitig muss komplett unterbunden werden, dass dann noch Kontakte stattfinden können eben in diesem isolierten Umfeld? Also Schulen schließen ohne Betriebe schließen zum Beispiel macht dann keinen Sinn?
Mohring: Ja, das würde ich so unterstützen. Man muss sich Folgendes vorstellen: Also ich hatte vorhin ausgeführt, die jungen Schüler sind nicht die Treiber, allerdings werden die Schüler viel häufiger entdeckt und tragen so zu einer besseren Quarantäne und Bekämpfung der Pandemie bei. Wenn man jetzt also speziell die Schüler nur nach Hause schickt und den Rest nicht, dann treffen wir keine besonders ansteckende Gruppe, aber wir treffen genau die Gruppe, die dafür sorgt, dass wir die Sache verfolgen und entdecken können. Von daher wäre das genau die falsche Maßnahme, das jetzt zu tun.
//Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.//