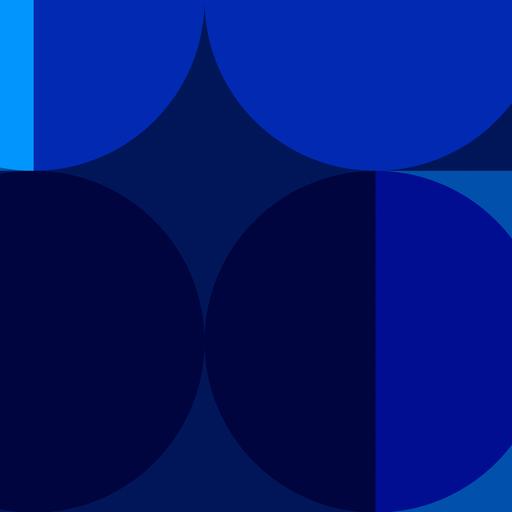Luxemburg ist Gründungsmitglied der Montanunion. Das Großherzogtum gehört damit seit jeher zum Kern Europas. Hier ist die Heimat von Jacques Santer. Die Biografie, die berufliche Laufbahn des 1937 im Grenzort Wasserbillig geborenen Politikers, ist von Beginn an transnational geprägt. Schon das Jura- und Wirtschaftsstudium absolvierte er im Ausland, in Straßburg und Paris. In Luxemburg schließlich ging er früh in die Politik, nahm führende Positionen in der Christlich Sozialen Volkspartei ein, wurde in den 70er-Jahren Staatssekretär im Arbeitsministerium und später Minister. In diese Zeit fällt einer der zentralen Erfolge von Jacques Santer: Er war maßgeblich beteiligt an der Schaffung des Luxemburger Modells:
Ein Gesprächsformat, das Arbeitgeber, Gewerkschaften und Regierungsvertreter an einen Tisch brachte. Gemeinsam suchten sie einen Ausweg aus der schweren Wirtschaftskrise, von der nicht zuletzt die luxemburgische Stahlindustrie betroffen war. Zeitgleich wurde Jacques Santer auf europäischer Ebene tätig: als Vizepräsident des Europaparlaments, als Mitbegründer der konservativen Europäischen Volkspartei. 1984 schließlich wurde der Luxemburger zum Ministerpräsidenten seines Landes gewählt. Gute zehn Jahre später ging es erneut auf die EU-Bühne:
Jacques Santer wurde überraschend und mit deutscher Rückendeckung EU-Kommissionspräsident und trat damit in die große Fußstapfen von Jacques Delor. Die Vertiefung der EU, die Vorbereitungen zur Osterweiterung und die Einführung des Euro gehörten zu den großen Herausforderungen seiner Amtszeit. Während die einen Zeitgenossen Santer als behutsamen Moderator schätzten, kritisierten ihn andere als politisch schwach. Aufgrund massiver Korruptionsvorwürfe, insbesondere gegen die französische Kommissarin Édith Cresson, folgte 1999 der Rücktritt der kompletten EU-Kommission unter seiner Führung.
„Man sieht ja auch, dass die Förderer der europäischen Einheit zum größten Teil Leute und Männer aus Grenzgebieten waren.“
Wege eines Luxemburgers
Stephan Detjen: Herr Santer, Ihr Vater war Polizist, stammt aus einer Bauernfamilie, auch die Vorfahren Ihrer Mutter waren das, was man so einfache Leute nennt, bäuerlicher Hintergrund. Einem Kind aus so einer Familie ist es auf den ersten Blick jedenfalls nicht ins Stammbuch geschrieben, dass es Rechtswissenschaften studiert, Sie in Straßburg, in Paris und dann eine große Karriere als Politiker macht.
Jacques Santer: Nein, das kann man schon sagen. Meine Eltern haben sich eben sehr stark engagiert. Sie waren, wie Sie sehen, aus kleinen Verhältnissen, und sie hatten zwei Söhne, und sie haben insistiert, und das kommt bei diesen Leuten öfters vor, dass sie aus ihrer Schicht herauswachsen wollen und mich gefördert haben, auch höhere Studien zu machen, auch die sie noch bezahlt haben. Das war nicht einfach. Auch mein Bruder, der ist Ingenieur geworden, er hat in Aachen studiert, er ist Metallurgist, also zur Arbeit gegangen, wie das damals üblich war, und deshalb bin ich immer da zu hohem Dank meinen Eltern verpflichtet, dass sie das fertiggebracht haben.
Detjen: Und das war dann auch – entnimmt man dem, was Sie jetzt sagen –, in Luxemburg nicht verwunderlich, gleich auch angelegt als europäische Biografie: Man studierte, ging nach Frankreich, nach Deutschland in Ihrem Fall.
Santer: Ja, sicher. Wie gesagt, ich bin ja in Wasserbillig geboren, am Zusammenfluss von Mosel und Sauer, und nah an Trier. Trier ist –.

Detjen: Und das ist auch an Ihrem Akzent, den man an der Sprache, der Mosel …
Santer: Elf Kilometer von uns entfernt. Da liegt Trier, und wenn wir sagten damals, wir gehen in die Stadt, dann gingen wir nach Trier, nicht nach Luxemburg. Luxemburg ist weiter entfernt von Wasserbillig als Trier, und deshalb hatten wir immer Verbindungen, auch familiäre Verbindungen. Es waren Vetter, die sich mit Deutschen verheiratet haben und so weiter. Deshalb haben wir auch das Trennende in den Grenzen stärker empfunden als andere Leute, und man sieht ja auch, dass die Förderer der europäischen Einheit zum größten Teil Leute und Männer aus Grenzgebieten waren. Ein Robert Schumann, der hier in Luxemburg geboren wurde, in einem Vorort in Luxemburg, in Clausen, als Deutscher, lothringischer Deutscher, in Bonn studiert und französischer Außenminister wurde; oder Degasperi der in Triest geboren wurde, als Triest noch Österreich war und dann in Österreich direkt überging und so; oder der Rheinländer Konrad Adenauer – das waren Grenzleute, alle … und die Luxemburger selbstverständlich auch, wie Joseph Bech, und die auch das Trennende der Grenze erlebt haben. Das habe ich immer empfunden. Deshalb bin ich auch sehr jung engagiert in die europäische Bewegung gekommen, sehr jung.
„Was mich damals sehr stark emotionell berührt hat, das war, als die Sowjetunion zusammenbrach.“
Detjen: Und zwar auch – und das teilen Sie auch mit vielen der Generation, der Biografien, die Sie jetzt geschildert haben, der Gründergeneration Europas – dann prägend in der katholischen Jugendbewegung. Da war der europäische Gedanke sehr stark. Was hat Sie da geprägt, und was hat Sie gerade in diesem katholischen Milieu auch politisch geprägt dann?
Santer: Ich war Mitglied der katholischen Aktion, wie Sie gesagt haben, der Studentenvereinigung zuerst, und dann war ich Vorsitzender aller katholischen Jugendverbände, auch der Arbeiterjugendverbände und so weiter. Ich habe mich immer sehr stark engagiert gefühlt zu der sozialen Frage, die ich damals auch schon gestellt habe. Meine erste Arbeit war über Karl Marx, die ich geschrieben habe. Ich habe mich sehr stark dann über die soziale Enzykliken der Kirche [unverständlich]. Ich hatte öfters Gelegenheit damals mit dem Jesuitenpater von Nell-Breuning hier auch in Luxemburg oder in Trier, er war ja in Trier auch.
Detjen: Und natürlich auch jemand, der die deutsche katholische Soziallehre geprägt hat.
Santer: Sehr stark. Und für mich – um das mal zu sagen –, was mich damals sehr stark emotionell berührt hat, das war, als die Sowjetunion zusammenbrach, und Nell-Breuning in diesem Jahr bekam 100 Jahre alt oder 90, und er wurde geehrt in Trier, in der Machtstadt Trier, wurde von Nell-Breuning [unverständlich], weil Breuning hat sich durchgesetzt über die sozialen Lehren und nicht Karl Marx.
Detjen: Das erklärt dann auch schon wieder viel von dem, was man in Ihrer politischen Biografie …, wenn wir zunächst mal auf Ihre Aktivität als Politiker in Luxemburg schauen, was die prägt. Es war eine Zeit, in der Luxemburg geprägt war vom Strukturwandel, ein Land, eine Region, die geprägt war noch von der Schwerindustrie, die in eine schwere Krise geraten war. Es ging darum, politisch diesen Wandel zu gestalten. Das haben Sie dann in verschiedenen Funktionen, in der Regierung als Minister, ab 84 dann als Premierminister in Luxemburg, mitgestaltet. Ein Weg, der auch von außen wahrgenommen wurde als ein Weg des Ausgleichs, der Moderation, Sozialpartnerschaft, der Luxemburger Weg wurde das genannt, wurde auch in Deutschland rezipiert, nachgeahmt, und vieles davon ist mit Ihrem Namen verbunden gewesen. Erzählen Sie uns, was war das für eine Politik?
Santer: Wenn ich so zurückblicke – natürlich, mit 80 Jahren ist das eine lange Zeit –, da habe ich festgestellt, dass in unserem kleinen Land, jede 25 Jahre ungefähr, ein neuer Strukturwandel entsteht. So zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich gehe aus von dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es die Aufbauarbeit. Der nördliche und östliche Teil war ja vollständig durch die Rundstedt Offensive zerstört worden, und das waren die Golden Sixties, die Stahlindustrie, die blühte, ARBED, unser Stahlkonzern, der war ein Staat fast im Staat und so weiter, und das hat dann gedauert bis zu den 70er-Jahren. Dann kam eine neue Zeit: Dann war die weltweite Krise, auch für die Stahlindustrie und so weiter. Wir haben den Stahlabbau, den Personenabbau vollzogen, ohne dass ein Tag Streik war, und dann haben wir eine neue Diversifizierung hier in Luxemburg eingeläutet mit neuen Betrieben, die wir angesiedelt haben, mit dem Aufbau des Finanzplatzes und so weiter.
Diese Zeit hat auch jetzt wieder 20, 25 Jahre angedauert bis jetzt, wo seit 2007, 8 eine neue Krise entstanden ist, wo wieder Strukturreformen, auch in Luxemburg, zu bewerkstelligen sind und so weiter. Man sieht also, dass man immer eine Periode hat von, sagen wir mal: Von einer Generation, wo man sich umstellen muss, und in Luxemburg ist das zum Beispiel, wie Sie angeführt haben, gelungen, weil wir eben das Luxemburgische Modell, die partnerschaftliche Beziehungen zwischen den Sozialpartnern und der Regierung herbeigeführt haben. Ich bin auch heute sehr stolz darüber, dass mein erstes Gesellenstück war, 1972, 73, die Mitbestimmung in Luxemburg einzuführen in den Verwaltungsräten der großen Gesellschaften, im Bankensystem auch, und das war der Ursprung des sozialen Modells in Luxemburg mit dem Dreiparteiensystem. Ich bin heute noch immer felsenfest davon überzeugt: Für ein kleines Land ist es wesentlich, dass dieses partnerschaftliche Verhältnis bestehen bleibt. In einem kleinen Land ist das nicht wie in einem großen Land. Jedermann ist auf sich angewiesen.
Detjen: Lassen Sie uns noch mal zurückkommen auf das Stichwort Strukturwandel. Sie haben das eben geschildert, diese 25-Jahreszyklen, die dann immer wieder zu Krisen, zu Restrukturierungen führen. Das klang so etwas naturgesetzlich, so ist das, aber es ist ja trotzdem verbunden mit Weichenstellungen, mit Entscheidungen, die man trifft, und die dann im Rückblick zum Teil dann auch problematisch aussehen. Das galt ja auch für die Entscheidungen, die mit Blick auf den Ausbau des Finanzplatzes Luxemburg getroffen worden sind. Jean-Claude Juncker, Ihr Nachfolger sowohl als Premierminister, dann auch als jetziger Präsident der EU-Kommission, hat da dann große Probleme bekommen, musste sich starken Vorwürfen aussetzen, Stichwort Luxleaks. Sind da Weichen im Rückblick auch falsch gestellt worden?
„Der Steuerdirektor ist fast etwas wie ein Staat im Staat.“
Santer: Ich weiß nicht, ob sie falsch gestellt worden sind, aber man muss sich in diese Zeit wiederversetzen, wo es eben, wie Sie zu Recht geschildert haben, Strukturprobleme gab. Der Finanzplatz Luxemburg ist ja an sich schon in den 30er-Jahren entstanden. Wir waren die Ersten, die die Holdingsgesellschaften 1933 erfunden haben und damit auch einen Zustrom von Finanzaktivitäten nach Luxemburg gezogen haben. Und diese wurden dann ausgebaut in den Ende 70er-Jahren, Beginn der 80er-Jahre, und ich habe immer drauf … – ich war ja auch eine Zeit lang, zehn Jahre Finanzminister –, immer aufgebaut, dass wir immer mit den konkurrierenden Finanzplätzen dasselbe hatten, kompetitiv blieben. Wir hatten uns immer verglichen zum Beispiel mit der Schweiz. Wenn die Schweizer keinen Schritt nach vorne machen wollen, zum Beispiel, was das Bankgeheimnis anbelangt, dann haben wir auch nicht vorne gemacht. Wir hatten immer gesagt, wir gehen soweit wie unsere konkurrierenden Plätze hier in Europa. So muss man das auch verstehen in der Entwicklung. Jetzt ist eine Entwicklung eingetroffen in Europa, wo eine transparentere Situation im Bankensektor entstanden ist, wo das Bankengeheimnis zum großen Teil abgebaut wurde. Und da können die Luxemburger mitziehen, auch in dieser Richtung, weil das auch in der Schweiz so der Fall war. Auch in anderen konkurrierenden Finanzplätzen, zum Beispiel in Belgien und auch in Holland. Sie haben zu Recht von Luxleaks und so weiter gesprochen, aber die Luxleaks waren ja nicht nur in Luxemburg. Die waren auch in Holland, die waren auch in Belgien und so weiter. Weshalb wurden sie Luxleaks? Weil sie aufgedeckt wurden von einem Beamten, der eben das in die Öffentlichkeit gebracht hat, und der natürlich gerichtlich deshalb belangt wurde, weil er seinen Arbeitsvertrag eben nicht eingehalten hat. Dasselbe könnte man sagen in Holland und so weiter, aber es war ein Luxleaks, weil das das erste Mal ist, wo man auf die Optimierung des Fiskal eingegriffen hat, aber die Regierung selbst, wie Juncker und ich selbst, wir haben nie, nie irgendwie eine Instruktion unserer Steuerverwaltung gegeben. Das gibt es nicht. Der Steuerdirektor ist fast etwas wie ein Staat im Staat, möchte ich sagen, und wir hätten es nie gewollt, uns da einzumischen, und Juncker hatte sich ganz sicher auch nicht eingemischt, so wie ich mich – damals gab es noch keine Leaks so wie das jetzt ist – nicht eingemischt habe.

„... der Geist fehlt ein wenig“
Detjen: Die Länder, die Sie jetzt erwähnt haben, auch sozusagen als die Referenzpunkte, die man aus der hiesigen Luxemburger Perspektive im Blick hatte, das sind die Schweiz als außereuropäisches Land, aber dann die kleinen europäischen Länder, Beneluxländer. Als ein Vertreter von denen saßen Sie ja dann auch in der Eigenschaft als luxemburgischer Regierungschef auch im Europäischen Rat an der Seite der Großen, der Starken, und die Kleinen hatten immer die Angst, dass sie von den Großen dominiert werden. Bei den Großen war dann wieder Kohl, der dann gesagt hat, wir müssen die Kleinen mitnehmen. Sie haben mal gesagt, die kleinen Länder sind das Herz der europäischen Integration. Welche Rolle spielen die, was geben die kleinen Länder aus Ihrer Sicht Europa?
Santer: Sicher haben die kleinen Länder, zum Beispiel die Beneluxstaaten eine gewisse Rolle gespielt, eine wichtige Rolle gespielt. So haben die Beneluxstaaten sich auch immer – und ich glaube, das war auch das Wesentliche daran –, immer verstanden als europäische Befürworter aus einem ganz einfachen Grunde: Wir haben ja, wie andere Staaten auch, ein gewisses Souveränitätsrecht aufgeben müssen. Das ist ja klar, aber wir waren uns bewusst, dass wir dieses Souveränitätsrecht gemeinsam mit den anderen, mit den Großen ausüben können und dann würden die Beneluxstaaten stärker oder die kleineren Staaten stärker, als wenn sie alleine geblieben wären, und das hoffe ich, dass wir noch heute so bleiben. Ich sehe, dass in der Benelux nicht mehr derselbe Geist ist, wie das früher der Fall war, sind andere Leute da, die sich vielleicht wohl politisch gut verstehen, aber der Geist fehlt ein wenig, und ich würde mir erwarten, dass besonders in diesen Krisenzeiten, die Europa ja durchmacht, gerade die kleinen Staaten und die Beneluxstaaten eine stärkere Antriebskraft zum Ausdruck bringen würden.
„Dann hat Kohl mich angerufen und gesagt, es käme kein anderer infrage als ich selbst“.
Kommissionspräsident fast wider Willen
Detjen: Jetzt haben Sie ja vorhin auch sehr plastisch geschildert, wie dieser europäische Geist ein typischer Teil Ihrer Generation ist, geprägt in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, durch die Erfahrungen, die man gerade in dieser Zeit, in dieser Zeit Generation gemacht hat, und so sehr Sie geschildert haben, wie Europa immer in Ihrem Fokus war, immer bis in die Gegenwart Teil, natürlicher Teil der Politik eines Luxemburgischen Regierungsmitglieds, Regierungschefs ist, war es ja nicht so, dass Sie es angestrebt haben, dann in das europäische Amt als Kommiszionpräsident zu wechseln. Das kommt dann 1994, EU-Gipfel …
Santer: Ja, aber ich war nie Kandidat selbst.
Detjen: Sie waren nie Kandidat!
Santer: Ich war nie Kandidat. Ich war …
Detjen: Das ist eine Situation …, Jacques Delors, es muss die Nachfolge für Delors gesucht werden, eigentlich sollte es der Belgier Dehaene werden, Kohl wollte eigentlich …
Santer: Den wir unterstützt haben, den ich unterstützt habe.
Detjen: Und kam dann aber auf Sie zu als Kompromisskandidat.
Santer: Das war eine schwierige Sache. Zuerst muss ich mal sagen, leider waren zwei Ministerpräsidenten der Benelux Kandidat. Das war Dehaene und Ruud Lubbers, und damals wurde ich beauftragt, übrigens von Kohl, einen Ausgleich zu finden, eine Vermittlungsrolle zu spielen zwischen Dehaene und Lubbers. Ich habe das auch versucht. Dann haben wir vereinbart, dass derjenige, der die meisten Stimmen in Korfu erhalten – das war ja unter griechischer Präsidentschaft –, dass derjenige, der unterlegen wäre, dass der sich zurückziehen soll. Das kam nicht dazu. Sie haben recht, zu sagen, wir hatten die zwei Kandidaten, aber Kohl war entschieden gegen Lubbers. Ganz klar, denn Lubbers hatte 1989 … war er zwiespältig, was die deutsche Vereinigung anbelangte nach dem Fall der Berliner Mauer, und aus diesem Grunde war Kohl auch nicht so begeistert von einer Kandidatur von Ruud Lubbers. Es waren andere Kandidaten da. Ich war nicht Kandidat, ich hatte meine dritte Amtsperiode begonnen, gerade begonnen. Ich hatte die dritte Wiederwahl gewonnen. Ich habe eine neue Koalition gebildet. Ich sollte am 13. Juli vom Großherzog mit den Ministern vereidigt werden, und dann hat Kohl mich angerufen und gesagt, es käme kein anderer infrage, nachdem er mit Mitterrand und Berlusconi gesprochen hatte in Neapel – das war der G7-Gipfel in Neapel –, es käme kein anderer infrage als ich selbst. Und gut, dann bin ich am 15. Juli dann Kommissionspräsident … Ich war nicht begeistert zuerst.
Detjen: War es nicht begeistert oder war es auch widerwillig, auch diese Kür des neuen Kommissionspräsidenten wurde auch in der Öffentlichkeit ja kritisch gesehen. Eine deutsche Zeitung schrieb damals: „Man einigte sich schließlich“, – ich zitiere das jetzt hier – „widerstrebend auf den Luxemburger Jacques Santer. Er galt den Regierungschef als vermittelnder, passiver Präsident, ein Mann ohne Konturen, ein Kompromisskandidat eben.“
Santer: Ja, das kann man nicht gerade so sagen. Als Kompromisskandidat schon, denn es war kein … Das war schon, aber ich hatte Genscher … Damals war er ja der Außenminister, FDP-Mann, Außenminister der Regierung Kohl. Er hat einen großen Artikel in der Welt geschrieben, wo er sagte, der richtige Mann am richtigen Platz, aber nicht im Moment. Das kann man auch sagen, aber wie gesagt, ich war nicht so begeistert, denn ich liebe mein Land, wir hatten eine gute Regierungsverwaltung, das Land … Ich hatte immer einen sehr starken Bezug zu meiner Wahlbevölkerung, zum Lande, ich war nicht so angetan, auf höhere Posten überzugehen. Das stimmt schon.
„Ich möchte sagen, dass ich diese drei Punkte durchgezogen habe.“
Detjen: Und es war auch klar, dass Europa natürlich …, dass da eine sehr schwierige Aufgabe auf Sie wartete. Europa steckte in einer gigantischen Dynamik, die ja schon vor Beginn Ihrer Amtszeit angeschoben war, die Verträge mussten weiterentwickelt werden, von Maastricht dann zu Amsterdam – das war in Ihrer Amtszeit –, die Einführung des Euro stand bevor, die Osterweiterung stand auf der Agenda. Wie haben Sie Europa damals gesehen? Da gab es auch Skepsis.
Santer: Ja, wir hatten die drei Punkte: erstens, die Währungsunion, zweitens die Erweiterung der Europäischen Union, und dann drittens die Reform der Gemeinschaftspolitiken durch die Agenda 2000. Die Agenda 2000, das war ja die Neuordnung, möchte ich sagen, der Finanzen Europas durch die neue Landwirtschaftspolitik, den Strukturfonds, und in der finanzpolitischen Vorausschau bis zum Jahre 2007. Ich möchte sagen, dass ich diese drei Punkte durchgezogen habe. Erstens, der Euro wurde am 1. Januar 1999 eingeführt als Rechtsmittel, zweitens die Erweiterung, die Strategie, die Erweiterung haben wir in Angriff genommen und, sagen wir: soweit wie es damals möglich war, durchgezogen, nämlich 1997, kann ich sehr gut erinnern: Damals hatten wir ja gesagt, nur mit verschiedenen möchten wir verhandeln, nicht mit allen Beitrittskandidaten, nur mit verschiedenen, und dann die anderen in ein institutionelles Gremium einbinden, ohne dass sie Mitglied der Union würden, und dann weiter suchen, bis sie alle Kriterien erfüllt haben und dann weiter verhandeln.
Detjen: Das war Ihr Plan.
Santer: Das war unser Plan.
Detjen: Der dann aber ganz anders gelaufen ist.
Santer: Und wir haben der Türkei ganz ausdrücklich kein Kandidatenstatut gegeben. Im Nachhinein …
Detjen: Sie haben im Nachhinein mal gesagt, dass, was dann später passiert ist, dann auf dem Gipfel in Helsinki 2000, sei der Kardinalfehler gewesen.
Santer: Das war ein Kardinalfehler, meines Erachtens jedenfalls.
Detjen: Also eine Zustimmung, die Osterweiterung zu schnell …
Santer: Dass dann, diese sogenannte Regattareform eingeführt hatte, wo alle Beitrittskandidaten zu gleicher Zeit ins Meer geworfen wurden, möchte ich sagen, und das war dann gesagt worden, dass diese Kandidaten dann nach ihren eigenen Meriten, nach ihren eigenen Verdiensten dann überprüft wurden, aber man wusste ja ganz genau, wenn man zu gleicher Zeit mit allen verhandeln wird, dann kommen sie zu gleicher Zeit alle am selben Punkt an, und das ist ja geschehen. Dann wurde dann, anstatt mit sechs Staaten zu verhandeln, wurde dann mit 12 verhandelt, und die wurden dann bei den 15 aufgenommen, zu gleicher Zeit. Man muss ja bedenken, dass alle diese Länder, die wohl unterstützt werden müssen – das ist ja nicht das Problem, über die Assoziationsverträge und so weiter, – aber dass diese einen anderen Hintergrund haben, eine andere Kultur haben, dass die brauchen eine gewisse Zeit, bis, dass sie gleichgezogen werden, wenn man sieht, welche Probleme man hat noch heute, zum Beispiel mit Rumänien oder Bulgarien und so weiter, dann sieht man, dass das meines Erachtens den Verdauungsprozess der Europäischen Union überfordert hat. Es war eine Erweiterung, ohne Vertiefung herbeizuführen.

Detjen: Lassen Sie mich noch mal konkret auf die Person Viktor Orbán zurückkommen. Was sich da ja besonders dramatisch in einer Figur dieses Auseinanderdriften Europas in Vorstellungen, wenn man seine Vorstellung von Nationalismus betrachtet, das, was auf der Eben der Demokratie in Ungarn passiert, haben Sie eine Erklärung dafür, was in dieser Figur vorgegangen ist?
Santer: Ich hatte ja, möchte ich sagen, gute Beziehungen zu Orbán, als er zum ersten Mal Ministerpräsident wurde. Meine Kommission hat mit ihm die ersten Beitrittsverhandlungen angeführt und so weiter, und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. In der Zwischenzeit sind natürlich verschiedene Jahre vergangen, und da hat man gemerkt, Orbán, wenn Sie ihn angesprochen: Er kam dann in Opposition, und das hat ihm natürlich Schwierigkeiten gemacht, und er wollte natürlich diese Situation nicht wiedererleben, und dann ist er auf die andere Seite übergeschwenkt, aus der Oppositionszeit wieder in die Regierungsverantwortung, wo er verschiedene andere Positionen eingenommen hat, die ich mir persönlich nicht erklären kann. Persönlich nicht, ich habe ihn in der letzten Zeit nicht mehr persönlich getroffen, um mit ihm darüber zu sprechen.
Detjen: Was würden Sie ihn fragen, wenn Sie ihn sehen würden?
Santer: Wie er die Weiterentwicklung Ungarns innerhalb der Europäischen Union sieht. Das ist ja, institutionell gesehen, sehr wichtig, ob er alle diese institutionellen Aspekte auch wirklich [...] und auch die Kriterien, die ja durch den Lissabon-Vertrag festgelegt sind, die muss er respektieren. Ansonsten sind ja auch, was früher nicht der Fall war, verschiedene Sanktionen möglich, wenn gegen diese Regeln oder Grundprinzipien und Grundwerte in der Europäischen Union sie nicht beachtet.
Detjen: Das ist ja sehr schwierig. Was anderes ist es mit dem Parteienverbund. Orbáns Partei Fidesz ist immer noch Mitglied der EVP, Christlich Demokratischen … des Parteienverbundes in Europa, deren Präsident Sie ja auch waren. Passt das noch?
Santer: Ja, das ist eine große Frage. Ich weiß, dass verschiedene führende Leute, führende Persönlichkeiten in der Europäischen Volkspartei sich sehr große Gedanken machen über diese Entwicklungen hauptsächlich in Ungarn und was die Fidesz-Partei anbetrifft als Mitglied der Europäischen Volkspartei. Das ist schon richtig. Ich will mich nicht einmischen. Ich bin nicht mehr Vorsitzender, ich habe kein Amt mehr in der Europäischen Volkspartei, aber ich merke trotzdem, dass eine Unruhe entstanden ist auch in der europäischen Fraktion der EVP, der Europäischen Volkspartei, und ich glaube, dies muss einmal geklärt werden.
„Es war nicht ein persönliches Scheitern, möchte ich sagen. Es war selbstverständlich eine Enttäuschung.“
Macht, Ohnmacht, Rücktritt
Detjen: Lassen Sie uns noch mal auf Ihre Rolle als Präsident der EU-Kommission zurückkommen und auf die Institution schauen, diese EU-Kommission, gegründet als eine Art oberste Verwaltungsbehörde der Europäischen Union eigentlich, aber auch mit Elementen einer Regierung. Wie haben Sie diese Funktion und Ihre Rolle in dieser Institution gesehen?
Santer: Ich war immer der Meinung, dass die Kommission ihre Rolle voll und ganz wahrnehmen muss: Das ist die Rolle, dass sie die Legislative-Vollmachten hat, dass sie Vorschlagsrecht hat. Sie ist nicht nur exekutiv, aber sie hat auch das Vorschlagsrecht. Das kann weder vom Ministerrat noch vom Parlament etwas diskutiert werden, was nicht von der Kommission vorgetragen wird. Darauf haben wir immer gepocht, auch wenn der Ministerrat dann verschiedene Vorschläge nicht annehmen sollte, dann haben wir immer geschaut, um einen Kompromissvorschlag zu machen, aber der Vorschlag musste von der Kommission kommen und nicht vom Ministerrat. Heute ist das etwas anders, weil auch das Europäische Parlament ein großes Mitentscheidungsrecht hat, was es damals in dieser Form nicht so hatte. Deshalb war ja die Situation ein wenig anders, aber die Kommission – so wie ich es jedenfalls sehe – muss auf ihre legislativen Vorrechte pochen, denn sonst wird sie ein Spielball des Ministerrates, der Mitgliedschaft …
Detjen: Das ist ein Machtkampf, der immer noch anhält – ein Ringen um die Vorherrschaft. Da gibt es zwei Grundlinien: die Gemeinschaftsmethode, die intergouvernementale Methode. Angela Merkel hat sich mal in einer der wenigen, wirklich sehr expliziten Grundsatzreden, die sie über ihr Verständnis von Europa gehalten hat 2010 im Europakolleg in Brügge, hat sie das nebeneinandergestellt und hat sich da sehr stark gemacht für die Rolle des Rats, für die Rolle der Repräsentanten der Regierungen, der Mitgliedsstaaten. Faktisch haben die Regierungschefs nie losgelassen und sind letztlich nie losgelassen und sind letztlich immer die mächtigeren, die entscheidenden Akteure geblieben.
Santer: Scheint mir auch wichtig zu sein, dass alle Institutionen mit eingebunden werden. Ich habe immer gesagt, dass das Modell von Jean Monnet, der ja diese Struktur geschaffen hat, ein sehr kluges Modell war, denn auf der einen Seite hat er den föderalen Charakter irgendwie zum Ausdruck gebracht in der Kommission und im Europäischen Parlament und auf der anderen Seite den intergouvernementalen Charakter, und diese beiden müssen zusammenarbeiten, und die Institutionen, die können alleine nicht alles entscheiden. Und ich glaube, das ist natürlich eine Gewichtung, die sehr empfindlich ist zu handhaben, und man muss immer verstehen, dass da ein Ausgleich zwischen der föderalen Struktur und der konföderalen Struktur, möchte ich sagen, oder der intergouvernementalen Struktur ist. Man kann nicht hingehen und den Vorschlägen … und dann fragen, was der Rat vorschlägt, und dann diese Vorschläge von der Kommission einfach zu übernehmen. Das geht an sich nicht.
Detjen: Das Ende Ihrer Kommission, Jacques Santer, war Teil einer tiefen Institutionen-Krise in der Europäischen Union. Es gab einen heftigen Machtkampf zwischen Kommissionen und dem Europäischen Parlament. Die Kommission, besonders die Kommissarin Édith Cresson aus Frankreich stand in der Kritik wegen Verwendung von EU-Mitteln. Eine lange Geschichte, Geschichte eines langen Ringens. Was haben Sie damals empfunden, als Sie dann schließlich im März 1999 mit der gesamten Kommission zurücktreten mussten? War das auch ein persönliches Scheitern für Sie?
Santer: Es war nicht ein persönliches Scheitern, möchte ich sagen. Es war selbstverständlich eine Enttäuschung, das kann man nicht verneinen, aber ich habe keinen anderen Ausweg gesehen. Nicht ich selbst habe die gesamte Kommission, wie Sie gesagt haben …, das waren ja noch 19 andere Mitglieder in der Kommission, die an sich nichts mit der Affäre von Cresson und so weiter zu tun hatten, nichts mit Korruptionsfällen und so weiter. Das waren Kommissare wie Monti, habe ich genannt, wie Fischler, wie Karel van Miert und so weiter – alles tüchtige Kommissare.

Detjen: Aber Sie hatten nicht die Möglichkeit wie ein Regierungschef, ein Mitglied der Regierung sozusagen zu entlassen.
Santer: Das war eben das Problem. Wir hatten zwei Probleme: Auf der einen Seite, war es das Problem … Wir waren uns voll bewusst, dass die Frau Cresson vom Europäischen Parlament nicht getragen würde. Und deshalb haben wir ja versucht, dann auf sie einzuwirken und so weiter, und das ist uns leider nicht gelungen, weil sie auch die Unterstützung von ihrem eigenen Regierungschef – also das war damals von dem Präsidenten Chirac – hatte. Ich kann mich sehr gut erinnern, auf dem Petersberger Gipfel – das war unter deutscher Präsidentschaft –, da kam Chirac zu mir und hatte gesagt, wenn Édith demissionieren wollte, dann würde ich es ihr verbieten, zu demissionieren. Da war ich ja vorgewarnt, und ich war auch bei Jospin – damals war er der Premierminister in Frankreich –, habe ich ihm die Sache klargelegt, dass das eine schwierige Operation würde, und dann hat er gesagt, ja, ich verstehe Sie sehr wohl, ich kann auch Ihre Argumente verstehen, aber Sie müssen ja verstehen, Édith Cresson war Premierminister in diesem Hause, in Matignon – so, dass sie sich gestärkt fühlte. Und der Präsident der Kommission damals hatte keine Möglichkeit, einen Kommissar abzusetzen. Deshalb musste die ganze Kommission gehen. Es war aber nicht dramatisch aus eine ganz einfachen Grunde: Es kam zum Ende unserer Amtszeit, und wir hatten unser Programm praktisch zum größten Teil erledigt, und es war im März, wie Sie gesagt haben, und die Kommission war ja noch im Amt bis zum September. Ich ging ja in die Europawahlen damals im Juli und war noch fünf Jahre im Europaparlament, aber ich habe deshalb auch immer darauf hingewirkt – ich war damals ja auch im Konvent gewesen und so weiter –, habe ich darauf hingewirkt, dass der Kommissionspräsident gegenüber den Kommissaren gestärkt werden müsse und, dass er die Möglichkeit hatte, auch einen Kommissar abzusetzen oder die Kommission auch umzuordnen, wenn es ihm gefällt, und das ist ja über den Lissabon-Vertrag ermöglicht worden, und Barroso hat zum Beispiel davon profitiert.
„Die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland, das ist der Ursprung überhaupt des europäischen Gedankens. Das ist der Kitt, das ist der Pfeiler.“
Von Krisen und neuen Aufgaben
Detjen: Der Präsident der EU-Kommission ist heute wieder ein Luxemburger, Jean-Claude Juncker, und der muss mit den anderen Vertretern der Institution, mit den Mitgliedern des Rates Europa jetzt in einer, tja, schweren, in der tiefsten, bedrohlichsten Krise Europas führen. Wie sehen Sie Europa, wie sehen Sie die Institutionen dafür gerüstet heute?
Santer: Zuerst möchte ich mal sagen, wir hatten ja … Ich habe vorhin angedeutet, dass wir schon seit 54 eine tief greifende Krise hatten, wir hatten 1966 verschiedene Krisen durchzuleben und so weiter, und jedes Mal sind die Institutionen stärker aus diesen Krisen hervorgegangen. Heutzutage ist es etwas anderes. Wir haben eine Akkumulation von vielen Krisen, wovon keine einzige der Krisen noch gelöst würde. Ich spreche von der Wirtschaftskrise 2007/8 und so weiter, die Währungskrise, die auch noch im Brodeln ist, dann haben wir natürlich die Flüchtlingskrise, mit all den Problemen, die es aufwirft, auch mit dem Terrorismus, und dann kommt auch noch Brexit hinzu. Wenn man das alles zusammennimmt …
Detjen: Vielleicht muss man dann noch ergänzen, es kommt noch eine Vertrauenskrise hinzu.
Santer: Eben.
Detjen: Eine Vertrauenskrise zwischen Europa und den Bürgern Europas.
Santer: Voila. Und das muss man zusammenfügen, und der Brexit ist ja auch der Ausdruck dieser Vertrauenskrise. Ist ja nicht nur ein britisches Problem, möchte ich mal sagen. Schon ein britisches Problem, aber das macht mir am wenigsten Sorgen. Also der Brexit … nicht Sorge für die Europäische Union, aber Sorgen auch für Großbritannien, wie sie aus dieser Situation sich hinausmanövrieren. Wenn man liest, was in Schottland vor sich geht, was in Nordirland vor sich geht und so weiter, ist das schon eine schwierige Situation, aber immerhin …
Detjen: Ich habe – wenn ich das fragen darf an der Stelle – …, wodurch hat Europa das Vertrauen von so vielen Menschen verloren, die, wenn man auf die einzelnen Lebenssituationen schaut, eigentlich alle von Europa profitiert haben in ihrem Leben?
Santer: Das ist eben das Problem, weil eben … Da gibt es viele Ursachen. Wahrscheinlich eine ist, dass viele Brüssel immer sehen als den Missetäter aller möglichen … und selbstverständlich, wenn die Leute das hören, dann glauben sie auch, dass alles Schlechte von Brüssel kommt und alles Gute nur von den nationalen Regierungen. Das ist nun nicht so, denn in Brüssel werden Entscheidungen getroffen, die von den Ministern der Nationalregierungen begutachtet und getragen werden und auch vom Europäischen Parlament selbstverständlich. Und deshalb ist es auch eine Krise der Kommunikation, von dem, was [unverständlich] Selbstverständlich hat Brüssel vielleicht gesündigt dadurch, dass es zu viel in Anspruch genommen hat. Ich hatte mal einen Ausspruch gemacht, less but better, und ich glaube, man sollte sich nicht in allen Bereichen der Europäischen Union …
„Europa konnte sich nie durchsetzen, weil es kein Akteur auf der internationalen Bühne war.“
Detjen: Sagen Sie ein Beispiel, wo gilt less, wo könnte Europa weniger eingreifen, weniger tun, und wo müsste es vielleicht auch wieder mehr Kompetenzen bekommen?
Santer: Auf verschiedenen Problemen, die … Zum Beispiel auf die großen Probleme müsste …, die allein ein Land nicht lösen kann, zum Beispiel in der Umweltproblematik. Die Umweltproblematik bleibt ja nicht an den Grenzen eines Landes hängen und so weiter. Da muss schon Europa insgesamt mit seinen 500 Millionen Einwohnern gefördert werden, um das zu bewerkstelligen. Es gibt dann auch die Problematik, dass Europa nicht die politischen Konsequenzen gezogen hat aus dem großen Binnenmarkt. Der große Binnenmarkt ist nun die stärkste Wirtschaftskraft der Welt zurzeit. Europa ist zum Beispiel auch der größte Geldgeber für Drittstaaten, zum Beispiel auch für Afrika und so weiter, aber es hat nicht fertiggebracht, dass es politisch emanzipiert ist, dass es also keine – und das ist immer ein Vorwurf, den ich mir persönlich auch immer mache –, dass man nicht verstanden hat, dass Europa auch ein Akteur auf der internationalen Szene wird. Das ist ein wirklich fundamentales Problem. Wenn ich sehe, was im Nahen Osten geschieht oder welche Probleme wir aufgedrängt bekomme und so weiter, da werden Verhandlungen geführt hier und da zwischen Russland und Amerika und so weiter, und Europa ist nicht präsent. Zum Beispiel in der ganzen Palästina-Krise haben wir ja damals zu meiner Zeit noch sehr viel dazu beigetragen, dass es zu dieser Zweistaatenlösung kommen sollte, so wie die Osloer Verträge es vorgesehen haben. Wir haben aber … Um eine Zweistaatenlösung herbeizuführen, muss man auch dem einen Staat, hauptsächlich Palästina, die wirtschaftliche Möglichkeit geben, dass das auch ein Staat wird. Wir haben deshalb einen Flughafen hingebaut, wir haben einen Hafen hingebaut und so weiter mit unseren Geldern – ausschließlich mit europäischen Geldern. Und das alles ist wieder im Nachhinein zerstört worden, aber Europa hatte nie den … konnte sich nie durchsetzen, weil es kein Akteur auf der internationalen Bühne war, und deshalb bin ich auch heute noch felsenfest davon überzeugt, dass Europa nicht nur eine gesamte europäische Außenpolitik betreiben muss, aber auch eine Sicherheitspolitik, bis hin, wie es im Maastrichter Vertrag steht, zur Verteidigungspolitik, was bis jetzt aber noch nicht eingetreten ist.
Detjen: Jetzt gibt es Ansätze – und das gibt es nach vielen schlechten –, eine gute Nachricht, die den Europäern Hoffnung macht, nämlich der Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich, und Sie in Luxemburg beobachten es noch mehr aus der nachbarschaftlichen Nähe als wir in Deutschland. Welche Hoffnungen haben Sie da? Kann der Mann überhaupt diese Erwartungen, die jetzt in ihn gesetzt werden, erfüllen? Droht er da nicht, überfrachtet zu werden mit Erwartungen, und was kann Europa tun, um ihn zu unterstützen?
Santer: So wie ich das jetzt verfolgt habe, wie Sie auch, ganz sicher, hat Macron einen neuen Stil eingebracht in die europäische Politik und besonders in Frankreich, selbstverständlich, und ich hoffe nur, dass er durchhält und dass er auch sein Ziel, was er will, Frankreich stark in Europa zu machen – und da hoffe ich, dass er eine gute Zusammenarbeit, was ja scheint zu sein, mit Deutschland hat – denn ich bin immer der Meinung, die Grundpfeiler der Zusammenarbeit, auch in den europäischen Institutionen, wenn auch viele das nicht mehr so wahrhaben wollen, ist noch immer die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland. Das ist der Ursprung überhaupt des europäischen Gedankens, Vereinigungsgedankens, und das ist der Kitt, das ist der Pfeiler dieser (unverständlich) Ich hatte öfters zu kämpfen gehabt gegen Vorwürfe, die auch von britischer Seite zum Beispiel von Margaret Thatcher kamen und so weiter, wenn ein Vorschlag von Mitterrand oder von Kohl, die zusammengemacht haben, auf den Tisch kam, ich habe immer gesagt, passen Sie mal auf, so lange dieser Vorschlag kommt, und der wird in der Gemeinschaft diskutiert, dann sehe ich keinen Grund, weshalb die Europäische Union sich nicht dazu entscheiden sollte. Das Problem ist nur, wenn Sie beide einzeln, intergouvernementale Dezision haben – das war zum Beispiel der Fall, als es zum Stabilitätspakt kommen sollte für die Währungsunion –, da habe ich sehr stark eingewirkt, dass es zu einer Gemeinschaftspolitik kommen soll, und so hoffe ich jedenfalls, dass auch jetzt Frankreich – was ja auch verschiedene Probleme auch mit der Währungsunion und auch mit seinen eigenen Finanzvorausschauen … Ziffern hat – verschiedene Probleme bewältigen kann und damit Europa auch stärken kann in Zusammenarbeit mit Deutschland, und ich glaube, Macron hat das Zeug dafür. Er hat sich bekannt zu diesem europäischen Gedanken – das hat er ja öfters gesagt, auch in all seinen Reden hat er sich dazu geäußert, die ich verfolgt habe jedenfalls –, und auch sein Besuch zur Bundeskanzlerin hat dies ja auch zum Ausdruck gebracht, und ich hoffe nur, dass es ihm gelingen wird.
Detjen: Jacques Santer, vielen Dank!
Santer: Bitte sehr!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.