
Das Landgericht Moabit in Berlin Ende vergangener Woche. Fünf wegen Steuerhinterziehung Angeklagten wird der Prozess gemacht – mit eineinhalb Metern Sicherheitsabstand. Die Verhandlung, zu der 26 Personen gekommen sind, findet in einem größeren Sitzungssaal als üblich statt. Und: Anstatt wie normalerweise den ganzen Tag, wird nun nur eine Stunde verhandelt, erzählt Strafverteidigerin Ria Halbritter am Telefon. Es ist ihre einzige Verhandlung in dieser Woche.
"Also normalerweise verhandele ich nahezu täglich bundesweit, hauptsächlich in Berlin, Brandenburg und in längeren großen Prozessen, die dann auch grundsätzlich zweimal in der Woche stattfinden. Und im Moment, also in dieser Woche, habe ich bislang nur eine Hauptverhandlung. Alle anderen sind aufgehoben und verschoben."
Loveparade-Prozess könnte eingestellt werden
Die Auswirkungen des Coronavirus haben die Gerichte erreicht. Der Love-Parade-Prozess könnte ohne Urteil zu Ende gehen. Das Landgericht Duisburg schlug heute vor, das Verfahren wegen der Coronakrise einzustellen. Die Verfahrensbeteiligten sollen bis zum 20. April dazu Stellung beziehen.
Im Falle einer Einstellung des Verfahrens blieben die wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung Angeklagten straflos. Für die Angehörigen der 21 Toten und die hunderten Verletzten wäre das eine weitere Katastrophe. Ein aufsehenerregender Prozess in Erfurt, in dem zwei Polizisten beschuldigt werden, im Dienst eine Frau vergewaltigt zu haben: vertagt. Und das sind nur die prominenten Fälle. Die Berliner Rechtsanwältin Halbritter:
"Die Strafjustiz ist aus meiner Einschätzung und Erfahrungen der letzten zehn Tagen so gut wie zum Stillstand gekommen. Das fängt an mit einer eingeschränkten Polizeiarbeit, möglicherweise auch mit tatsächlich weniger Kriminalität, jetzt zum Stichwort Grenzschließungen und so weiter und Ausgangsbeschränkungen. Es wird aus unserer Sicht und Erfahrungen deutlich weniger verfolgt. Es kommen deutlich weniger Verfahren an und die Polizei überlegt sich dreimal, ob sie gegenüber der Staatsanwaltschaft anregt, jemanden zu inhaftieren, also in Untersuchungshaft zu nehmen."
Delikte ändern sich: weniger Diebstähle, mehr häusliche Gewalt
Die Justiz hat auf Notbetrieb umgeschaltet. Wie arbeiten Polizei und Gerichte im Krisenmodus? Und was passiert in den Gefängnissen? Thilo Cablitz arbeitet dort, wo die Fälle, die am Ende vor Gericht landen, zuallererst mit dem Staat in Berührung kommen. Bei der Polizei. Der Leiter der Pressestelle der Berliner Polizei sagt: Tatsächlich sei die Kriminalität in der Hauptstadt im März dieses Jahres gesunken. Ein Trend, der nicht nur in Berlin zu beobachten ist. In Schleswig-Holstein hat sich die Kriminalität ersten, vorsichtigen Schätzungen der Polizei zufolge halbiert. NRW verzeichnet gut ein Drittel weniger Wohnungseinbrüche und Taschendiebstähle als im Vorjahreszeitraum. Weniger Handtaschen auf den Straßen bedeuteten zwangsläufig auch weniger Taschendiebstähle, erklärt Cablitz. Stattdessen sind die Fälle häuslicher Gewalt in Berlin um zehn Prozent gestiegen. Insgesamt sei die Polizei weiterhin genau so viel im Einsatz wie vor der Coronakrise. Allerdings häufig in anderer Sache als üblich:
"Natürlich haben wir auch Kolleginnen und Kollegen im Einsatz, die sich darum kümmern, dass die Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus eingehalten wird. Das sind Kräfte, die wir zusätzlich planen, die wir aber auch zusätzlich zur Verfügung haben, weil wir eine Vielzahl an Versammlungen nicht betreuen müssen und eine Vielzahl an anderen Maßnahmen, die jetzt im Prinzip wegfallen."
Weil große Menschenmengen verboten sind, begleitet die Polizei kaum noch Versammlungen. Stattdessen überwachen nun immer mehr Beamtinnen und Beamte den Sicherheitsabstand der Berliner Spaziergänger. Waren zu Anfang der Coronakrise dazu noch 100 Polizeikräfte im Einsatz, kontrollierten am vergangenen Wochenende 500 die Straßen in Berlin. Das Ergebnis: Knapp 2000 Kontrollen und 234 verhängte Bußgelder.
So voll die Straßen mit Polizistinnen und Polizisten derzeit sind, so leer sind die meisten Gerichte. Am Landgericht in Bonn ist Pressesprecher Tobias Gülich in diesen Tagen einer der letzten Richter auf den Fluren.
"90 Prozent oder 95 Prozent der Richter des Landgerichts sind zu Hause, arbeiten da an Akten, die sie haben mitnehmen können, bevor sie dann nach Hause geschickt wurden oder kümmern sich um ihre Kinder, ihre Verwandten. Und wir halten hier mit ein paar Kollegen den Notbetrieb aufrecht."
Die meisten Strafprozesse müssen eigentlich öffentlich sein
Noch vor zwei Wochen war hier vor allem ein Sitzungssaal prall gefüllt – nämlich als das Landgericht Bonn im bundesweit ersten CumEx-Prozess über illegale Steuerrückerstattungen verhandelte. Für die Gerichte hieß die Umstellung auf den Notbetrieb zuallererst, schon laufende Hauptverhandlungen wenn möglich schnell abzuschließen. Im CumEx-Prozess sprach das Landgericht Bonn deshalb sein Urteil früher als geplant. Tobias Gülich sagt:
"Weil man zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wissen konnte: Wie geht es überhaupt weiter mit dem Hauptverhandlungstermin? Kann ich den überhaupt noch durchführen? Wir hatten ja einen riesiges Zuschauerinteresse an dem Verfahren, Medienöffentlichkeit, aber auch normale Öffentlichkeit. Bis zu 130 Sitzplätze im Saal, die zum Teil auch voll besetzt waren. Kaum noch denkbar, dass heute 130 Leute in einem Saal zusammensitzen. Das war sehr, sehr schwierig."
Denn wie die meisten Strafprozesse musste auch der CumEx-Prozess öffentlich sein. Wird dieser Grundsatz verletzt, ist das ein Revisionsgrund. In Zeiten der Coronakrise aber kann ein öffentlicher Prozess zum Gesundheitsrisiko werden. Ein weiteres Problem: Die Hauptverhandlung durfte laut der Strafprozessordnung zum damaligen Zeitpunkt nur für einen Monat unterbrochen werden. Was der Richter nicht absehen konnte: Hätten die Angeklagten – beide britische Staatsangehörige – zu den Folgeterminen überhaupt noch einreisen dürfen? Was, wenn sich wichtige Prozessbeteiligte dann in Quarantäne befunden hätten? Die Gefahr war groß, dass das Verfahren hätte platzen können. Tobias Gülich vom Landgericht Bonn:
"Ein Platzen des Verfahrens führt dazu, dass die gesamte Beweisaufnahme zu wiederholen ist, weil man eben von vorne anfangen muss. Und dass man über 40 Verhandlungstage, die sehr intensiv waren, die wirklich von morgens bis abends Beweisaufnahme, Urkunden verlesen, Zeugenbefragungen beinhalten. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet hätte, das Ganze wieder von vorne durchführen zu müssen."
Hauptverfahren dürfen nun drei Monate unterbrochen werden
Also trennte der Vorsitzende Richter einen Teil des Verfahrens kurzerhand ab und beendete die Beweisaufnahme innerhalb von einem Tag. Martin S. und Nicholas D. sind jetzt die ersten in Deutschland verurteilten Straftäter wegen CumEx-Geschäften. Inzwischen hat die Bundesregierung für solche Fälle Abhilfe geschaffen: Wegen der Coronakrise dürfen Hauptverhandlungen nun nach einem eilig verabschiedeten Gesetz drei Monate lang unterbrochen werden. Diese Sonderregelung gilt für ein Jahr. So wie am Landgericht Bonn versuchen derzeit viele Gerichte aber, überhaupt so wenig wie möglich zu verhandeln.
"Und zurzeit finden in Zivilverfahren gar keine Hauptverhandlung statt. Und in Strafsachen ist es so, heute findet zum Beispiel eine Verhandlung statt in einer eiligen Führerscheinsache. Das macht vielleicht die Dimension klar", sagt Tobias Gülich.
Auch in Magdeburg zeichnet sich ein ähnliches Bild. Stefan Caspari ist Richter am dortigen Landgericht. Hier, so erzählt er, fänden aktuell in etwa halb so viele Verhandlungen statt wie normalerweise. Beunruhigend findet er das allerdings nicht: "Der Umstand, dass bestimmte Verhandlungen jetzt nicht stattfinden, führt ja nicht dazu, dass der Richter nicht mehr arbeitet. Die Gerichte arbeiten natürlich weiter, sei es im Büro, oder sei es Zuhause."
"Die Justiz funktioniert weiter"
Denn gerade im Zivilrecht führen die Richter viele Fälle nun vom Schreibtisch aus – im sogenannten schriftlichen Verfahren. Insgesamt aber lässt sich festhalten: Während Zivilrichter vieles von Zuhause erledigen können, trifft der Notbetrieb das Strafrecht härter. Nimmt die Polizei über Nacht einen Betrunkenen in Gewahrsam, muss ein Richter zur Stelle sein: schnell und persönlich vor Ort. Ebenso, wenn Ärzte Patienten in der Psychiatrie fixieren oder ein Bettgitter im Pflegeheim die Alten vorm Herausfallen bewahren soll.
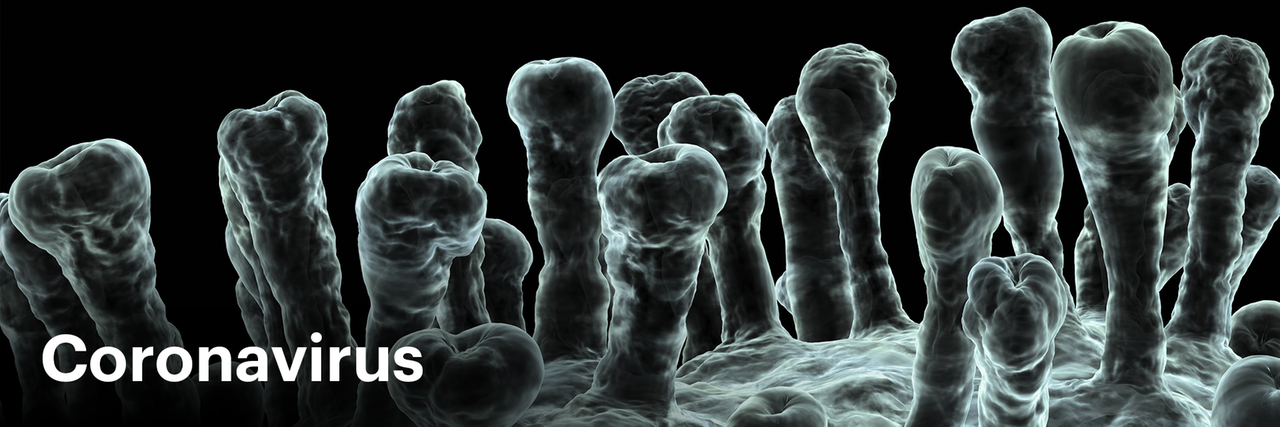
"Es gibt natürlich einige Verfahren, gerade Eilsachen, da gibt es überhaupt keine Pause. Also: Die Justiz funktioniert weiter. Da kann sich jeder darauf verlassen, dass in den wirklich wichtigen Sachen auch nach wie vor die Justiz in der Lage ist, die Entscheidungen zu fällen", sagt Caspari.
Andererseits droht der Richter in Zeiten der Coronakrise selbst zur Gefahr zu werden, weil er das Virus in sensible Einrichtungen wie Pflegeheime oder Psychiatrien tragen könnte. Pauschale Lösungen für dieses Dilemma gibt es nicht, erklärt Richter Tobias Gülich: "Da ist natürlich jeder einzelne Richter gehalten abzuwägen: Was ist jetzt notwendig? Wie schütze ich mich selbst? Und wie schütze ich diejenigen, die ich anhören muss? Aber wie das im Einzelfall ist, welche Anhörung durchgeführt werden muss und welche nicht, das muss jeder Richter an seiner Unabhängigkeit selbst klären."
Lange Untersuchungshaft
Nicht nur richterliche Anhörungen müssen im Strafrecht schnell gehen. Auch der Freiheitsentzug durch die Untersuchungshaft darf nur solange aufrechterhalten werden, wie nötig. Strafverteidigerin Ria Halbritter merkt die Verlangsamung der Prozesse hier schon jetzt. Ihre wegen Steuerhinterziehung angeklagten Mandanten sitzen schon seit März 2019 in Untersuchungshaft.
"Der Prozess war ohnehin schon vor Corona bis September terminiert. Und dann bedeutet das Ergebnis, das die Betroffenen ohne Probleme zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft sein werden, bevor klar ist, zu welcher Strafe sie gegebenenfalls verurteilt werden", sagt Halbritter. Und das sei ein Problem: Schließlich könne jeder Prozess wider Erwarten mit einer Bewährungsstrafe oder einem Freispruch enden. Die Haft, ohnehin äußerstes Mittel im Strafrecht, wäre dann rechtswidrig gewesen. Auch deshalb müssen Strafverfahren so schnell wie möglich geführt werden.
Währenddessen haben sich die Haftbedingungen in der Corona-Krise verschärft. Die Untersuchungshaftanstalten wie alle anderen Gefängnisse schotten sich seit mehreren Wochen soweit wie möglich ab. Ausgänge wurden gestrichen, die Besuchsmöglichkeiten eingeschränkt, Gottesdienste und Freizeitangebote hinter Gittern abgesagt. Auch Gefangene im offenen Vollzug, die die Anstalt bislang tagsüber verlassen durften, werden nun in manchen Bundesländern wieder komplett eingesperrt.
Zu den Maßnahmen gegen eine Corona-Ausbreitung im Gefängnis gehört laut Weltgesundheitsorganisation WHO auch die Information der Gefangenen. Doch viele Inhaftierte hätten sich in den Tagen nach dem Ausbruch der Pandemie schutzlos und kaum informiert gefühlt, berichtet ein Gefangener dem Deutschlandfunk per Sprachnachricht aus dem Gefängnis: "Die Gefangenen sind den Beamten vollkommen ausgeliefert. Denn nur die Beamten können Corona in die Justizvollzugsanstalt einschleppen. Und davor ist die Angst natürlich riesengroß."
Besonders hohes Risiko für Gefangene
Viele Gefangene verbringen gerade und in nächster Zeit rund 23 Stunden am Tag auf ihrer Zelle. Das wirke sich natürlich auch auf die Stimmung auf den Stationen aus, sagt Kirstin Drenkhahn. Sie ist Professorin für Kriminologie und Strafrecht an der Freien Universität Berlin. "Also für die Gefangenen ist das eine total schwierige Situation, weil eben viele Gefangene sowieso das Gefühl haben, dass ja der Vollzug ihnen sozusagen immer einen reindrücken will. Und in so einer Situation kommen natürlich diese weiteren Einschränkungen überhaupt nicht gut an."
Ganz abschotten lassen sich die Gefängnisse nicht. Drei Wochen, nachdem die Weltgesundheitsorganisation den Pandemiefall erklärt hat, sind Inhaftierte der Anstalten Glasmoor und Fuhlsbüttel in Hamburg und Euskirchen in Nordrhein-Westfalen infiziert. Die Betroffenen seien isoliert, heißt es. Die Anstalten hätten umfangreiche Maßnahmen ergriffen, heißt es aus der Hamburger Justizbehörde. In der JVA Glasmoor in Hamburg, in der der erste Infektionsfall in einer deutschen Anstalt bestätigt wurde, stünden ausreichend Hygienemittel zur Verfügung. Die Duschen und Telefone auf dem Gang würden mehrmals täglich gereinigt. Auf dem Boden seien wie an den Supermarktkassen Abstandsmarkierungen angebracht.
Das Coronavirus stelle für Gefangene jedoch ein besonders hohes Risiko dar, sagt der Gefängnisarzt Karlheinz Keppler: "Das erste Risiko, was sich natürlich realisiert, ist die Unterbringung von mehreren Personen auf dichtem Raum. Das ist der grundsätzliche Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir in den Gefängnissen natürlich einen hohen Anteil von Sucht betroffenen Gefangenen haben, Drogen konsumierenden Gefangenen oder auch Alkohol konsumierenden Gefangenen mit den jeweils typischen Begleiterkrankungen. Im Gefängnis raucht auch im Grunde jeder, sodass chronische Bronchitis und die sogenannte COPD Chronisch Obstruktive Lungenerkrankung im Gefängnis ein relativ häufiges Geschehen ist."
Pandemiepläne für jede einzelne Anstalt
Der Gefängnisalltag lässt sich nicht komplett herunterfahren. Keppler verdeutlicht dies am Beispiel von substituierten Inhaftierten, die also von einem Opiat wie Heroin abhängig waren und stattdessen einen Ersatzstoff wie Methadon bekommen. In der JVA Bielefeld-Brackwede betreffe dies rund 90 Gefangene, sagt er. Sie würden normalerweise jeden Tag aus verschiedenen Häusern über das Anstaltsgelände zur Krankenabteilung geführt, um sie dort mit dem entsprechenden Ersatzstoff zu versorgen. Das sei schlicht zu viel Bewegung unter den Gefangenen, sagt Keppler: "Sie haben eine räumliche, körperliche Nähe der Gefangenen, weil die benutzen natürlich auch so ein gemeinsames Warten im Wartezimmer, um irgendwelche Geschäfte abzusprechen oder so. Das machen sie nicht mit zwei Meter Abstand, sondern das flüstern die sich ins Ohr. Also diese ganzen Dinge. Also dieser tägliche Weg in die Substitutionsstelle. Das ist natürlich ein sehr infektionsträchtiges Geschehen bei Patienten, die zudem auch noch hochgradig gefährdet sind."
Um solche Situationen auf ein Minimum zu reduzieren, könnte man den Gefangenen einmal die Woche den Ersatzstoff als sogenannte "Take Home"-Abgabe mit auf die Zelle geben. Das würde die Isolation zusätzlich verschärfen, könnte aber immerhin das Ansteckungsrisiko verringern.
In den meisten Bundesländern gibt es Pandemiepläne für jede einzelne Anstalt. Maßgeblich sind dafür die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation. Darin werde zum Beispiel geregelt, wer in der Anstalt für was zuständig ist, wie Schutzausrüstung angeschafft und verwendet wird und wie sich die Anstalt im Pandemiefall versorgt, schreibt das Bayerische Justizministerium auf Anfrage.
Der Pandemieplan für die hessischen Justizvollzugsanstalten aus dem Jahr 2007 ist hingegen öffentlich und wird an manchen Stellen ganz konkret. Darin heißt es zum Beispiel, die Gefängnisse sollten sich Vorräte anlegen. Zitat: "Insbesondere sind zu bevorraten: Tee, Suppen, Konserven, Zwieback und haltbare Brotsorten."
Hohe Belastungen nach der Coronakrise
Doch wem die Haft mit ihrem erhöhten Ansteckungsrisiko erspart bleibt, das unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. In Bremen wurden bereits vor drei Wochen 26 Gefangene entlassen, weil sie zur Risikogruppe zählten. Sie waren 50 Jahre alt oder haben eine Vorerkrankung. In Berlin heißt es auf Anfrage, es gebe keine Pläne chronisch erkrankte Inhaftierte prophylaktisch zu entlassen. Wer zwar verurteilt wurde, aber seine Haft nicht antreten muss, ist ebenfalls sehr unterschiedlich geregelt. In manchen Bundesländern werde der Haftantritt verschoben für Verurteilte mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten, sagt Kriminologieprofessorin Kirstin Drenkhahn. In anderen Bundesländern sind es bis zu drei Jahre, wenn der oder die Betroffene nicht in Untersuchungshaft sitze: "Und das ist natürlich eine ganz große Spannbreite, die also in der Quintessenz mir sagt, dass auch die Justizministerien meinen, dass diese Verfolgung von Strafvollstreckung im Moment nicht verhältnismäßig ist. Aber dass diese Frage, wie man Verhältnismäßigkeit hier definiert, ganz unterschiedlich gesehen wird. Also ich halte das schon für ein Gerechtigkeitsproblem, wenn es da solche Unterschiede gibt zwischen den Bundesländern."
Die gesundheitliche Bedrohung durch das Coronavirus ist für die Gefangenen groß – genauso wie die Einschnitte in die ohnehin beschränkten Grundrechte. Wie weit sich die Gefängnisse anpassen, um dem Anspruch der Gefangenen auf eine Behandlung hinter Gittern anstelle eines bloßen Wegsperrens nachzukommen, bleibt abzuwarten.
Gut möglich ist, dass die Gefängnisse in den kommenden Monaten insgesamt etwas leerer sein werden als üblich: Denn je weniger an den Gerichten verhandelt wird, desto weniger Straftäter dürften in Haft kommen. Die zweite große Belastungsprobe für die Justiz, ist sich Strafverteidigerin Ria Halbritter sicher, wird nach der Coronakrise folgen: "Wenn sich die Gesellschaft wieder normalisiert, weil die Ausgehbeschränkungen gelockert worden sind, wird sich die Strafjustiz noch lange nicht normalisiert haben. Selbst wenn Richter und Staatsanwälte doppelt so viel arbeiten wollen würden, wäre das ressourcenmäßig gar nicht möglich, weil es beispielsweise gar nicht genug Säle gibt und Richter deshalb gar nicht doppelt so viele Verhandlungen führen könnten."
Schließlich müssen all jene Fälle, die nun liegen bleiben oder in denen es nur langsam vorangeht, irgendwann abgearbeitet werden. Die Rückkehr zum Normalbetrieb dürfte also dauern.





