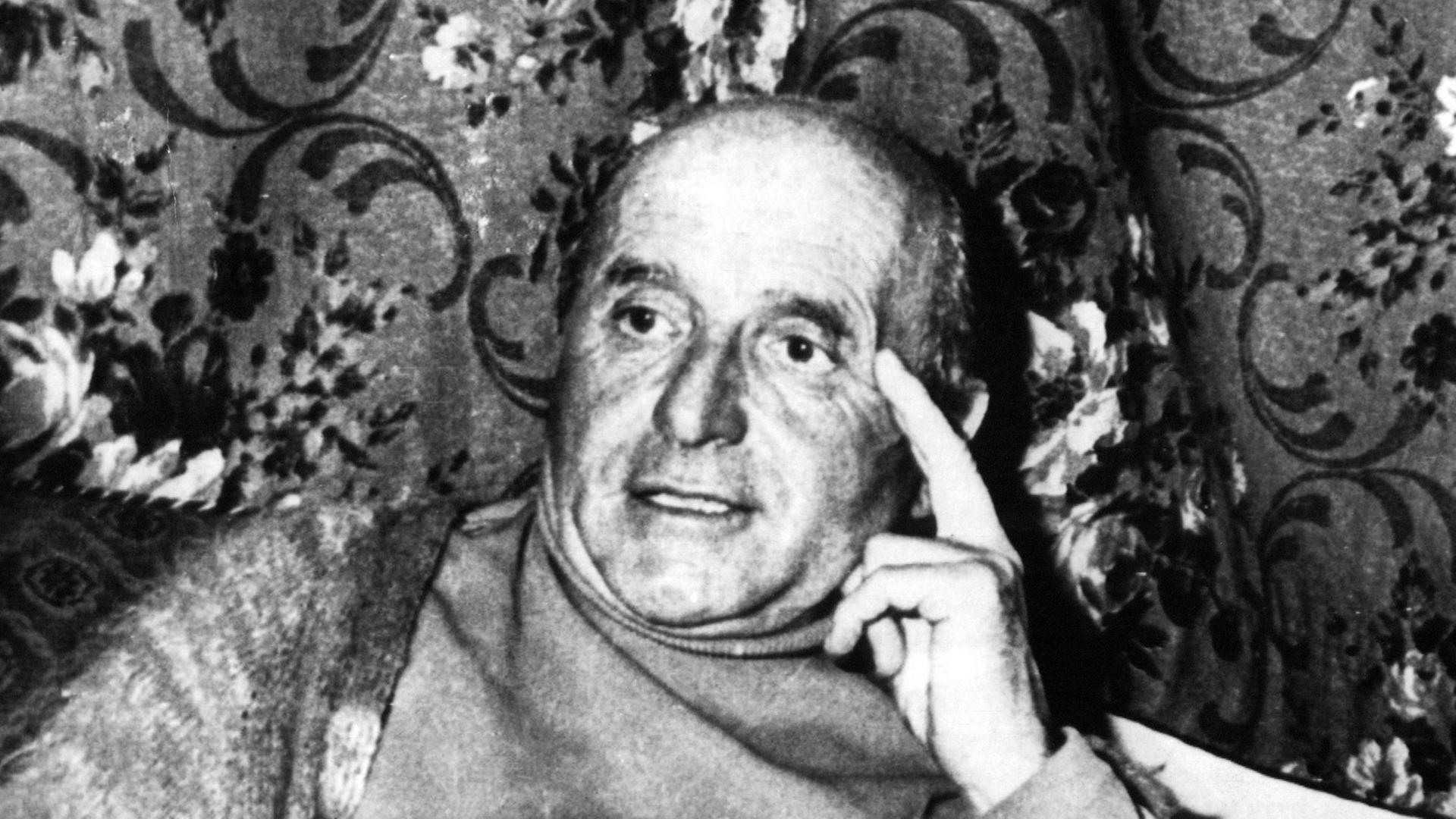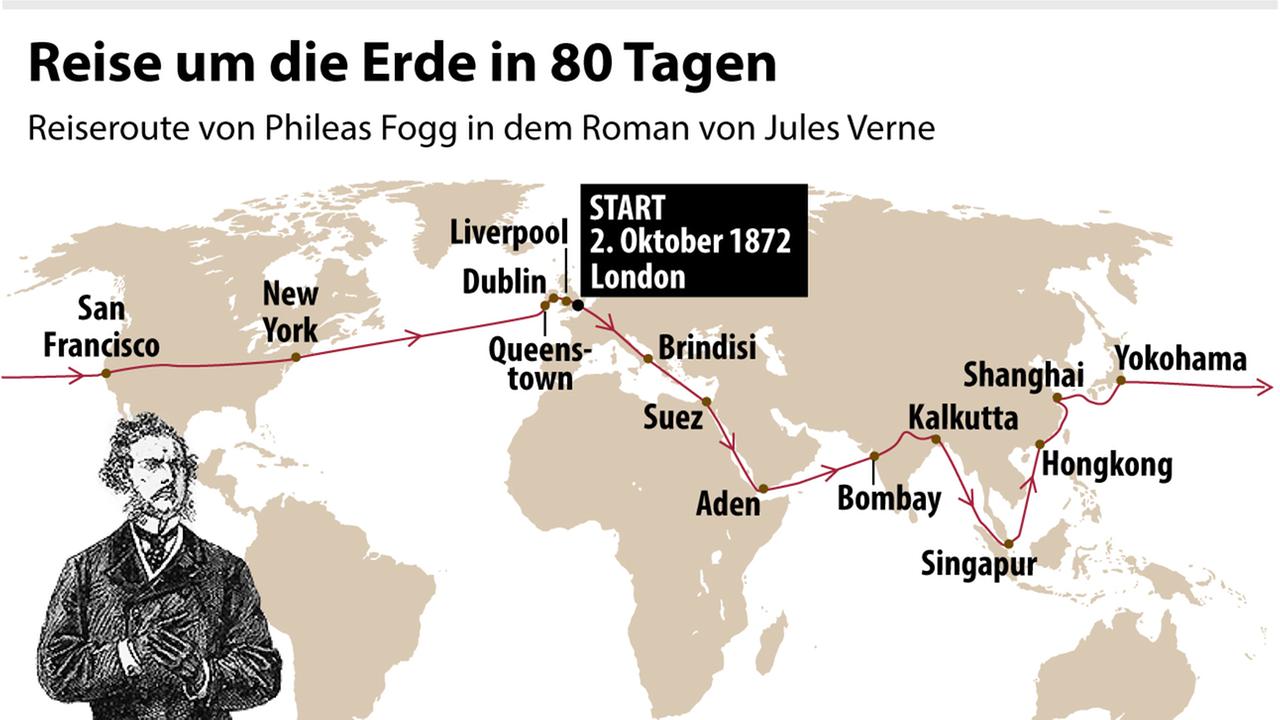Wenige Minuten nachdem das Feuer entdeckt wird, erreichen die ersten Anrufe die Notrufzentrale der pakistanischen Metropole Karatschi. Aus dem grauen Betonblock der Textilfabrik "Ali Enterprises" dringt schwarzer Rauch. Niemand weiß genau, wie viele Menschen an diesem Dienstagabend hier arbeiten.
Als die Feuerwehr am Brandort eintrifft, schlagen Flammen aus dem dreistöckigen Gebäude. Hunderte von Menschen sitzen in der Falle. Die meisten Notausgänge sind verschlossen, viele Fenster vergittert. Muhammad Azeem, Mitarbeiter der Notrufzentrale von Karatschi, erinnert sich noch Jahre später an den Tag der Katastrophe, den 11. September 2012 - und an die verzweifelte Lage der Eingeschlossenen.
„Sie konnten nicht in die Fabrik hinein, und viele Arbeiter nicht heraus. Es gab nur einen offenen Notausgang. Und die Fenster waren vergittert. Um zwei oder drei Uhr haben einige Arbeiter Fenster oder Teile der Lüftungsanlagen aus der Wand gebrochen und sind herausgesprungen.“
"Sah nach menschenunwürdigen Bedingungen aus"
Am Tag danach wird klar: Mehr als 100 Arbeiter konnten sich retten, aber weit über 200 Menschen sind tot, erstickt oder bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Selbst das Haupttor soll verschlossen gewesen sein. Der deutsche Pakistan-Korrespondent Hasnain Kazim trifft kurz nach dem Unglück ein. Niemand hindert ihn daran, die noch rauchende Ruine zu betreten.
„Man sah diese ganzen verkohlten Maschinen, ob die Notausgänge wirklich versperrt gewesen waren, das konnte ich jetzt nicht mehr überprüfen. Aber das sah alles schon so aus, als wäre da unter sehr menschenunwürdigen Bedingungen gearbeitet worden.“
Hunderte von Näherinnen und Nähern, sagt Kazim, hatten im Dunklen eingepfercht hinter vergitterten Fenstern gearbeitet.
„Man darf nicht vergessen: Karatschi ist eine Stadt, sehr, sehr heiß im Sommer, 45 Grad sind da überhaupt gar kein Problem, natürlich war das nicht klimatisiert.“
„Man darf nicht vergessen: Karatschi ist eine Stadt, sehr, sehr heiß im Sommer, 45 Grad sind da überhaupt gar kein Problem, natürlich war das nicht klimatisiert.“

Illegale Gebäude, gefälschte Betriebserlaubnisse
Es gibt zu diesem Zeitpunkt Hunderte von Fabriken in Pakistan, in denen Menschen so arbeiten – wie viele genau, ist unklar, da die Gebäude oft illegal errichtet sind und Betriebserlaubnisse gefälscht wurden. Die Textil-Lobby im Land ist mächtig, sie wehrt sich gegen strenge Vorschriften und Kontrollen. Für die Opfer und die Angehörigen der Ali Enterprises-Katastrophe – der schlimmste, aber bei weitem nicht der einzige große Industriebrand Pakistans - setzt sich bis heute der Wirtschaftsanwalt Faisal Siddiqi ein.
„Das Feuer hätte niemals so viele Menschen getötet. Es gibt diese grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen, die wir seit den 1930er Jahren kennen: Man verschließt die Türen nicht von außen. Man hat Feuermelder. Es gibt Brandschutzübungen. Wenn all dies da gewesen wäre, dann wären möglicherweise 30 oder 40 Leute umgekommen. Vielleicht auch 50 Leute. 255 Menschen wären nicht getötet worden.“
Mit seinen, wie sich später herausstellte, fast 260 Toten ar dieser Fabrikbrand der größte in der Geschichte Pakistans. „Ali Enterprises“ produzierte vor allem für den deutschen Bekleidungsdiscounter KiK - unter anderem eine Jeans, die in Deutschland für 14 Euro 99 angeboten wurde. Der Vorwurf an KiK: Die Firma hätte für Sicherheitsstandards in Karatschi Sorge tragen müssen. Sie sei mitschuldig am Tod der Opfer.
„Es bleibt erst mal festzuhalten, dass es sich um einen Brandanschlag gehandelt hat.“ Patrick Zahn, Geschäftsführer von KiK im Jahr 2016.
Täter aus der Schutzgeldmafia
Nachdem lange nach den Ursachen geforscht worden war, hatten die Behörden Täter aus der pakistanischen Schutzgeldmafia als Brandstifter identifiziert. 2020 wurden deshalb zwei Männer zum Tode verurteilt.
„Wenn Brandsätze oder Brandbeschleuniger an Notausgängen, an Treppen gelegt werden, kein Brandschutz dieser Welt kann helfen, dann so eine Katastrophe zu verhindern. Wir haben Millionen von Kunden, bei denen wir eine soziale Funktion erfüllen und die gerne bei uns einkaufen. Dann wundert mich manchmal, dass Gruppen mit drei-, vier-, fünfhundert Mitgliedern als Zivilgesellschaft gelten. Das ist schon eine Fragestellung, der man sich stellen muss: Ist wirklich das immer zwingend die Zivilgesellschaft …“
2016 beginnt in Deutschland ein Prozess gegen KiK: Klageführer sind deutsche Nichtregierungsorganisationen. Es geht um die Entschädigung der Opfer in Pakistan - und darum, dass hiesige Unternehmen in Zukunft Mitverantwortung für die Arbeitsbedingungen in den Ländern tragen, in denen sie produzieren lassen. Vor Gericht kam KiK mit einem blauen Auge davon: Weil auch nach pakistanischem Recht geurteilt wurde, erklärte das Oberlandesgericht Hamm die Schmerzensgeldansprüche der Brandopfer im Jahr 2019 für verjährt.
Der Vorwurf aber bleibt: Die Billigware auf deutschen Wühltischen kann von Menschen, die in so genannten Sweatshops in Pakistan, Bangladesch oder Sri Lanka schuften, unter tödlichen Arbeitsbedingungen hergestellt worden sein.