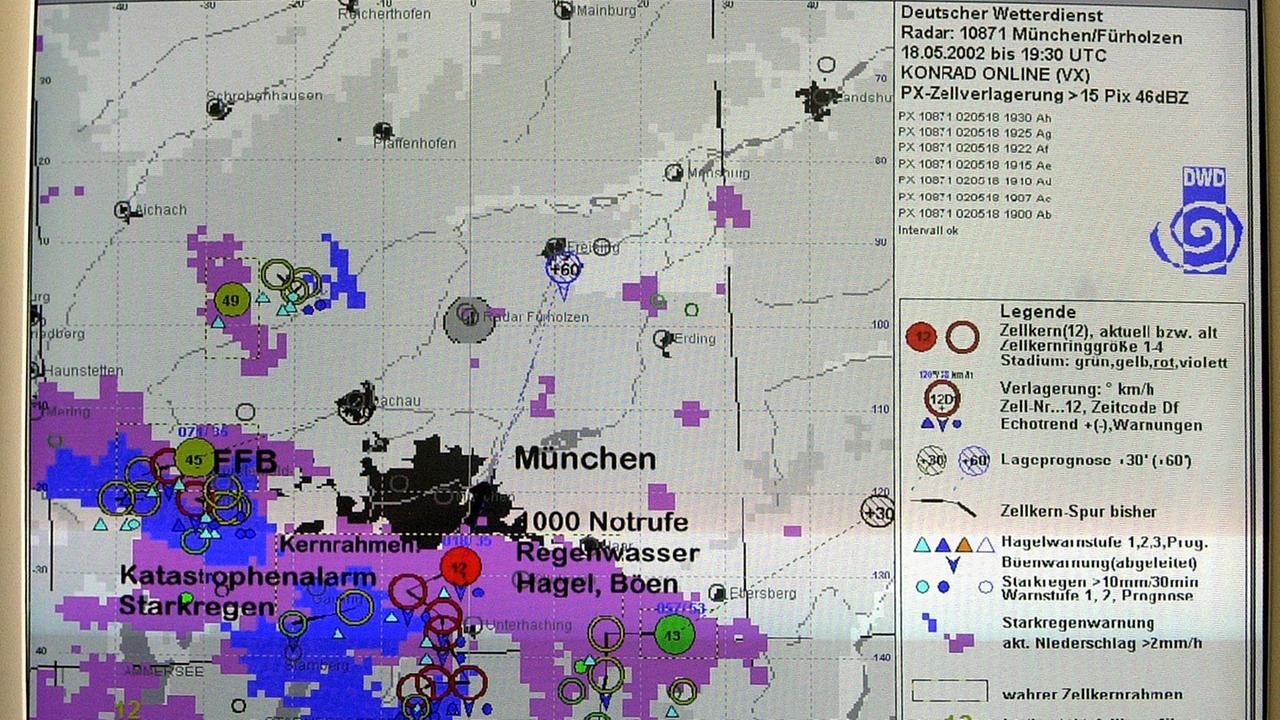Im Oktober 2012 braute sich südlich von Kuba ein riesiges Tiefdruckgebiet zusammen. Aus ihm wurde innerhalb weniger Tage einer der schwersten Stürme, die bislang verzeichnet worden sind: Sandy. Der Hurrikan traf in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober die Ostküste der USA und hinterließ eine Spur der Zerstörung. Um in solchen Fällen schnell Hilfe in die am stärksten betroffenen Gebiete zu schicken, setzt die US-Katastrophenschutzbehörde FEMA Modellrechnungen ein: In die fließen die Daten des Sturms ebenso ein wie die Infrastruktur und die Geografie. Hubschrauberüberflüge liefern zusätzliche Informationen. Das dauert, aber vielleicht könnte Twitter künftig Entscheidungen beschleunigen.
"Wir forschen schon eine Weile daran, wie sich Ereignisse der wirklichen Welt in Twitter widerspiegeln und verbreiten. Inzwischen arbeiten wir dabei mit Naturkatastrophen. Wir wollen wissen, ob wir durch die Tweets mehr darüber erfahren können. Dabei sind wir dann auf Hurrikan Sandy gestoßen, der massiv via Twitter begleitet worden ist",
erklärt Manuel Cebrian vom NICTA, einem australischen Forschungszentrum für Informations- und Kommunikationstechnik in Melbourne.
"Wir haben dafür zunächst alle Tweets heruntergeladen, die wir dank eines Geocodes genau verorten konnten. Um Muster zu erkennen, begann der beobachtete Zeitraum ein paar Wochen vor der Katastrophe und endete ein paar Wochen danach. Es waren rund zehn Millionen Tweets von mehr als zwei Millionen Benutzern. Außerdem haben wir die Schadensmeldungen bei Versicherungen und Hilfsfonds ausgewertet. So fanden wir tatsächlich statistische Korrelationen zwischen der Höhe des von Sandy angerichteten Schadens und der Twitteraktivität zur Zeit um die Katastrophe herum."
"…ohne große Kosten eine erste Abschätzung über die Schäden bekommen"
Die Daten mussten standardisiert werden, damit dicht bevölkerte Gebiete wie Manhattan mit Dörfern in New Jersey verglichen werden konnten. Das Ergebnis: Je näher die Nutzer der Sturmbahn von Sandy waren, desto mehr Tweets zum Thema sandten sie pro Kopf aus. In den Tagen danach twitterten sie umso mehr, je stärker ein Gebiet betroffen und je höher der Schaden war.
"Wir haben nach Sandy noch zwölf andere Naturkatastrophen in den USA untersucht, von Überflutungen und Erdbeben bis hin zu Erdrutschen. Und wir konnten in den statistischen Korrelationen ganz ähnliche Muster in der themenbezogenen Twitteraktivität pro Kopf und den Schäden ausmachen."
Allerdings nur, solange genügend getwittert wird. Zu einer Überschwemmung in Alaska fanden die Forscher nur 22 Tweets: Das Gebiet war wohl einfach zu dünn besiedelt für statistisch verwertbare Zusammenhänge. Bei Sandy jedoch erwiesen sich Lokalisierung und Schadensabschätzung sogar als noch etwas besser als bei den Modellrechnungen der Katastrophenschutzbehörde FEMA.
"Die Technik liefert die Daten im Grunde umsonst, denn die Leute schreiben ja unentgeltlich für Twitter. Man kann also ohne große Kosten eine erste Abschätzung über die Schäden in einer bestimmten Gemeinde bekommen. Die Verantwortlichen im Katastrophenschutz könnten künftig also vielleicht typische Twitter-Aktivitäten zur Entscheidungsfindung nutzen."
Wie weit das Konzept in der Realität trage, wo die Möglichkeiten und Grenzen lägen, müsse man nun zusammen mit den Ersthelfern untersuchen, urteilt Manuel Cebrian. Offen ist auch, ob sich die Verhaltensmuster von den USA auf andere Teile der Welt übertragen lassen. Für Europa oder Australien halten die Forscher das für wahrscheinlich, aber überprüft sei das noch nicht. Auch wie es für Asien beispielsweise aussehe, müsse sich erst noch erweisen.