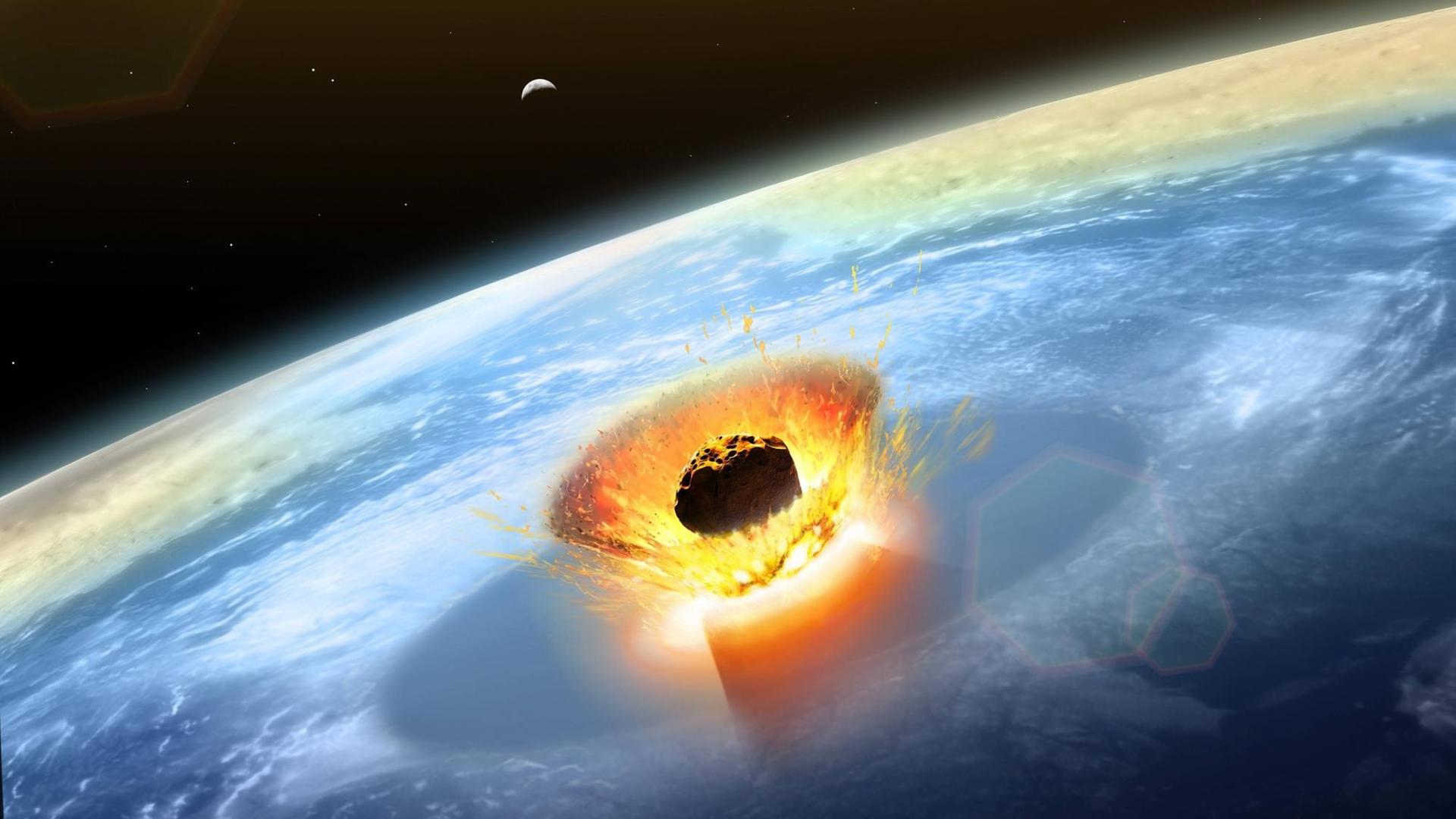"Erdbeben sind in Deutschland ja keine Gefahr, die sich im Alltag niederschlägt. Gott sei Dank muss man dazu sagen. Da dieses Risiko im Gegensatz zu Hochwasserlagen, zu Starkregen, zu Stürmen sehr selten vorkommt, ist natürlich die Bewusstseinslage auch nicht besonders ausgeprägt und zwar in allen gesellschaftlichen Schichten. Das betrifft die Bevölkerung genauso wie den öffentlichen Dienst, den Katastrophenschutz, die Unternehmen", erklärt Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn.
Deshalb sei das Erdbeben vom 13. April 1992 für die meisten Menschen vollkommen überraschend gekommen. Damals bebte nachts im grenznahen Roermond die Erde. Die Magnitude: 5,9. 30 Menschen wurden verletzt, die Sachschäden summierten sich auf mehr als 150 Millionen Euro.
Region um Köln ist am kritischsten
Das Bebenrisiko in Deutschland sei regional unterschiedlich verteilt, erklärt Marco Pilz vom Geoforschungszentrum Potsdam: "Es gibt in Deutschland durchaus Regionen, die stärker erdbebengefährdet sind, vor allem die Niederrheinische Bucht, der Oberrheingraben, die Schwäbische Alb und die Region südlich von Leipzig bis hinunter ins Vogtland. Wenn wir nun diese Erdbebengefahr mit der Bevölkerungsdichte und der Dichte an kritischen Infrastrukturen kombinieren, sehen wir, dass das Risiko eines Erdbebens in der Region Köln am größten wäre."
Und so fiel die Wahl der Region, in der das "Was wäre, wenn..." simuliert werden sollte, auf die Domstadt. Was würde passieren, wenn die Erde am sogenannten Erftsprung 15 Kilometer westlich von Köln mit einer Magnitude von 6,5 beben würde? Statistisch ist dort aus geologischen Gründen alle 1000 bis 3000 Jahre mit einem solchen Beben zu rechnen. Aus der Luft gegriffen sei das Szenario also nicht, findet Marco Pilz.
"In der Gegend ereignen sich die Erdbeben meist in geringer Tiefe von bis zu zehn Kilometern, und die Bebenwellen werden die Stadt innerhalb weniger Sekunden erreichen. Es gibt keine Vorwarnzeit. Und wir wissen, dass die geologischen Bedingungen in der gesamten Niederrheinischen Bucht ungünstig sind: Es gibt mächtige weiche Sedimentschichten, die die Bodenbewegung und die Dauer des Bebens noch verstärken."
Die Bausubstanz ist entscheidend
Im Stadtgebiet von Köln dürfte ein solches Erdbeben deshalb gravierende Schäden verursachen. Das Ausmaß werde maßgeblich durch die Bausubstanz bestimmt, erklärt Cecilia Nievas vom Geoforschungszentrum Potsdam:
"Nicht alle Gebäude sind gleich. Manche kommen besser mit einem Beben klar, andere schlechter. Unter anderem spielt eine Rolle, ob Erdbebenlasten bei der Konstruktion berücksichtigt wurden und wie gut die Gebäude gebaut und instandgehalten worden sind. Für eine Stadt wie Köln können wir natürlich nicht jedes einzelne Gebäude anschauen. Deshalb gruppieren wir sie nach bestimmten Eigenschaften, die uns sagen, wie wahrscheinlich ein bestimmter Schaden auftreten könnte."
Von den geschätzten 170.000 Wohngebäuden in Köln dürften den Berechnungen zufolge mehr als 10.000 mäßig bis schwer beschädigt werden. Auch Brücken und Verkehrswege wären in Mitleidenschaft gezogen, was Rettungskräften den Zugang erschweren würde.
Die Risikoanalyse kommt zu dem Schluss, dass mit Hunderten oder Tausenden Tote und mehr als 10.000 Verletzten zu rechnen wäre, sagt Wolfram Geier: "Und wir haben natürlich die vielen verletzten Menschen, die dann auch medizinisch versorgt werden müssen in Krankenhäusern der weiteren Umgebung."
Stromausfälle für drei Millionen Menschen
Außerdem dürfte der Strom für drei Millionen Menschen im Großraum Köln über Tage unterbrochen sein, so dass beispielsweise die Kommunikationsnetze ausfallen oder die Trinkwasserversorgung.
"Alle gesellschaftlichen Teilbereiche im Großraum Köln werden direkt, unmittelbar oder mittelbar betroffen sein. Und es ist mit einer längerfristigen Lage zu rechnen, auf die man sich einstellen muss."
So müssten wahrscheinlich mehrere hunderttausend obdachlose Menschen längerfristig betreut werden. Behörden und öffentliche Organisationen dürften von einem solchen Katastrophenfall überfordert sein, so ein weiterer Schluss der Studie. Deshalb sei es wichtig, Wasserversorger, Krankenhäuser oder auch Einsatzkräfte künftig gezielt auf ein solches Szenario vorzubereiten. Und die Menschen nach amerikanischem Vorbild mit Aktionen wie einem "Shake Out Day" für das Risiko zu sensibilisieren und richtige Verhaltensweisen einzuüben. Vor allem in den Schulen könne man dabei ansetzen, das lehre die Erfahrung.