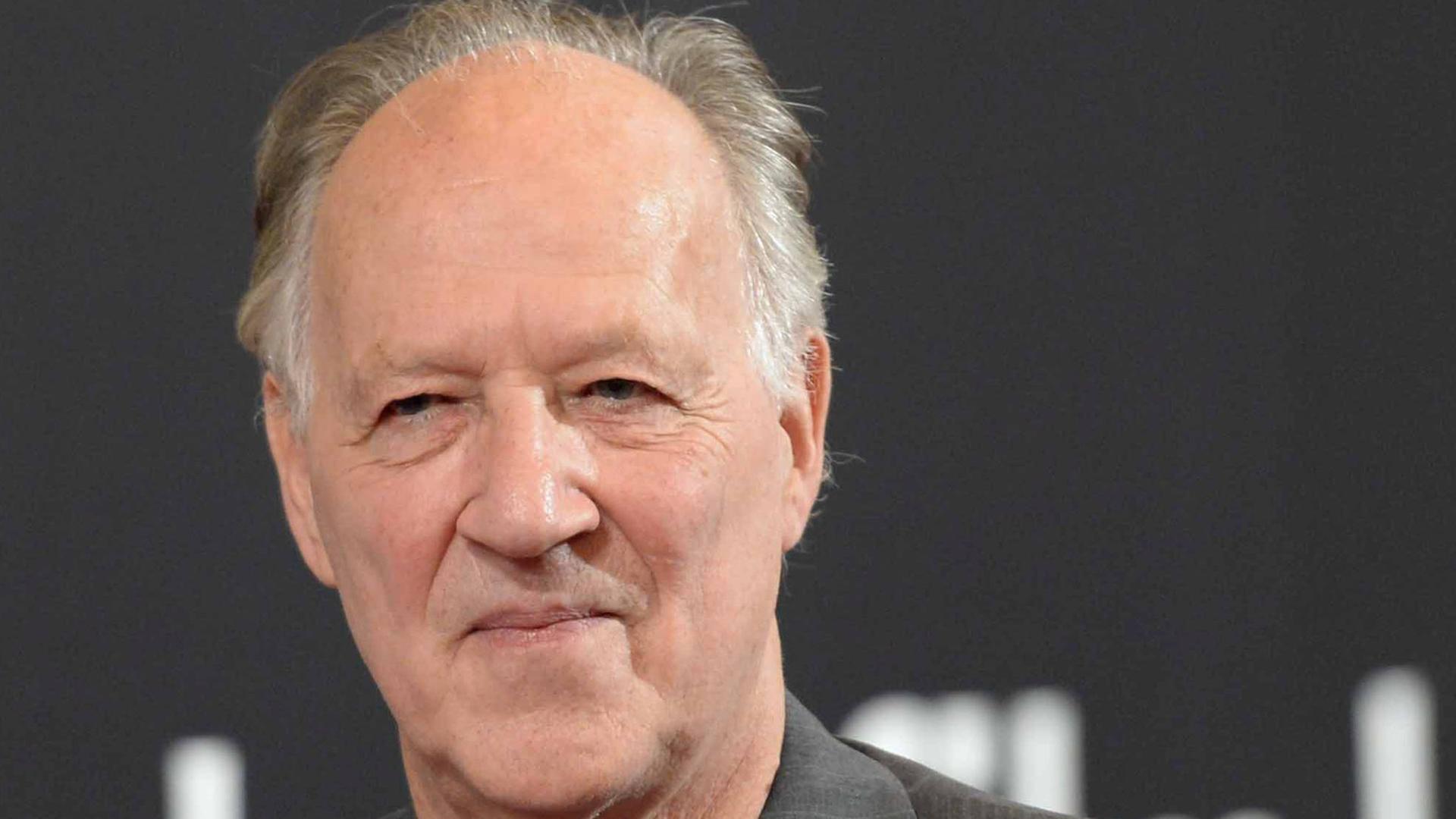Kenah Cusanit führt uns in ihrem Romanerstling "Babel" über 100 Jahre zurück in die wilhelminische Ära. Das deutsche Kaiserreich ist als Spätling im kolonialen Wettlauf um Einfluss und schnell sichtbare Trophäen bemüht. Von Ausgrabungen im mesopotamischen Zweistromland verspricht sich Wilhelm II. ein paar Glanzlichter für die Berliner Museen an der Spree. Mit der Gründung der Deutschen Orient-Gesellschaft 1898 nimmt die Sache Fahrt auf. Längst haben die Engländer wie die Franzosen reiche orientalische Beute eingefahren, da schickt die Gesellschaft mit großzügiger Unterstützung von Kaiser und Industriellen den Architekten Robert Koldewey an das Euphrat-Ufer, wenige Kilometer von Bagdad entfernt, um das mythenbeladene Babylon auszugraben.
18 Jahre lang ist der Mann mit seinem Grabungsteam und den einheimischen Arbeitskräften beschäftigt. Letztere wissen wohl gar nicht so genau, was dieser aus ihrer Sicht Verrückte eigentlich sucht, als er ihnen befiehlt, tiefer und tiefer, bis zu 20 Meter in das morastige Erdreich zu buddeln, bei 40 Grad im Schatten, auf einem Gelände von etwa 3,5 Quadratkilometern. Aber Koldewey wurde tatsächlich fündig mit den Palästen des Nebukadnezar, den Fundamenten des Turms zu Babel und der Prozessionsstraße von Babylon mit dem Ischtar-Tor.
Ausgrabungen im Archiv
Die Altorientalistin Kenah Cusanit, die sich bislang mit Lyrik einen Namen gemacht hat, genießt derzeit zu Recht mit diesem Roman-Debüt viel Aufmerksamkeit in den Medien. Denn wenn man nur ein wenig nachblättert in Schriften zu dieser größten Ausgrabung, die jemals in Vorderasien stattgefunden hat, dann erkennt man schnell den wohl gigantischen Rechercheaufwand, den Cusanit in Archiven betrieben haben muss. Nicht nur die historischen Einzelheiten bis zu den Briefen, die im Roman wiedergegeben werden, stimmen, auch die Figur des Koldewey ist mit all seinen Marotten wie Vorzügen dem realen Vorbild sorgsam nachempfunden. Und doch hat man, je länger man liest das Gefühl, der historischen Ebene immer wieder enthoben zu werden. Schon der erste Absatz stimmt ein auf eine Gedankenreise, die mit ihrer Symbolik Überzeitliches andeutet:
"Es war ein mesopotamisches Gelb: wie gemacht zum Davorstehen, Hinsehen, Aquarellieren – seine Lieblingsart, diese Gegend zu kartieren. Schlamm als Impression, Lehm, der sich durch das Wasser bewegte, indem er sich drehte. Koldewey sah aus dem Fenster seines Arbeitszimmers, nirgendwo davorstehend, nichts kartierend. Er hatte sich hingelegt, auf seine Liege, die Teil der Fensterbank war, und beobachtete den Fluss, der an den Ruinen entlangfloss, zog an seiner Pfeife und sah ihn an, als hätte er noch nie einen Fluss angesehen, ohne dabei über etwas anderes, etwas Übergeordnetes nachzudenken: das Schiff, die Fahrt, das Ziel, die Reliefziegel Nebukadnezars, die Reliefziegel des Ischtartors, des Palastes, der Prozessionsstraße, die sich im Hof des Grabungshauses mehrere hundert Kisten hoch stapelten und die von Babylon den Euphrat hinunter über drei Kontinente nach Hamburg, die Elbe, die Havel, die Spree hinauf, bis zum Kupfergraben an den Steg der Berliner Museen zu transportieren waren."
Der Blick auf den Euphrat
Der Fluss als Symbol für Zeit und Vergänglichkeit. Der Lehm als Material, aus dem nach dem biblischen Schöpfungsbericht der Mensch erschaffen wurde, er sendet - zu Ziegeln gebrannt und mit Schriftzeichen oder Figuren versehen - Botschaften aus vorbiblischen Zeiten. Und schließlich das Schiff auf dem Fluss, das durch seine Fracht Verbindungen herstellt zwischen Zeiten und Kulturen.
Dieses Bild, mit dem die Autorin in ihren Roman einführt, ist nicht nur symbolträchtig, es ist auch für seine Konstruktion wesentlich. Es ist das Jahr 1913, als Koldewey in seinem Arbeitszimmer halb liegt, halb sitzt und auf den Euphrat hinausschaut. Er ist an einer Blinddarmreizung erkrankt. Vielleicht hat er sich auch einfach nur übernommen bei der jahrelangen Ausgrabung unter klimatisch erbarmungslosen Bedingungen.
Möglicherweise hat er aber auch keine rechte Lust mehr sich mit seinen Mitarbeitern wie dem nervigen Buddensieg, der für die Kleinfunde zuständig ist, zu beschäftigen. Und schon gar nicht mir der Orientgesellschaft, die ständig auf Ergebnisse, Fotos und Lieferungen drängt, während Koldewey, der Architekt und Kunsthistoriker, den kulturell-historischen und architektonischen Gesamtzusammenhang der antiken Ruinen erfassen will. Und so sitzt er in seinem Zimmer und denkt nach, die kostbare Fracht in über 500 Kisten vor Augen, ahnend, dass ein Krieg bevorsteht.
Was ist Fortschritt?
Der gesamte Roman bis auf den Schluss ist angelegt wie eine mäandernde Reflexion Koldeweys, der über die Grabungen, die Beziehung zu seinen Mitarbeitern, zu den Einheimischen, den Scheichs und türkischen Institutionen im Zweistromland nachdenkt, das nur noch kurze Zeit unter osmanischer Herrschaft stehen wird. Dabei verschmelzen nicht nur Erzählerstimme und Figurenrede. Es schieben sich auch Zeitebenen ineinander wie die Schlieren des Schlamms, der sich im Wasser des Flusses im Kreise dreht und von Koldewey sinnierend beobachtet wird. Cusanits Roman zielt spürbar nicht allein auf das Historische. Ständig schwingt eine Metaebene mit, die auf Fragen zielt wie: Was ist Zivilisation? Was ist Fortschritt?
Ein Beispiel dafür ist das durchgängige Motiv des Fotografierens. 1913 noch eine junge technische Errungenschaft, mit der neuerdings die Grabungsfunde dokumentiert werden.
"Das Photo hielt nicht das Photographierte fest, es hielt die Zeit fest und prophezeite zugleich dessen Vergehen. (…) Die Photographie hatte den unwiederbringlich vergangenen und in seiner Unwiederbringlichkeit für immer festgehaltenen Augenblick erfunden. Das Photographieren kultivierte eine furchtbar evidente Geschichtsschreibung, die den poetischen Trost des Geschriebenen nicht kannte, des Liedes, des Gedichts, ja sogar den Trost, den ein altbabylonischer Gesetzesparagraph haben konnte, die allen mythischen Ballast abgeworfen hatte und im eigentlich wohlgesinnten Blick des Betrachters eine besinnungslose Bestürzung auslöste, nicht vor der eigenen Sterblichkeit, sondern vor dem, was bald nicht mehr sein würde, dem Leben."
Babylon als Wurzel des Christentums
Was Cusanit im Sinn hat, das sind geschichtsphilosophische Grabungen im Geiste Walter Benjamins, den die Autorin im Vorspann des zweiten Teils ihres Romans auch tatsächlich zitiert. Grabungen episch und rhapsodisch vornehmen, in immer tiefere Schichten vorstoßen, um damit das bereits Vorhandene einer Prüfung zu unterziehen, so Benjamins Blick auf die Gegenwart im Lichte der Vergangenheit. Das Rhapsodische hat es Cusanit denn auch tatsächlich angetan. Und so gibt es in diesem Buch mit seiner Fülle an Themen, Gedanken und Zitaten auch keine Chronologie.
Was in diesem Kontext nicht fehlen darf, ist der sogenannte Babel-Bibel-Streit, der zurückgeht auf den Assyriologen Friedrich Delitzsch. Mit seiner 1902 vor dem Kaiser vorgetragenen These, die jüdische Religion wie das Alte Testament fußten auf babylonischer Grundlage, das Christentum habe also heidnische Wurzeln, löste heftige Reaktionen aus, von denen sich Delitzsch allerdings keineswegs beeindrucken ließ.
Bei Cusanit redet sich der eifernde Delitzsch während einer Bootsfahrt mit Koldewey und dem türkischen Museumsdirektor Bey Bedri in Rage - wie überhaupt die Autorin Episoden immer wieder gekonnt ins Komische zu wenden versteht.
"Bedri saß zwischen Delitzsch und Koldewey, genau in der Mitte. Die zehn vorsintflutlichen Urväter der Bibel, rief Delitzsch über Bedri hinweg, seien niemand anderes als die zehn babylonischen Könige vor der Flut, von der die sumerische Königsliste berichte, die auf einem wunderbar erhaltenen Tonprisma vermutlich bei einer Raubgrabung noch weiter südlich von hier entdeckt worden war und so auf den Antikenmarkt gelangt sei. Delitzsch rezitierte auf der Rückfahrt nach Babylon aus 282 Gesetzesparagraphen Hammurabis. (…) Delitzsch listete alle Stellen des Alten Testaments auf, die vorbiblischen Ursprungs waren und von denen die Bibel und unser religiöses Denken bereinigt werden müssten, da diese Stellen historisch und damit von Menschen gemacht und damit nicht göttlich seien…"
Berlin Babylon
Kenah Kusanit hat einen gebildeten wie unterhaltsamen Roman über das Großereignis der babylonischen Ausgrabung kurz vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben. Und damit – vielleicht ungewollt – einen interessanten Begleittext verfasst zur gegenwärtigen Raubkunst-Debatte. Wobei das Buch durchaus feine Zwischentöne anschlägt, die das Grabungsprojekt keineswegs nur im Licht von kolonialer Habgier und unstatthafter Bereicherung erscheinen lässt. Deutlich wird: Koldewey konnte nur im Einverständnis mit den türkischen Bevollmächtigten und den ortsansässigen Einheimischen agieren. Zudem waren seine Methoden von Kulturverständnis und einer bis dahin unbekannten wissenschaftlichen Gründlichkeit geprägt.
Kritisch anzumerken ist, dass Cusanit es mit ihren Tiefenbohrungen und Analogien zwischen Antike und Moderne etwas übertreibt. So zum Beispiel wenn aus der 1913er Perspektive zurückgeschaut wird auf Koldeweys Besuch in Berlin beim Kaiser im Jahre 1909. Da darf dann natürlich der Verweis auf die sprachliche Ähnlichkeit von Babel und Berlin nicht fehlen wie auch auf Berlin als "Elektropolis", die elektrifizierte Stadt der Moderne, die mit den Schätzen von Babylon sich als Bewahrerin der babylonischen Kultur, der Wiege der Zivilisation schmückt.
Gern hätte man dagegen etwas mehr über die britische Forschungsreisende Gertrude Bell gelesen, die als Angehörige des Geheimdienstes und hoch angesehene Kennerin des Nahen Ostens geradezu kriegsentscheidend für die Engländer war. Auf diese Figur strebt das Romangeschehen zu. Bei einem Treffen gibt Bell Koldewey das Versprechen, den in über 500 Kisten verpackten Grabungsschatz nach dem Krieg nach Berlin zu schicken. Dieses Versprechen hat sie bekanntlich gehalten. Eine hochinteressante Frau. Im Buch von Kenah Cusanit steht sie leider im Schatten des deutschen Ausgrabungsleiters.
Kenah Cusanit: "Babel", Carl Hanser Verlag, München, 269 Seiten, 23 Euro