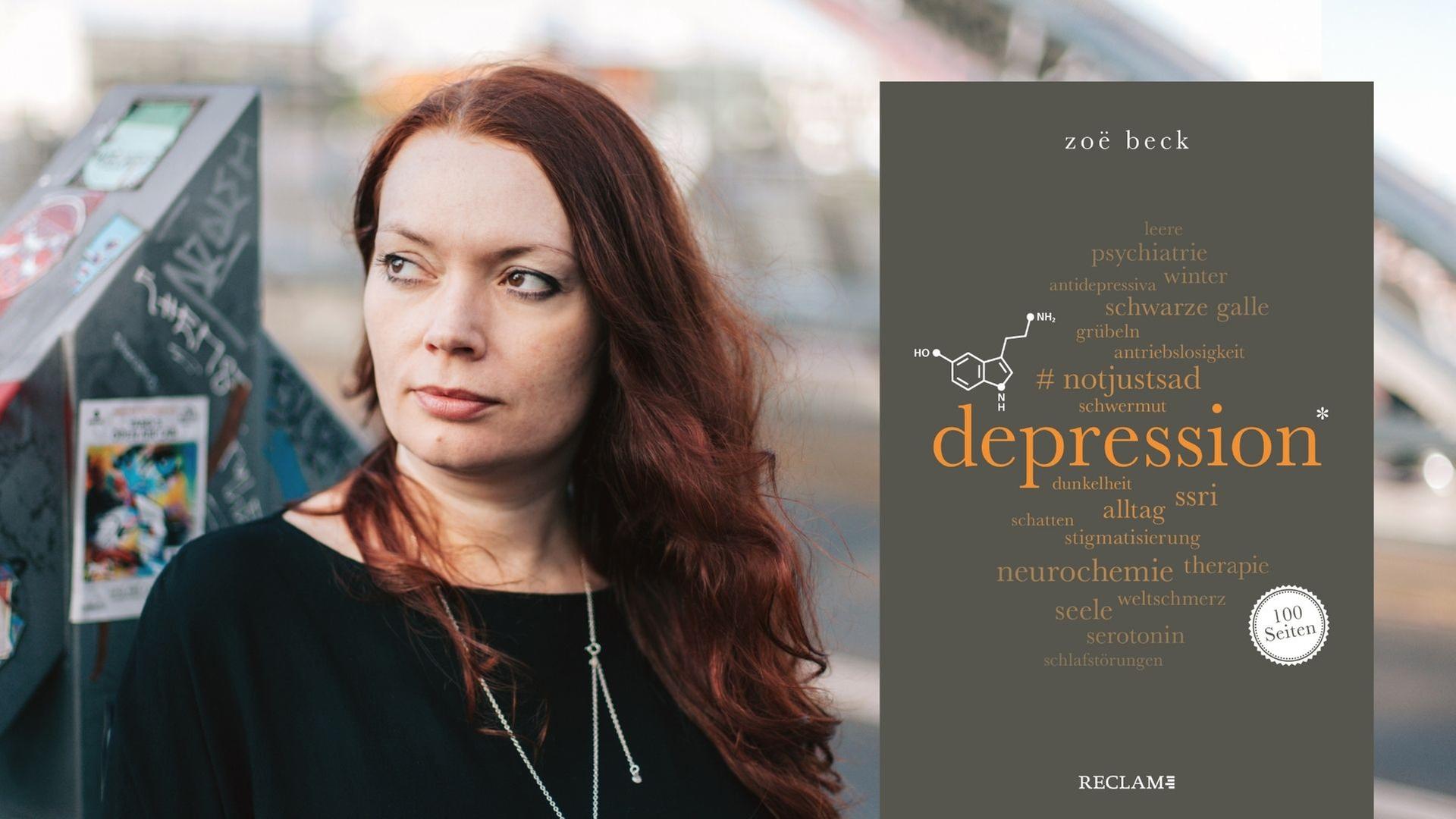Angststörungen, Depressionen, Verhaltensauffälligkeiten: Jeder siebte junge Mensch im Alter zwischen zehn und 19 Jahren leidet nach Angaben der UN-Kinderhilfsorganisation Unicef unter einer diagnostizierten psychischen Störung. Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie kämen nun noch gravierende Auswirkungen hinzu, so der Unicef-Bericht.
Nach Angaben von Unicef nehmen sich weltweit jedes Jahr rund 46.000 junge Menschen im Alter zwischen zehn und 19 Jahren das Leben - ein junger Mensch alle elf Minuten. In der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen ist demnach Suizid die vierthäufigste Todesursache nach Verkehrsunfällen, Tuberkulose und Gewalttaten.
Den Ergebnissen einer internationalen Umfrage von Unicef und Gallup im Sommer 2021 zufolge gab unter Heranwachsenden und Erwachsenen in 21 Ländern jeder fünfte befragte junge Mensch (19 Prozent) zwischen 15 und 24 Jahren an, sich häufig deprimiert zu fühlen oder wenig Interesse an Dingen zu haben oder daran, etwas zu unternehmen. In Deutschland sagte dies einer von vier der befragten jungen Menschen (24 Prozent).
Michael Schulte-Markwort ist Kinder- und Jugendpsychiater und ärztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik Marzipanfabrik in Hamburg. Die Corona-Pandemie habe die Aufmerksamkeit stärker auf die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gelenkt, bestätigte der Psychiater im Deutschlandfunk. Diese Entwicklung könne die Arbeit der Jugendpsychiater künftig erleichtern. Schulte-Markwort wies auf extreme Versorgungsengpässe hierzulande hin: "50 Prozent aller diagnostizierten Kinder in Deutschland waren nicht in Behandlung". Es gebe zu wenig Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, insbesondere in ländlichen Regionen. Auf Termine müssten Betroffene teilweise ein Jahr lang warten.
Hoher Risikofaktor für seelische und körperliche Erkrankungen: Armut
Schulte-Markwort wandte sich gegen die häufig gehörte These, durch Corona hätten psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugenlichen zugenommen: "Das ist nur sehr begrenzt so." Aber: Dadurch, dass in der Pandemiezeit Familien enger zusammengerückt seien, sei das sogenannte Inanspruchnahme-Verhalten gestiegen, dass also Eltern "mehr sehen, mehr wahrgenommen haben und schneller kommen".
Je jünger Kinder seien, desto uneinheitlicher zeigten sich dabei die Symptome von Depressionen, es sei dann auch generell sehr schwer, Angst von Depressionen zu trennen. Ein großer Risikofaktor für psychische wie auch körperliche Erkrankungen sei Armut: "Arme Kinder sind schlechter beispielsweise ernährt, in solchen Familien kommt gehäuft Gewalt und Alkoholmissbrauch vor."
Zu große, zu laute Klassen und Zukunftssorgen belasten Kinder
In Schulen und Kitas sei der Pandemie-Unterricht, an dem jeweils nur die Hälfte der Kinder teilnehmen, von diesen "unglaublich gut aufgenommen worden", hob der Jugendpsychiater hervor. Viele Kinder berichteten ihm, dass sie nicht gerne in volle und laute Klassen zurückkehrten: "Wir muten den Kindern einen Geräuschpegel zu, der fern ist von einer guten Lernatmosphäre."
"Mein Eindruck ist, dass wir uns schon länger in einer schulischen Krise befinden und dass es einfach respektlos gegenüber Lehrern und Kindern ist, in so großen Klassen und verwahrlosten Gebäuden zu unterrichten."
Auch das Schwinden auf Aufstiegschancen in der Gesellschaft stelle Belastungsfaktoren für Jugendliche dar: "Mein Vater konnte zu mir sagen: Du sollst es einmal besser haben und wir wussten beide, das würde auch eintreten. Und heute sagen Kinder mir: Ich weiß nicht, ob ich den Lebensstandard meiner Eltern werde halten können", sagte Michael Schulte-Markwort.