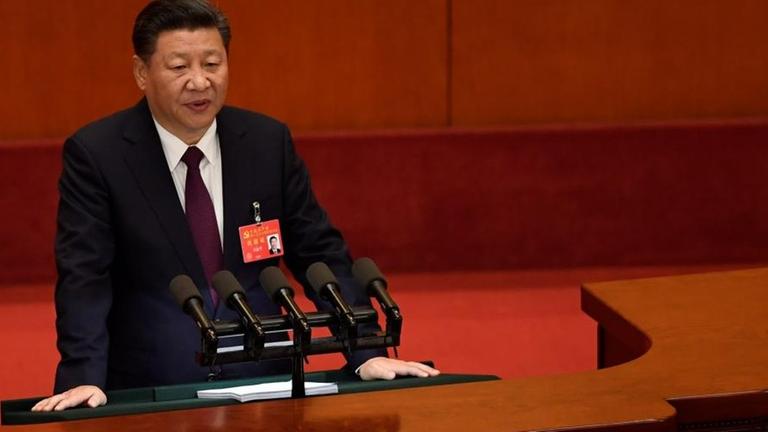Was für ein Paukenschlag! Die Leser des Neuen Deutschlands staunten nicht schlecht am Morgen des 7. März 1978. Da prangte auf der Titelseite des offiziellen Verlautbarungsorgans der SED ein Foto, auf dem Erich Honecker mit den Spitzen der Evangelischen Kirche freundlich beisammen steht. Von einem "konstruktiven, freimütigen Gespräch" war die Rede. War das das Ende des Kirchenkampfes, der Beginn einer neuen Ära im Staat-Kirche-Verhältnis? Heino Falcke, lange Zeit Propst in Erfurt, erinnert sich:
"Es war einfach eine Sensation, als der Bericht über dieses Gespräch mit einem großen Bild da erschien. Also, es war für viele Funktionäre so unterhalb der mittleren Ebene auch eine fabelhafte Neuigkeit - und ein ziemlicher Schock."
"Die SED wollte einfach Frieden an der Kirchenfront"
Monate zuvor hatte Honecker der Kirche das Angebot eines solchen Spitzengesprächs gemacht. Vorausgegangen waren außen- wie innenpolitisch stürmische Zeiten: Der KSZE-Prozess, jene "Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa", bei der Ost und West sich anzunähern versuchten, dann die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann, die Selbstverbrennung des Pfarrers Oskar Brüsewitz. Und auch nach Jahren des Kirchenkampfes: In diesen stürmischen Zeiten war die Evangelische Kirche nach wie vor ein wichtiger Faktor in der Gesellschaft - ein Faktor, den die Partei nicht ignorieren konnte.
"Diese ganzen Bewegungen und Unruhen waren im Gange und die SED wollte einfach Frieden an der Kirchenfront haben. Das war wirklich ein Gespräch auf gleicher Augenhöhe. Aber das Auge ist nicht der ganze Körper, und es gibt auch Füße, mit denen man dann gleichzeitig treten kann."

Seit dem Mauerbau war die Evangelische Kirche gezwungen, Position zu beziehen. Der aggressive Kirchenkampf der SED in den 50er-Jahren hatte seine Spuren hinterlassen. Nun musste sich die Kirche auf lange Sicht auf ein Leben in der DDR einstellen.
Die vom damaligen Staatssekretär für Kirchenfragen Hans Seigewasser ins Leben gerufene Formel einer "Kirche im Sozialismus" bot dafür das nötige Konzept - wenngleich beide Seiten es völlig unterschiedlich interpretierten. Für die Kirche war es vor allem eine Ortsbestimmung. Für die SED ein Bekenntnis zum Staatssozialismus.
"Jedes öffentliche Wirken der Kirche misstrauisch beobachtet"
Nach der erzwungenen Trennung von der EKD und der Gründung des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR im Juni 1969 stand die Evangelische Kirche vor der Frage, wie sie ihre Arbeit in der DDR weiter gestaltet. Es gab jedoch kein kodifiziertes Staatskirchenrecht. Zwar garantierte die Verfassung von 1968 Glaubens- und Gewissensfreiheit; und es hieß, die Kirchen- und Religionsgemeinschaften regeln ihre Angelegenheiten in Übereinstimmung mit der Verfassung. Aber letztlich mussten alle Belange von Fall zu Fall verhandelt werden. Hier sah die Kirche eine Chance, erinnert sich Heino Falcke, der in den Vorbereitungsprozess des Spitzengesprächs eingebunden war.
"Wir hatten uns jetzt zu überlegen, was wollen wir erreichen. Also alle Dinge, die Staat und Kirche betrafen, bedurften immer einer spontanen Regelung. Es gab kaum eine Rechtssicherheit - darum lag uns daran, nun einiges festzuschreiben."
Der Kirche lagen zunächst ganz praktische Fragen am Herzen: Eigentumsregelungen kirchlicher Immobilien, die Möglichkeit der Seelsorge in staatlichen Altersheimen, Krankenhäusern, Gefängnissen, der Bau von Gemeindezentren in den wie aus dem Boden schießenden Neubaugebieten vieler DDR-Städte oder kirchliche Sendungen im DDR-Fernsehen. Doch das war nur die eine Seite, sagt Falcke:
"Dahinter steht ja ein großes, grundsätzliches Problem der Kirchen in der DDR. Der Staat hatte ja die Tendenz, die Trennung von Staat und Kirche zu benutzen zur Marginalisierung der Kirchen, Abdrängung der Kirche in den privaten Raum. Und jedes Wirken in die Öffentlichkeit hinein wurde überaus misstrauisch beobachtet. Und wenn es ein kritisches Wirken gab, dann setzte sofort der staatliche Verbotsapparat ein. Und da die Öffentlichkeitsarbeit der Kirchen zu fördern und einfach Raum zu bekommen, das waren so unsere Interessen."
"Kirche zurückzudrängen, das war Dreh- und Angelpunkt"
Doch diese Zugeständnisse gab es nicht umsonst. Tatsächlich ging es der SED in ihrer Interpretation einer "Kirche im Sozialismus" um eine Zusammenarbeit von Kirche und Staat, um die Bejahung des Sozialismus. "Für den Frieden in der Welt", was doch nichts anderes hieß als Stabilisierung der eigenen Macht.
So hatte die SED großes Interesse daran, die Kirchen für ihr Streben nach internationaler Anerkennung einzuspannen. Etwa über den Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf. Hinter all den freundlichen Worten mit den Kirchenführern am 6. März verbarg sich zugleich ein langfristiges Ziel, von dem die Partei keineswegs abrückte. André Blechschmidt war damals Mitarbeiter für Kirchenfragen beim Rat des Bezirks Erfurt.
"Da glaubte man sicherlich, dass man hier auch eine Entspannung im Staat-Kirche-Verhältnis herstellen musste, dass man Kirche noch stärker in die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft einbinden kann. Und dennoch war immer die Bemühung da von der Partei, die Grenzen zurückzuschieben, nach dem Motto: Es wird in einer zukünftigen Gesellschaft Glauben nur noch eine Nebenrolle spielen. Es war natürlich auch eine Form von Erdrücken. Umarmen und Erdrücken."

Das Zauberwort für staatliche Vertreter wie André Blechschmidt in ihrer Auseinandersetzung mit Kirche hieß "politische Differenzierung". Gespräche führen, Einfluss nehmen, Kirche nur soweit gewähren lassen, wie es die "gesellschaftliche Entwicklung der DDR" und den "Aufbau des Sozialismus" nicht gefährde, sagt Blechschmidt, der heute Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion die Linke im Thüringer Landtag ist.
"Kirche zurückzudrängen, Kirche nicht in ihrer Wirkung sich entfalten zu lassen, das war in dieser staatlichen und politischen Arbeit immer Dreh- und Angelpunkt. Aber das Zurückdrängen ist ein langfristiger Prozess über Jahre, Jahrzehnte. Das, was dann wichtig war, war die Klärung aktueller Fragen. Wie kann Kirche ihren Auftrag umsetzen? Und das haben wir durchaus immer auch im Blick gehabt. Eine gewisse Widersprüchlichkeit, eindeutig."
"Politische Differenzierung"
Das Spitzengespräch vom 6. März 1978 hatte der Evangelischen Kirche tatsächlich konkrete Erfolge beschert: Die Seelsorgefrage, Fernsehsendungen, neue Gemeindezentren - all das waren Errungenschaften, die Albrecht Schönherr Anlass gaben, das Gespräch als Anerkennung um die kirchlichen Bemühungen zu sehen. Schönherr war als Vorsitzender der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen Honeckers unmittelbares Gegenüber und stand wie kein Zweiter hinter dem Konzept einer "Kirche im Sozialismus". Doch nur wenige Wochen nach dem Gipfeltreffen zog der Staat ganz andere Register. Heino Falcke sagt:
"Es stellte sich sehr schnell heraus, dass dieses Spitzengespräch nicht sehr weit trug. Wir wissen heute - das Gespräch war im März -, dass im April Mielke seine ganze Staatssicherheit alarmierte und einen Befehl rausgeben ließ, dass die Dienststellen genau beobachten müssen, ob die Ergebnisse dieses Gesprächs auch eingehalten werden. Das war seine Sprachregelung. Gemeint war: Wenn jetzt die Regierung aus politischen Gründen so freundlich mit der Kirche umgehen muss, müssen wir dafür sorgen, dass wir untergründig die Kontrolle über diese Kirche verstärken."

Im Visier standen vor allem die oppositionellen Gruppen, die sich unter dem Dach der Kirche sammelten. Heino Falcke hat damals die Offene Jugendarbeit in Erfurt geführt, auch sie war der SED ein Dorn im Auge. Was "politische Differenzierung" konkret bedeuten konnte, hat Falcke hautnah miterlebt.
"Also Streit verursachen in der Kirche zwischen den verschiedenen Positionen. Und die Oppositionellen nicht nur unter Kontrolle zu halten, sondern zu zersetzen, zu spalten. Und das war dann auch sehr spürbar im Jahrzehnt bis 1989, dass sich die Kontrolle der Stasi und die Zersetzungsmaßnahmen sehr verstärkten."
"Im Bildungswesen haben wir eigentlich nichts erreicht"
Zum neuen Schuljahr, im September 1978, ließ das von Margot Honecker geführte Volksbildungsministerium einen Wehrkundeunterricht einführen. Für die Evangelische Kirche ein offener Affront und eine Verletzung des Geistes vom 6. März 1978. Ohnehin tobte im Bildungsbereich eine der schwersten Auseinandersetzungen zwischen SED und Kirche. Werner Leich, der damalige thüringische Landesbischof, hat das unmittelbar erfahren:
"Das Margot Honecker'sche Prinzip hat sich leider weitgehend durchgesetzt. Also die Entkirchlichung in der DDR-Zeit ist doch viel stärker gewesen, als wir das damals im Augenblick erlebt und befürchtet haben. Wir lebten mit dem Gegner SED und wussten, dass er auf allen Gebieten die kirchliche Entwicklung stören wird; und dadurch haben wir so Einzeldinge gar nicht so wahrgenommen. Wir haben zwar immer darum gekämpft und Gespräche gesucht, dass die christlichen Kinder in der Schule nicht benachteiligt werden, aber dass das mal solche Auswirkungen hat, das war uns nicht klar. Vielleicht sind wir damals auch blind gewesen."
Auch Heino Falcke zieht hier ein ernüchterndes Fazit:
"Alle Versuche, mehr Toleranz im Bildungssystem zu erreichen, sind eigentlich alle gescheitert. Wir mussten zum Schluss doch sagen: Im Bildungswesen haben wir eigentlich nichts erreicht."
Das Spitzengespräch vom 6. März 1978 ermöglichte nach Jahren der Unsicherheit eine erste wirkliche Annäherung zwischen Evangelischer Kirche und SED-Regime. Aber diese Annäherung brachte auch viele kritische Stimmen in der Kirche hervor. Vor allem nachdem sich zeigte, dass der Staat bei allen Zugeständnissen sein eigentliches Ziel einer Marginalisierung der Kirche nie aufgab. Doch für Heino Falcke ging es trotz dieses Zwiespalts immer um die Verantwortung der Kirche. Er hatte mit seinem Plädoyer für mehr Freiheit und der Formel eines "verbesserlichen Sozialismus" auf der Dresdner Synode von 1972 viel Aufsehen erregt - und Wut bei der Partei ausgelöst.

"Ich meine, Verantwortung wahrnehmen in dieser Gesellschaft. Um das, was verbesserungsmöglich ist, auch zu realisieren, statt sich fernzuhalten und zu sagen: Mit dem will ich nichts zu tun haben. Sich ins Private zurückziehen, das ist keine Möglichkeit christlicher Nachfolge."