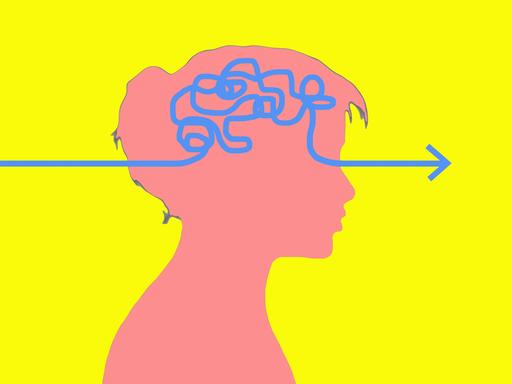Die Kirchen gehören zu den bedrohten traditionellen Institutionen, die der Gesellschaft Orientierung geben und sie entlasten können. Wo sie in Auflösung begriffen sind, weicht das klare Bewusstsein für ethische Grenzen einem radikalen Subjektivismus, der die Demokratie gefährdet. Da gerade die evangelische Kirche sich bis zur Selbstaufgabe politisiert und theologisch ausgehöhlt hat, vermag sie gegen diese Entwicklungen kein Gegengewicht mehr zu bilden. Um einen Weg aus ihrer Krise zu finden, muss sie die Sprache des Glaubens wieder erlernen.
Wohin man in Deutschland derzeit auch schaut, droht der Untergang. Die Wirtschaft steckt in einer tiefen Krise, der Klimawandel schreitet in Extremen voran, die Infrastruktur ist marode, Wohnungen sind unbezahlbar, die Bildungskatastrophe wird zum Dauerzustand, die Künstliche Intelligenz breitet sich mit schwer absehbaren Folgen aus, und die deutschen Autos sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Die Schwarzmalerei kann nerven, doch die grassierende schlechte Laune kommt nicht von ungefähr. Vorbei die Zeit, da man sich noch in wohlstandsverwöhnter Behaglichkeit einrichten konnte. Das Versprechen auf eine bessere Zukunft ist brüchig geworden.
Der politische Pessimismus folgt Abwehrmechanismen der Angst: Angst vor Veränderung, Angst vor Verlust, Angst vor Unsicherheit. Inmitten unserer multiplen Krisenlage lösen sich herkömmliche Strukturen auf, und der aufkeimende Populismus findet in der desorientierten Gesellschaft seinen Nährboden. Endzeiterzählungen haben in Zeiten tiefgreifender Umbrüche dagegen Hochkonjunktur. Man muss nicht gleich das Ende der Geschichte ausrufen, wie es 1989 der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama tat, um zu erkennen, dass kaum etwas bleibt, wie es war.
Die christliche Kirche in Deutschland gehört zu den bedrohten traditionellen Institutionen, die den Menschen wieder eine Orientierung geben und sie entlasten könnten. Doch ihr Zustand ist prekär, ihre Zukunft an die Frage geknüpft, wie und ob sie überhaupt überleben kann. Dabei ist die Säkularisierung nicht die einzige Ursache für ihren Bedeutungsverlust. Die Kirche stellt ihre Relevanz vielmehr selbst in Frage, indem sie sich von Fragen der Religion und Theologie immer weiter entfernt, während sie sich – wie vor allem im Falle der evangelischen Kirche – gleichzeitig mit deutlicher Schlagseite zum linken Zeitgeist stark politisiert.
Mich interessiert hier hauptsächlich die evangelische Kirche, weil sich an ihr die wechselseitige Verschränkung von Politisierung und inhaltlicher Relativierung besonders drastisch zeigt. Ihre Entwicklung ist nicht nur für Kirchenvertreter und Gläubige relevant. Die Kirche ist ein Spiegel der Gesellschaft und offenbart Leerstellen, die durch die Erosion von Religiosität entstehen und oftmals durch neue Ideologien oder Ersatzreligionen gefüllt werden. Dabei gerät aus dem Blick, dass die Kirche wie keine andere Institution sonst als ethisches Korrektiv fungiert und darin von systemischer Relevanz für die Demokratie ist.
Die prekäre Existenz der Kirche macht diese Aufgabe allerdings ungleich schwerer. Es mögen einige Stichpunkte genügen, um ihre gegenwärtige Lage in Erinnerung zu bringen: Die evangelische Kirche in Deutschland hatte 2023 rund 18,6 Millionen Mitglieder, das entspricht knapp 22 Prozent der Bevölkerung. Etwa 24 Prozent sind katholisch. 43 Prozent der deutschen Bevölkerung sind konfessionslos, neun Prozent gehören anderen Religionsgemeinschaften an. Es vergeht kaum ein Jahr, in dem nicht neue Rekordwerte bei den Kirchenaustritten vermeldet würden. Allein 2023 hat die evangelische Kirche über eine halbe Million Mitglieder verloren. Nach Schätzungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD, wird der Anteil an Konfessionslosen im Jahr 2027 50 Prozent überschreiten und damit die absolute Bevölkerungsmehrheit ausmachen. Eine Umkehr des Trends ist also nicht abzusehen.
Man kann in den Zahlen eine Reaktion auf die Verfehlungen der Kirche lesen, auf ihre Missbrauchsskandale und den Verlust an Glaubwürdigkeit. Zumindest im Fall der Protestanten drückt sich darin aber noch etwas anderes aus: Die Kirche wird zunehmend als belanglos angesehen. Was hilft es also, ihre sukzessive Auflösung zu beklagen, wenn sie ohnehin für immer weniger Menschen relevant ist? Warum sollte uns die Kirche in einer modernen, säkularisierten Gesellschaft überhaupt noch interessieren?
Die Antwort liegt in ihrem institutionellen Charakter. Um den Sinn von Institutionen zu erfassen, ist ein Blick in die Anthropologie des 20. Jahrhunderts hilfreich. In seiner berühmten Institutionenlehre folgt etwa der Philosoph Arnold Gehlen der Annahme Johann Gottfried Herders, wonach der Mensch ein Mängelwesen sei. In der Entstehung der Kultur sieht Gehlen die zweite Natur des Menschen, die diesen Mangel kompensiert. Anders als das Tier verfüge der Mensch nicht über Instinkte und eine spezifische Umwelt. Deshalb sei er auf Institutionen angewiesen, die ihn entlasten. Zu Institutionen in diesem Verständnis zählen nicht nur der Staat, die Kirche oder gesellschaftliche Einrichtungen, sondern auch bestimmte Formen des Zusammenlebens und der Gemeinschaft wie die Familie oder Ehe.
Folgt man der Annahme einer generellen Bedürftigkeit des Menschen, ist der Rückgriff auf Institutionen plausibel. Denn sie entlasten den Menschen vom Druck, in allen Fragen des Lebens auf sich allein zurückgeworfen zu sein. In einer hochindividualisierten Gesellschaft wie der unseren erscheint die Vorstellung befremdlich, subjektive Fragen zu delegieren, an eine Institution abzugeben, die die Vereinzelung aufhebt und auf tradierte Verfahren zurückgreift. Doch sie steht in keinem Gegensatz zum freiheitlichen Streben des Einzelnen. Im Gegenteil: Institutionen stabilisieren das Gefüge einer demokratischen Gesellschaft, indem sie das Individuum durch bereits vorhandene Strukturen entlasten.
Vor diesem Hintergrund ist auch die Funktion der Kirche zu sehen. Sie ist die Institutionalisierung von Religion. In einer säkularen Demokratie ist sie frei von jedem zwanghaften Charakter und kann immer nur ein Angebot für die Menschen sein. Darin aber ist sie von unschätzbarem Wert. Nimmt sie ihren christlichen Auftrag ernst, kann die Kirche ein Anker für Gläubige wie Zweifelnde sein. Sie muss die Gesellschaft daran erinnern, dass es in all den Veränderungen der Welt etwas Bleibendes gibt, das den Menschen Halt zu geben vermag, wenn sie danach suchen. Was immer passiert: Der Glaube an Gott ist für die Kirche nicht verhandelbar. Das Nachdenken über ein Leben nach dem Tod, Trost in Zeiten der Not, das Erleben von Verlust, Krankheit und Vergänglichkeit, die Suche nach Sinn – all das hat hier einen Ort, der weitgehend unabhängig vom Wandel der Zeit ist.
In ihrer Unveränderbarkeit inmitten des Umbruchs liegt nicht das Risiko, sondern die Chance der Kirche. Dafür müsste sie allerdings den Mut aufbringen, sich gegen den atheistischen Trend der Gesellschaft in Stellung zu bringen und ihrer ursprünglichen Funktion als Vermittlerin des christlichen Glaubens gewahr zu werden. Verkommt die Kirche dagegen zur politisierten Organisation oder sozialen Einrichtung wie jede andere, wird sie beliebig und durch ihren religionslosen Charakter ersetzbar.
Doch die Kirche sagt nicht bloß etwas über die Religiosität einer Gesellschaft aus. Sie ist desgleichen ein Gradmesser für die Demokratie. So fällt die Gefährdung der Kirche in eine Zeit, in der auch andere Institutionen der Gesellschaft heftigen Anfeindungen ausgesetzt sind. Dazu gehören die Presse, Teile der Wissenschaft, Bildungseinrichtungen, Politik und Staat. Mehr noch: Das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die Demokratie sinkt. Das belegen Umfragen, und es spiegelt sich auch in der gereizten Debattenkultur, wenn das politische System als solches in Frage gestellt wird. Der Zweifel wächst, ob die gewählten Repräsentanten des Volkes tatsächlich noch dessen Wählerwillen abbilden.
Als CDU-Chef Friedrich Merz rund drei Wochen vor der Bundestagswahl für einen Eklat im Deutschen Bundestag gesorgt hat, weil er mit Stimmen der AfD einen Entschließungsantrag der Union durchs Parlament brachte und selbiges mit dem sogenannten „Zustrombegrenzungsgesetz“ vorhatte, nahm er zur Legitimierung seines Vorgehens auf genau dieses Argument Bezug. So sagte er im Bundestag:
„Die Demokratie gerät auch in Gefahr, wenn eine gesellschaftliche und politische Minderheit – und Sie, SPD und Grüne, sind eine kleiner werdende gesellschaftliche und politische Minderheit – die Radikalen als Werkzeug benutzt, um den Willen der Mehrheit der Bevölkerung dauerhaft zu ignorieren.“
Damit hat Merz einen Nerv dieser Zeit getroffen. Im Ergebnis der Bundestagswahl spiegelte sich das zwar weniger deutlich wider als von ihm erhofft; dennoch haben CDU und CSU mit weitem Abstand zu den Ampel-Parteien die Wahl gewonnen. In manchen Teilen der Bevölkerung konnte die Union offenbar etwas füllen, was oft als „Repräsentationslücke“ bezeichnet wird. Der Preis dieser Strategie liegt allerdings in einer Verschiebung dessen, was im Umgang der bürgerlichen Mitte mit der AfD noch als Tabu gilt – und was nicht.
Diese Frage führt zurück zur Rolle der Institutionen in einer Demokratie, die sich gegen ihre rechtsextremen Feinde zu wappnen versucht. Zur Verteidigung der sogenannten Brandmauer halten viele es für legitim und angebracht, wenn auch die Kirche ihre Stimme erhebt und gegen die AfD aufbegehrt. Wer das in Zweifel zieht, handelt sich schnell den Vorwurf ein, diese in Teilen rechtsextreme Partei zu verharmlosen. Doch das ist hier gar nicht die Frage. Die Inanspruchnahme der Kirche für parteipolitische Zwecke offenbart vielmehr, wie wenig definiert sie mittlerweile ist. In ihrem erodierenden Zustand ist es fast schon nötig, die Kirche mit ihr gegen sich selbst zu verteidigen. Wo also steht sie in unserer politisch aufgeregten Zeit?
Die Kirche ist ein Produkt der Gesellschaft, agiert aber zugleich autonom. Darin liegt ihre Chance und ihre Funktion. Die Kirche ist nicht der Staat. Sie ist keine Partei und keine NGO, sondern sie ist ein Ort des Glaubens. Darin unterscheidet sie sich von allen anderen Institutionen der Gesellschaft. Wenn die Kirche überleben und nicht zu einer beliebigen Organisation unter vielen verkommen will, muss sie den Mut wiederfinden, ihre Eigenart auszuleben, den Glauben sichtbar zu machen und seine Bedeutung gerade für eine Gesellschaft zu vermitteln, die mit Religion immer weniger anzufangen weiß.
Es ist für die Kirche dagegen weder mutig noch angebracht, sich in parteipolitische Fragen oder gar in den Wahlkampf einzumischen, wie das mit Blick auf Union und AfD vor der Bundestagswahl der Fall war. In einer gemeinsamen Stellungnahme hatten Teile der katholischen und evangelischen Kirche vor dem Vorhaben der Union gewarnt, ihren Gesetzentwurf zur Migrationspolitik notfalls auch mit den Stimmen der AfD ins Parlament zu bringen. Ungewöhnlich scharf kritisierten die Prälaten Karl Jüsten vom Katholischen Büro in Berlin sowie Anne Gidion, Bevollmächtigte des Rates der EKD, das Vorgehen der Union.
„Zeitpunkt und Tonlage der aktuell geführten Debatte befremden uns zutiefst“, hieß es in dem Begleitschreiben zur Stellungnahme, die den Abgeordneten des Deutschen Bundestages geschickt wurde. Und weiter: Die Debatte „ist dazu geeignet, alle in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten zu diffamieren, Vorurteile zu schüren, und trägt unserer Meinung nach nicht zur Lösung der tatsächlich bestehenden Fragen bei.“
Gidion und Jüsten stellten außerdem die rechtliche Zulässigkeit einiger Punkte des Gesetzentwurfs in Frage. Schließlich appellierten sie an die Abgeordneten, keine Abstimmungen herbeizuführen, „in der die Stimmen der AfD ausschlaggebend sind“. Dieses Versprechen hätten sich die Fraktionen der Ampel und der Union gegeben. Sie beenden das Schreiben mit der Warnung: „Wir befürchten, dass die deutsche Demokratie massiven Schaden nimmt, wenn dieses politische Versprechen aufgegeben wird.“
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken – ZdK – sowie die EKD‑Ratsvorsitzende verteidigten die Stellungnahme, während einige katholische Bischöfe sich davon distanzierten. Die ehemalige CDU-Vorsitzende Annegret Kramp‑Karrenbauer trat aus Protest aus dem ZdK aus.
Was die Kirchen hier unternommen haben, war keine Lappalie. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl derart deutlich Stellung zu beziehen und die Positionen der Union zu diskreditieren, kann nicht anders denn als versuchte Beeinflussung des Wahlkampfes gewertet werden. Das aber ist nicht Aufgabe der Kirche – selbst dann nicht, wenn sie eine politische Position nicht mit ihrem christlichen Selbstverständnis in Einklang zu bringen vermag. Das Haus Gottes ist für alle offen – ganz gleich, welche politischen Positionen Gläubige haben oder ob sie sich überhaupt für politische Fragen interessieren. Durch Stellungnahmen dieser Art aber vergrault die Kirche Menschen, die manches vielleicht anders sehen. Im Wettbewerb der Parteien ist das ein gewöhnlicher Vorgang. Die Kirche hingegen sollte nicht Teil eines solchen Wettbewerbs sein – erst recht nicht in der größten Krise ihrer Geschichte, in der sie unablässig Mitglieder verliert.
Die Kirche überschreitet mit solchen parteipolitischen Interventionen, wie wir sie heute erleben, allerdings nicht nur ihre Kompetenzen. Sie vollzieht auch einen Akt der öffentlichen Selbstvergewisserung, den sie überhaupt nicht nötig hätte. Die evangelische wie die katholische Kirche in Deutschland stehen fest auf dem Boden der Demokratie. Daran kann doch 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges überhaupt kein Zweifel bestehen.
So wie die Kirche Grund für mehr Selbstbewusstsein hätte, wäre auch die Gesellschaft gut beraten, nicht kollektiv in Panik zu verfallen, weil die AfD so stark geworden ist. Berlin ist nicht Weimar. Wir haben im vergangenen Jahr das 75. Jubiläum des Grundgesetzes gefeiert. Die Bundesrepublik Deutschland ist seit Jahrzehnten eine starke, stabile, sichere Demokratie. Das demokratische Bewusstsein ist tief in der Gesellschaft verankert, und bei allem Zetern gegen Staat und Regierung hat eine deutliche Mehrheit dennoch großes Vertrauen in den Rechtsstaat.
Nichts hätte die öffentliche Debatte gerade nötiger, als rhetorisch abzurüsten und Vernunft zur Maßgabe ihres Gelingens zu machen. Stattdessen ist die Gesellschaft durch kommunikatives Handeln im digitalen Raum außer Rand und Band geraten. Die verträumten Annahmen der deliberativen Demokratietheorie – jener von Habermas adaptierten Vorstellung, durch herrschaftsfreie Kommunikation könne die Gesellschaft sich zum Besseren entwickeln – zerschellen an der disruptiven Realität des digitalen Miteinanders. Die öffentliche Debatte ist durch Social Media, Echokammern und eine grassierende Informationskrise derart kontaminiert, dass die sachliche Auseinandersetzung zu einem mühsamen Unterfangen wird.
Eingehegt zwischen lautstarken Invektiven am rechten und linken Rand, wird es in der gesellschaftlichen Mitte immer enger. Während rechtsidentitäre Demokratieverächter langsam salonfähig werden, betrachten Linksidentitäre deren Erfolg als Bestätigung ihrer eigenen Weltanschauung.
In dieser schwierigen Gemengelage wird das Diskursklima weiter überhitzt und ein Trend verschärft, den Soziologen oft als affektive Polarisierung bezeichnen. Wenn wir nicht mehr unter der Vorannahme in eine Debatte gehen, der andere könnte recht haben, sind die Wege zur gegenseitigen Verständigung verbaut. Die Herausforderung der Gegenwart liegt längst nicht mehr in einer Politikverdrossenheit. Im Gegenteil: Die permanente Politisierung des öffentlichen Gesprächs setzt die Demokratie auf neue Weise unter Druck.
In dieser angespannten Lage wäre eine Institution, die frei von solchen Verwerfungen ist und für die Menschen ein Ort der Ruhe sein kann, nötiger denn je. Die Kirche könnte das bieten – gerade jetzt, wo die Gesellschaft umgeben ist von Krisen, Reizung und permanenter Veränderung. Menschen brauchen Orientierung und Verlässlichkeit. Es muss einen Ort geben, an dem sie Trost finden können – nicht noch mehr Politik. In diesen Fragen aber ist die Stimme der Kirche viel zu leise.
Das hat auch mit ihrer inhaltlichen Aushöhlung zu tun. Sehr verbreitet ist etwa – und hier spreche ich aus eigener Erfahrung mehr für die evangelische Kirche – die Methode, kirchliche Predigten und Ansprachen mit belanglosen Anekdoten aus dem Alltag zu füllen, um mehr schlecht als recht das Evangelium ganz konkret und lebensnah zu veranschaulichen. Ob den Menschen mit dieser radikalen Vereinfachung, Entzauberung und Entwertung von Religion die Sprache des Glaubens nahe gebracht werden kann, darf bezweifelt werden. Eher schon führt eine solche Banalisierung von Theologie dazu, dass die Kirche in ihrer eigentlichen Funktion nicht mehr ernst genommen wird.
Eine säkulare Gesellschaft könnte dies als innerkirchliches Problem abtun, das nur für die verbliebenen Gläubigen relevant ist, deren Zahl ohnehin immer geringer wird. Doch mit ihrem theologischen Bedeutungsverlust büßen die evangelische und die katholische Kirche auch ihre Wächterfunktion ein, die sie in ethischen Fragen haben.
Religion ist die Quelle der Moral – allerdings ist sie in der Neuzeit weitgehend verschüttet worden, wie der Philosoph Charles Taylor in seinem Buch Quellen des Selbst beschreibt. Eine Ethik aber, die ohne jeden religiösen Bezug auskommen soll, verflacht. Die Kirche kann und muss das sichtbar machen, indem sie als Korrektiv der Gesellschaft wirkt. Geht es um Grenzfragen wie Sterbehilfe oder Organspenden, ist sie die einzig noch verbliebene Institution, die jenseits rechtlicher Fragen mit moralischer Autorität aufzeigen kann, inwieweit die Menschen in das Leben eingreifen dürfen und wo sie an ethische Grenzen stoßen. Doch nicht nur dort, wo man mit inneren Abwägungen an Grenzen gerät, hat die Kirche der Gesellschaft etwas zu sagen. Insoweit sie noch als Ort des Glaubens wahrgenommen und verstanden werden will, ist sie gerade keine Instanz für politisierte Debatten, sondern für Fragen des Lebens und der Seelsorge, ein Zufluchtsort, an dem auch über Krankheit, Leid und Tod gesprochen wird.
Doch das ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Wer heute von einer Notwendigkeit der Moral spricht, gerät unter Rechtfertigungsdruck. Während am linken Rand in identitätspolitischer Manier politische Sachverhalte, Verhaltensweisen, Lebensgewohnheiten, Meinungsdifferenzen oftmals stark moralisiert werden, reagiert der rechte Rand mit vehementen Abwehrreflexen und warnt vor einer „Hypermoralisierung“ der Gesellschaft. Wie man es auch wendet: Die Moral ist gegenwärtig kontaminiert.
In engem Zusammenhang damit steht ein irreführender Begriff von Freiheit, der sich seit der Pandemie hartnäckig im politischen Diskurs festgesetzt hat. Dieses Verständnis von Freiheit zielt auf einen radikalen Individualismus, der keine Rücksicht auf die Belange der Gemeinschaft nimmt und außer acht lässt, dass das Ausleben von Freiheit staatlich garantierte Sicherheit voraussetzt. Wer Freiheit absolut setzt und nur die eigenen Interessen zum Maßstab seines Handelns macht, dehnt auch die Grenzen der Moral aus. Kurzerhand wird selbst das Unmoralische für liberal erklärt, während jene, die in politischen Fragen auf die Wahrung moralischer Grundsätze pochen, allzu schnell als – zumeist linke, grüne oder rot-grüne – Moralapostel abgestempelt werden. Dabei ist die Orientierung an einer bestimmten Moral, an Tugenden, Anstand, Respekt, eigentlich eine zutiefst konservative Haltung.
Eine Gesellschaft, die keine klare Vorstellung mehr von ihrer Moral hat, ist orientierungslos – und sie lässt die Menschen in zentralen Lebensfragen allein. Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass die heutige Zeit stärker als je zuvor davon geprägt ist, das Altern, die unvermeidbare Vergänglichkeit unserer Jugend, so sehr zu fürchten, dass alles dafür getan wird, die Spuren des Älterwerdens aus dem Leben und von allen digitalen Bildschirmflächen zu verdrängen. Jeder, der einen solchen Kampf gegen das Leben führt, wird ihn verlieren. Der Mensch ist endlich, fehlbar und begrenzt. Das zu akzeptieren lehrt der Glaube. Einer Gesellschaft hingegen, die von Gott nichts mehr weiß, deren religiöses Wissen verlorengeht und die den Kirchen keine hohe Bedeutung mehr zumisst, mangelt es an Quellen der Sinnstiftung und Lebensklugheit.
Auch in diesen Fragen wird gern das Freiheitsargument angeführt: Die Institution der Kirche sei dafür unnötig, das könne doch jeder mit sich allein ausmachen, es bedürfe keines kollektiven Wertekanons, um im Leben Orientierung zu finden. Doch eine solche Betrachtung ist eindimensional. Natürlich geht der Gesellschaft etwas verloren, wenn es keinen Gemeinschaftssinn mehr gibt und keine kollektiven Quellen der Moral, aus denen die Menschen schöpfen können. In dieser Hinsicht sind Religion und mit ihr die Kirche in ihren tiefen Lebensweisheiten unersetzlich.
Charles Taylor warnte schon vor mehr als 30 Jahren vor einem radikalen Subjektivismus, durch den die politische Gemeinschaft zu erodieren drohe. Das gilt heute mehr denn je: Wenn die ohnehin fragmentierte Gesellschaft in lauter vereinzelte Subjekte zerfällt, sind die Menschen nicht nur sehr allein, sondern es wird auch das kollektive Zugehörigkeitsgefühl zur politischen Gemeinschaft gefährdet und damit die Identifikation mit den Grundfesten der Demokratie. Die Menschen bedürfen einer institutionalisierten Verankerung, um nicht in eine permanente Überforderung zu geraten und rein subjektive Freiheitsreflexe auf Kosten der Gemeinschaft auszuleben.
Die Kirche allein kann die drohende Erosion des Politischen nicht aufhalten. Aber insoweit sie ihren Glaubensauftrag noch ernst nimmt, kann sie als Institution den Menschen Halt geben und Sinn stiften. Damit leistet sie einen unschätzbaren Beitrag für ein ziviles Miteinander und den Erhalt der Demokratie.
Die heutige Kirche ist für eine freie, säkulare Gesellschaft immer nur eine Option, eine Möglichkeit, von der die Menschen Gebrauch machen können. So wie ihr jeder fernbleiben kann, hat sie umgekehrt jedem Gläubigen Eintritt zu gewähren. Ein solcher Ort des Glaubens ist gerade nicht dafür geeignet, in die erhitzten Debatten der Gegenwart einzusteigen oder sie durch eigene Politisierung gar zu befeuern. Die Kirche muss vielmehr offen bleiben für alle Menschen, die sie aufsuchen – ganz gleich, welche politische Anschauung sie haben. Erst dann kann sie einen Platz in der Gesellschaft schaffen, an dem die Menschen zur Ruhe kommen können und nicht belastet werden durch das permanente gegenseitige Anschreien, Missverstehen und Verurteilen, das die digitale Debatte insbesondere in den sozialen Netzwerken dominiert.
Dort, wo sie noch funktioniert, stiftet die Kirche Gemeinschaft. Damit bildet sie ein Gegengewicht zur individualisierten, fragmentierten Gesellschaft, deren Leitplanken einzubrechen drohen. Wer meint, die Kirche sei in der heutigen Zeit entbehrlich, übersieht diese stabilisierende Funktion. Zwar wird die Kirche nicht mehr zu alter Stärke zurückfinden und als Volkskirche wiederauferstehen können. Dafür ist die Säkularisierung zu stark vorangeschritten, die nicht nur das religiöse Bekenntnis verdrängt hat, sondern auch das Wissen von Religion. Trotzdem kann die Kirche immer noch viel bewirken und hätte allen Grund, sich mit mehr Selbstvertrauen auf ihren eigentlichen Auftrag zu besinnen.
Ja, die Kirche als genuin religiöser Ort scheint in unserer atheistischen Gesellschaft ein Anachronismus zu sein. Doch das sollte für sie gerade ein Anreiz sein, nach neuen Wegen zu suchen, ihrem christlichen Auftrag nachzukommen und ihren Glauben selbstbewusst zu zeigen, anstatt ihn mit Belanglosigkeiten zu verschleiern und durch Politisierung unkenntlich zu machen.
Eine Demokratie ist auf starke Institutionen angewiesen. Wie eingangs erwähnt, ist die Kirche nicht die einzige Institution, deren Gefüge in eine tiefe Krise geraten ist. Auch Kulturinstitutionen, das Bildungswesen und, noch grundlegender, die Presse gehören zu den gefährdeten Institutionen der Gegenwart. Umso dringender ist es geboten, für den Erhalt dieser Institutionen zu kämpfen und ihr Profil zu schärfen, anstatt sie dem gerade vorherrschenden Zeitgeist zu unterwerfen und damit ersetzbar zu machen. In diesem Sinne sollte die Kirche Mut zum christlichen Glauben, Mut zur Theologie entwickeln und der Gesellschaft etwas bieten, über das sie nicht bereits verfügt. Den säkularen Trend wird kaum jemand stoppen können. Menschen treten weiterhin aus der Kirche aus, und die prognostizierten Zahlen verheißen nichts Gutes über ihre Zukunft. Trotzdem ist Kapitulation die falsche Antwort. Und die Kirche kapituliert, wenn sie als letzter Ort der Religion selbst atheistisch wird. Dabei hätte sie in ihrer Wächterfunktion und als Hüterin des Glaubens den Menschen immer noch etwas zu sagen. Sie muss sich nur trauen.
Erste Überlegungen zum Thema des Essays sind zu finden in: Hannah Bethke, Vom Glauben abgefallen. Mut zur Christlichkeit statt Angst vor dem Zeitgeist. Eine Antwort auf die Krise der evangelischen Kirche, Kösel-Verlag, München 2025.