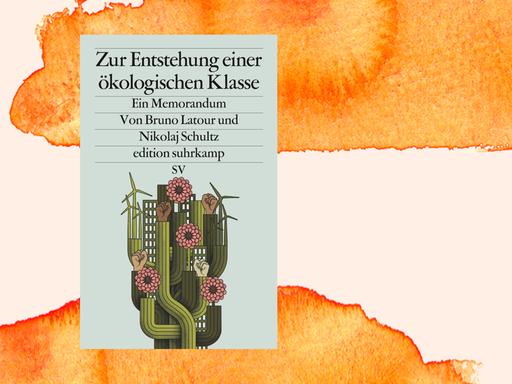Von Resolutionen auf internationalen Klimakonferenzen, über komplizierte parlamentarische Aushandlungen bis hin zum zivilen Ungehorsam der Klimakleber: So richtig scheinen unsere Instrumente, um den Klimawandel zu begrenzen, nicht zu wirken. Derweil wird fleißig weiter CO2 emittiert. Und alle Welt fragt sich, ob eine „Öko-Diktatur“, ein Klima-Leviathan noch abwendbar sein wird, um den Klimawandel einzudämmen.
Bruno Latour hatte einmal die Idee eines Parlaments der Dinge aufgeworfen (und nicht ausgeführt). Ein Gedankengebäude, in dem auch „non-“ oder „more-than-humans“ als Akteure mitwirken. Auch mitentscheiden? Wie sollte das gehen? Da brechen die meisten Überlegungen ab, weil es in einer parlamentarisch-repräsentativen Demokratie kaum denkbar ist, wie nicht menschliche Wesen oder zukünftige Wesen, wie die Generationen, die auf die letzte folgen werden, repräsentiert und damit inkludiert werden können. Aber mal radikal gedacht: Wie können dann die berechtigten Anliegen und Rechte der Natur anders als nur appellativ und symbolisch einbezogen werden?
Claus Leggewie, Jahrgang 1950, ist Professor für Politikwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Von 2007 bis 2017 war er Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen.
Parlament der Dinge heißt der deutsche Titel eines Buchs des vor zwei Jahren verstorbenen Bruno Latour. Nicht allein der französische Wissenssoziologe fragte, ob und wie man nicht-menschliche – wie soll man sagen: Wesen oder Akteure, er nennt sie Aktanten – in demokratische Aushandlungsprozesse einbinden kann und ihnen damit – im übertragenen wie wörtlichen Sinne – eine Stimme gäbe. Das wäre ein auf die Natur erweiterter Gesellschaftsvertrag.
Das „Parlament der Dinge“ ist auch bei ihm eine Metapher geblieben und für Praktiker der Politik ein reines Luftschloss. Will man etwa realiter – also hier und heute, echt und ernsthaft – eine parlamentartige Versammlung menschlicher Akteure und nicht-menschlicher Aktanten einberufen und diesen Zwitter womöglich per Mehrheit entscheiden lassen? Blödsinn, denkt man spontan, eine grüne Schnapsidee. Da plappern doch alle durcheinander, die Nahrungsketten fressen sich an, der Rest ist Schweigen der Wälder und Tiefsee. Wie soll aus diesem babylonischen Leviathan eine konsensbereite Demokratie erwachsen?
Aber andererseits: Reicht ein anthropozentrisch, ganz auf die vermeintliche Krone der Schöpfung, den Menschen, zugeschnittenes Format politischer Entscheidung, um die Probleme der Gegenwart zu bewältigen? Was wäre an der Standardform des Parlaments zu modifizieren oder aufzugeben? Parlamente sind Eckpfeiler der repräsentativen Demokratie. Mit Mehrheit gewählte Volksvertreter diskutieren und verabschieden dort Gesetze, sie stimmen über Staatshaushalte ab, bündeln gesellschaftliche Interessen (in der Regel via Parteien und Verbände), sie rekrutieren politische Eliten, wählen und kontrollieren Regierungen. Dabei geben sie Minderheiten Schutz und der Opposition institutionelle Rechte, womit ein friedlicher Machtwechsel garantiert wird. Ausgehend von elitären Männervolksversammlungen hat diese Idee ihren Siegeszug angetreten – als „Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk“, wie Abraham Lincolns klassische Formel lautete.
Kipppunkte können nicht auf Kompromisse warten
Allerdings stellt sich heute die Frage, ob Parlamente geeignet sind, die dramatisch gewordene „Krise der Natur“ zu bearbeiten. Dass Demokratien resilienter auf Naturkatastrophen reagieren, ist empirisch nachweisbar, ebenso ihre etwas höhere Effektivität und Effizienz im Klima- und Artenschutz. Doch ebenso unverkennbar ist, dass der dilatorische Politikstil, dieses „Auf-die-lange-Bank-schieben“ von Verhandlungsdemokratien mit der zeitaufwändigen Suche nach Kompromissen zwischen widerstrebenden Interessen nicht das Tempo angenommen hat, das die unbestechliche Physik des Klimawandels und die strenge Biochemie des Artensterbens gebieten.
Demokratien stehen unter enormem Zeitstress, die Kipppunkte des Erdsystems scheren sich nicht um Legislaturperioden und Koalitionsverträge. Während technologische Innovationen und wirtschaftliche Investitionen bereitstehen und sich in vielen Gesellschaften ein beachtlicher ökologischer Wertewandel eingestellt hat, blieben die politischen Entscheidungsprozesse schwerfällig. Es ist viel Zeit vertan worden, um dringliche und auch machbare Maßnahmen zur Vorbeugung gefährlichen Klimawandels und der Anpassung an seine Folgen auf den Weg zu bringen. Die rasant sinkende Wahrscheinlichkeit der Einhaltung der „1,5-Grad-Marke“ ist ein Beleg dafür. Und so steht die dunkle Prophetie einer unumgänglichen „Öko-Diktatur“ als Menetekel an der Wand.
Sie ist grundfalsch, aber die Frage bleibt: Welche politischen Innovationen lassen den Freiheitsgehalt liberaler Demokratie intakt und sie in den bevorstehenden Katastrophen nicht dauerhaft in autoritäre Notstandsregime abrutschen? Schafft eine erneute, eine weitere „Demokratisierung der Demokratie“ den Gesellschaftsvertrag mit einer bedrohten und bedrohlichen Natur?
Nähern wir uns dieser konzeptionell und empirisch im Nebel liegenden doppelten Anforderung von zwei Seiten: Aus der politischen Geschichte rekapitulieren wir zunächst, wie vormalige menschliche „Non‑Voice-Partys“ bislang repräsentiert wurden, wie also Stimmen (voices), die nicht zu Gehör kamen (oder überhaupt erst in Zukunft zu Gehör kommen können), in eine zählbare Artikulation (voice) bei Abstimmungen umgemünzt worden sind.
Das übertragen wir dann auf die sogenannte multispecies-Konstellation. So nennt man eine virtuelle Versammlung von Menschen, nicht-menschlichen Lebewesen und unbelebter Natur sowie eventuell „Robotern“ mit künstlicher Intelligenz – unter der Frage, ob und inwieweit diese, genau wie der klassische Demos, in ihrer ganzen Verschiedenheit und Ungleichheit ebenfalls durch die ingeniöse Gleichheitsformel: one man, one vote zusammengehalten wird. Wie sähe ein politisches Gremium aus, das nicht-menschliche Lebewesen einschließt und dank dieser Inklusion womöglich die weitere Bewohnbarkeit des Planeten sichert, die auf herkömmliche Weise in Frage steht?
Zur ersten, der historisch-empirischen Frage: Demokratie hat, darin ähnlich dem Universum, ein Ursprungsproblem: Sie hat sich ohne erkennbaren Schöpfungsakt oder -plan aus einem marginalen Kern stetig ausgebreitet. Das Volk, das sich gegenüber Göttern und Monarchen, Tyrannen und Oligarchen diese unwahrscheinliche Form der Selbstregierung gab, war stets schon vorhanden und musste Ansprüche von Anderen auf Teilhabe zulassen – oder begründet abweisen. Es lag keine eindeutige Meta-Begründung der Mitgliedschaft vor, eher gab es den pragmatischen Pfad eines kaskadenförmigen Einschlusses immer neuer Mitbürger und Mitbürgerinnen.
Formale Voraussetzungen für eine Aufnahme sind neben der Zugehörigkeit zu einem abgegrenzten Gemeinwesen (der Polis) oder dem Besitz einer Staatsangehörigkeit (der Nation) die Fähigkeit potenzieller Mitglieder zu autonomen Willens- und Interessenbekundungen in einer Volksversammlung oder in einer territorialen Einheit von Wahlbezirken. Inhaltlich gibt die Betroffenheit von und die Unterworfenheit unter Entscheidungen der Mehrheit den Ausschlag. Das heißt: Wenn ich etwas tun oder lassen soll, will ich darüber mitentscheiden, erst recht, wenn ich schwerwiegend von Entscheidungen anderer betroffen bin. Hinzu kam ein „weicher“ Faktor: die Zustimmung zu einer Wertegemeinschaft, die eine prospektive Zukunft des Gemeinwesens über die verschiedenen Herkünfte ihrer Mitglieder setzt, wobei auch erklärte Gegner demokratischer Herrschafts- und Lebensweisen zum Demos zählen.
Kampf um politische Gleichheit
Wie konnten seit der Antike und analog in außereuropäischen Gesellschaften „andere“, die nicht zu dem anfänglich privilegierten Zensus wohlhabender, nicht zur täglichen Arbeit verpflichteter Männer zählten, ihre Rechte geltend machen: in der Genderdimension Frauen und queere Personen, in der Sozialstruktur „untere Schichten“ wie Heloten, Sklaven, Arbeiter und sogenannte „Asoziale“, in ethnischer und religiöser Hinsicht Fremde und Andersgläubige, in transnationaler Hinsicht Kolonisierte und Migranten, altersspezifisch dann Jugendliche, biosozial schließlich geistig Behinderte und psychisch Kranke. Alle wurden auf der Grundlage sozialer Anerkennungs- und politischer Repräsentationsforderungen inkludiert und mussten – meist sehr mühsam und voller Rückschläge – ihre volle politische Gleichheit erkämpfen.
Ein Beispiel: Zur Inklusionsdynamik reifer Demokratien gehört erst neuerdings die politische Partizipation von Menschen mit physischen und psychischen Beeinträchtigungen, statuiert im „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“, das die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Dezember 2006 verabschiedet hat. Erst 2021 wurden zehntausende Deutsche mit Beeinträchtigungen erstmals wahlberechtigt, durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach Menschen, die auf eine gerichtlich bestellte Betreuung in allen Angelegenheiten angewiesen sind, nicht pauschal vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen werden dürfen.
Hier wurden Stimmen vernehmlich und wirksam, die bisher überhört wurden. In besonderem Maß gilt das für eine Gruppe, die bis heute als „Taubstumme“ verkannt und diskriminiert wird: Weltweit sind rund 360 Millionen Menschen hochgradig hörbehindert oder gehörlos. Die phonozentrische Welt verneint oder bezweifelt ihre Partizipationsfähigkeit, da sie von der überwiegend sprachlichen Kommunikation ausgeschlossen und somit kein Teil der politischen Öffentlichkeit seien. Dank der Gebärdensprache und Verbundenheit herstellender Erlebnisse und visueller Eindrücke leben sie eben nicht in der Abgeschiedenheit, in die sie Hörende gewollt oder ungewollt verbannen. Das Beispiel demonstriert uns, wie auch „Non-Voice-Akteure“ mit angemessener Unterstützung und Übersetzung eine Stimme bekommen und so am politischen Leben teilnehmen und sich repräsentieren können.
Ein anderer Ansatz, per se vom politischen Prozess ausgeschlossene Personen einzubeziehen, betrifft das von erwachsenen Stellvertretern erdachte indirekte Wahlrecht unmündiger Kinder. Auch dieser Vorstoß liegt in der Logik demokratischer Inklusion, die mit der kontinuierlichen Absenkung des Wahlalters auf unter 21 Jahre eingeleitet worden war. Das Betroffenheitsargument führt nicht so weit, nun auch Zehnjährige an Wahlen und Abstimmungen zu beteiligen, wie es in Kinderparlamenten suggeriert wird, die nebenbei gesagt zeigen, wie gut es manchmal wäre, auf Kinder zu hören. Stattdessen wurde ein stellvertretendes Wahlrecht durch Eltern und Erziehungsberechtigte postuliert, in der Annahme, dass diese auch jenseits ihrer affektiven Verwandtschaftsbeziehung die Interessen der „nächsten Generation“ erkennen und repräsentieren können, die sich zu heute getroffenen Entscheidungen, von denen sie womöglich irreversibel betroffen sein werden, per se nicht artikulieren können.
Der Vorschlag der sogenannten Proxy-Repräsentation „künftiger Generationen“ trifft auf zwei geläufige Gegenargumente: Heute lebende Menschen können erstens nicht wissen, wie die Zukunft sein wird (also auch nicht, wie morgen oder „überübermorgen“ Geborene sie gestalten wollen), und zweitens können sie deren beanspruchte Rechte für ihre eigenen aktuellen Interessen reklamieren und nutzen.
Die Einschränkung des Horizonts und die Gefahr der Instrumentalisierung bestehen. Aber zwei Faktoren relativieren diese Einwände: Erstmals in der Geschichte der Menschheit gestalten Menschen im Anthropozän ihre Umwelt in so massivem Umfang, bis hin zur möglichen Selbstzerstörung, und zweitens bedarf eine daraus folgende verantwortungsethische Sorgepflicht einer institutionellen Verankerung, die demokratisch legitimiert sein muss.
Daraus ergibt sich zunächst abstrakt die Notwendigkeit einer Repräsentation künftiger Generationen. So wie in der Geschichte der Demokratie alle möglichen „Fremden“ inkludiert wurden, weil sie von den Entscheidungen einer schmalen einheimischen Elite betroffen waren, muss dies auch für solche gelten, die morgen von den Entscheidungen einer breiteren Elite betroffen sein werden. Das gilt für die Akkumulation von Schuldenlasten genauso wie für die Entsorgung radioaktiver und ähnlich toxischer Ewigkeitschemikalien wie für die Folgen des Klimawandels und Artensterbens. Angesichts der eminenten Risiken dieser Technologien und Entwicklungen ist die rhetorische Formel der „letzten Generation“ treffend. Künftige Generationen haben prinzipiell keinen geringeren Repräsentationsbedarf als andere „Non-Voice-Partys“.
Nur gestreift werden soll eine heute so brisant gewordene Frage, ob zum Beispiel nur Frauen alle Frauen beziehungsweise nur Angehörige einer Minderheit deren Anliegen insgesamt vertreten können. Dafür spricht das eng ausgelegte Betroffenheitsprinzip, dagegen der Gleichheitsgrundsatz. Die funktionale Differenzierung und sozialstrukturelle Ungleichheit moderner Gesellschaften werden in der parlamentarischen Repräsentation ja aufgehoben, wonach arme weiße Frauen (und auch Männer) die Interessen farbiger Frauen ebenso und eventuell besser vertreten können als reiche farbige Frauen. In demokratischen Republiken sollte jeder Mensch jeden anderen Menschen vertreten können, wobei Abgeordneten das freie Mandat übertragen wird, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden und sie nicht von einer bestimmten Gruppe von Wählern „abgeordnet“ und ihnen allein gegenüber rechenschaftspflichtig sind.
Ziehen wir ein Zwischenfazit: Akteure ohne Stimme, also Non-Voice-Partys, waren als potentiell Repräsentierbare stets vorhanden, wurden aufgrund bestimmter Eigenschaften aber ausgeschlossen; bei entsprechender Mobilisierung und der Bereitschaft der Entscheidungsträger griff die demokratische Inklusionsdynamik, die es heute ganz unverständlich erscheinen lässt, wie man Frauen, Gehörlose, 16- bis 18-Jährige und so weiter einmal nicht inkludieren konnte.
Anders verhält es sich noch bei Angehörigen zukünftiger Generationen, deren riesiger Umfang von bereits geborenen Minderjährigen bis zu Menschen reicht, die erst in 100, 200 oder noch mehr Jahren auf die Welt kommen. Dass sie von aktuellen Entscheidungen betroffen und der Gesetzgebung „ihres“ Staates unterworfen sind, haben wir herausgestellt, auch das daraus erwachsende theoretische Anrecht, auf irgendeine Weise repräsentiert zu sein und irreversible Weichenstellungen beeinflussen zu können. Wenn man so weit ist in der Argumentation, geht es eigentlich nur noch um den Mechanismus dieser Inklusion, die ja weit in die Zukunft reichen soll.
Für Tiere und andere nicht-menschliche Entitäten galt und gilt das alles bekanntlich nicht. Was auf den ersten Blick selbstevident erscheint, wird in letzter Zeit immer mehr bestritten. Philosophen und Philosophinnen wie Sue Donaldson, Will Kymlicka und Martha Nussbaum haben die akademische Debatte zu Tierrechten in eine Forderung nach effektiver Repräsentation der Tierwelt überführt, wobei diese weitgefächerte Fauna eine höchst unterschiedliche Interaktionsdichte mit und Abhängigkeitsverhältnisse von Menschen aufweist. Vor allem Haus- und Nutztiere sollen als Staatsbürger, nicht nur als Schutzbefohlene volle Inklusion in demokratische Gemeinschaften genießen; aber wieso nicht gerade jene, die keinen Schutz von Menschen genießen, sondern deren Verfolgung besonders stark ausgesetzt sind? Oder eine potenzielle Gefahr darstellen, wie sie aktuell an freilaufenden Bären und Wölfen heraufbeschworen wird. Also auch: One animal, one vote?
Keine der üblicherweise genannten Voraussetzungen für Beteiligungen ist – stets aus fraglicher menschlicher Beobachterperspektive! – auf Tiere übertragbar. Doch damit ist das Problem der Repräsentation längst noch nicht erledigt. Denn im Fall von Kindern und Behinderten wurde ja auch nicht länger hingenommen, dass ausgerechnet umständehalber schwache Subjekte, die am stärksten auf Repräsentation ihrer Interessen angewiesen wären, nicht vertreten werden sollen.
Gängig sind bislang Quasi-Repräsentationen: Es gibt Single-Issue-Parteien von Tierschützern und Ombudsleute, es gibt staatliche Beauftragte für bedrohte Tierarten sowie mitgliederstarke Naturschutzverbände und Lobbygruppen. Sie haben sich allesamt selbst das verdienstvolle Mandat gegeben, Tiere zu schützen und deren Interessen zu vertreten. An die Stelle der Autorisierung durch die Repräsentierten selbst tritt die „interpretative“ Selbstautorisierung von Stellvertretern, die zu wissen behaupten, was die von ihnen Vertretenen wollen. In dieser Übertragung von Rechten besteht, wie die virtuelle Einbeziehung von wenig oder noch gar nicht artikulationsfähigen Kindern und künftigen Generationen gezeigt hat, per se kein Systembruch, aber die doppelte Gefahr, dass ein fürsorglich-paternalistisches Verhältnis zu Tieren beziehungsweise deren Vermenschlichung die Menschenzentriertheit des Demos nur verlagert und verstärkt.
Wie auch immer: Allein mit der tentativen Übernahme dieser Perspektive ist bereits ein politischer Kulturwandel verbunden und eine Verschiebung der Repräsentation denkbar: „Nicht die Tiere müssen bestimmte Eigenschaften haben, damit sie repräsentiert werden können, vielmehr müssen ihre Repräsentantinnen über bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, um überhaupt repräsentieren zu können. Sie müssen auf die Bedürfnisse der Tiere eingehen, sich mit ihnen auseinandersetzen und zu verstehen versuchen, worin ihre Interessen bestehen könnten“, so schrieb Svenja Ahlhaus 2014. Dazu zählen empathische Kommunikationsformate bei Tierarten wie Bienen, Rotwild, Schimpansen, Ratten, Tauben, Raben und anderen, die als protodemokratische Elemente einer Teilhabe gewertet werden können. Je intensiver Tiere nun in städtische Umgebungen der Menschenwelt vordringen, desto stärker werden sie normativ einbezogen und ethisch respektiert.
Weiter noch reicht die symbolisch-normative Annahme, mit der Anerkennung von Tieren als Staatsbürgern könne ein „kooperatives soziales Projekt“ entstehen, bei dem, so Donaldson und Kymlicka, „alle als Gleiche anerkannt werden, von den Gütern des sozialen Lebens profitieren dürfen und je nach Fähigkeit und Neigung zum allgemeinen Wohl beitragen können”. Zur politischen Gemeinschaft gehörte dann genuin die Mitgliedschaft und Staatsbürgerschaft von Tieren.
Bei der Frage, ob und wie man in einem nächsten Inklusionsschritt nicht-menschliche Entitäten, darunter auch die Flora und unbelebte Materie, repräsentieren könnte, kann man auf außerwestliche (und lange als Aberglaube verachtete) Kosmologien zurückgreifen, die zwischen menschlichen Wesen und ihrer natürlichen Umwelt keine so starke Hierarchie oder antagonistische Differenz annehmen. „Indigene“ sahen den Kosmos von Beginn an nicht nur als Heimat aller Erdenbürger, sondern bezogen die natürliche Umwelt und die Konstellation des Planeten Erde im Universum ein. Ebenso exemplarisch respektierte ein Alexander von Humboldt die nicht‑menschliche Natur und ordnete sie der Menschenwelt nicht unter; animistische und schamanistische Konzepte des Kosmos sind nicht länger als Irr- und Aberglauben abzutun. In dieser doppelten Engführung wird das symbolische Konstrukt eines Parlaments der Dinge denkmöglich für die Herausbildung einer „planetaren Demokratie“.
Noch einmal zurück: Wie wurde die erkennbare und unbestreitbare Repräsentationslücke denn bisher gefüllt? Im Dezember 2022 trafen sich in Kanada unter der turnusmäßigen Präsidentschaft der Volksrepublik China nicht weniger als 15.000 Vertreter der Politik, Zivilgesellschaft und Medien aus über 190 Staaten zum jüngsten „Weltbiodiversitätsgipfel“; an den letzten Tagen trafen Minister und Ministerinnen der Staaten ein, welche die Biodiversitätskonvention seit ihrer Verabschiedung in Stockholm im Jahr 1992 unterzeichnet haben, um ein vorzeigbares Ergebnis zum globalen Artenschutz auszuhandeln.
Wir betrachten diesen Fall, weil er einem Parlament der Dinge oberflächlich am nächsten kommt: Die menschlichen Teilnehmer haben in großen und kleinen Sälen an Tischen Platz genommen und beraten über das Schicksal nicht anwesender, aber visuell repräsentierter „bedrohter Arten“, genauer: von bedrohten Tieren und ihren Lebensräumen in Waldgebieten, Gletscherzonen, Flussbetten, Ozeanen, Moorlandschaften und so weiter. Deren „Interessen“ vertreten anwesende Sprecher aus Nichtregierungsorganisationen, der Wissenschaft, der Advocacy-Gruppen, Stewards und dergleichen. Man kann diese Konstellation als eine virtuelle Gemeinschaft menschlicher und nicht-menschlicher Akteure ansehen, wie es auch das Logo der Veranstaltung zeigen sollte.
Haben wir genug politische Fantasie für eine „extended version“ dieses Weltparlaments der Arten, bei der letztere nicht allein auf die antizipierende und advokatorische Darlegung ihrer vermeintlichen Interessen zurückgeworfen wären, sondern ihre „Stimmen“ auf direktere Weise zur Geltung kämen? Wie anders würden Weltkonferenzen zur Eindämmung von Klimawandel und Biodiversitätsverlust agieren, an deren Beratungen und Entscheidungen nicht-menschliche Wesen beteiligt sind? Wie würde sich eine solche Erweiterung inhaltlich und prozessual von den Versammlungen in Paris 2015 und Montreal 2022 unterscheiden?
Wenn die bestehenden Klima- und Biodiversitäts-Regime den drohenden Kollaps nicht abzuwenden vermögen und eine allein auf die menschliche Vernunft setzende Politik so offensichtlich scheitert, dann muss der Radius demokratischer Inklusion erweitert werden und sollten nicht-menschliche „Non-Voice-Partys“ eine Stimme bekommen, womit nicht länger (ich zitiere den Geo-Soziologen Markus Schroer) „Steine wegen ihrer physiognomischen Ausdrucksstarre, Pflanzen wegen ihrer mangelnden Beweglichkeit und Tiere wegen ihrer mangelnden Sprachfähigkeit aus dem Bereich des Sozialen und des Gesellschaftlichen ausgegliedert“ werden dürften.
Wenn aber eine Konferenz unter aktiver Mitwirkung von „more-than-humans“ keine Kinderfantasie bleiben soll, stellen sich eine Menge ungelöster Fragen: Wie erhalten solche Akteure Zutritt in ein erweitertes Parlament? Wie artikulieren sie sich dort direkt oder indirekt? Werden sie auf parlamentarische Weise vertreten oder repräsentieren sie sich selbst (und andere)? Ist ein derart erweitertes Parlament auf die deliberative Unterstützung von Entscheidungen oder auch auf Gesetzgebung ausgelegt, wie werden per Mehrheit oder Konsens oder sonstwie Beschlüsse herbeigeführt? Wie entstehen thematische Prioritäten, wie Formalitäten einer Tagesordnung, eine „Rednerliste“ und „Geschäftsordnung“ mit Wesen, die menschlicher Zeichensysteme nicht mächtig sind? Wie erlangt ein derartiges Parlament generell Legitimität? Wie verhält es sich zu Resultaten wissenschaftlicher Forschung und Expertise, wie zu naturethischen Dilemmata und wirtschaftlichen Nutzenkalkülen? Wie also steht dieses beratende und gesetzgebende Parlament zu den Gewalten der Exekutive und Judikative?
Mehr Fragen als Antworten, für die auch Latour, dieser quecksilbrige Geist, kein Rezeptbuch hinterlassen hat, eher Gedankenblitze, Kurzschlüsse und Übersprungsreaktionen. Beim Parlament der Dinge dachte er nie, dass sich da „Dinge“ wie Tiere, Steine, Artefakte, Maschinen und so weiter zur Beratung in ein Parlamentsgebäude begeben sollten, was in seinen Augen nur eine weitere „Ver‑Ding-lichung“ darstellen würde. Mit „things“ hatte er Thingstätten vor Augen, an denen sich germanische Stammesgesellschaften meist im Freien zu festgelegten Zeiten versammelten, um ihre Streitsachen zu besprechen, Gericht zu halten und verbindliche Entscheidungen zu treffen. „Lange bevor es ein aus der politischen Sphäre hinausgeworfenes Objekt bezeichnete“, schrieb er, „das dort draußen objektiv und unabhängig stand, hat so das Ding oder Thing für viele Jahrhunderte die Sache bezeichnet, die Leute zusammenbringt, weil sie sie entzweit.“
An diesem eher verblüffenden historischen Modell (gewöhnlich wird ja eher die antike Polisdemokratie aufgerufen) entwickelte Latour einen konfliktsoziologischen Ansatz für einen „rekonstruktiven“ Modus der Politik im Horizont einer gemeinsamen Welt. „Dinge“ sind dann alle denkbaren Streitgegenstände, die heute übrigens häufig als „Grün-Grün-Konflikte“ auftreten, wie beispielsweise der Protest indigener Samen in Norwegen, die ihre Rentier-Populationen durch einen Windpark bedroht sehen.
Eine demokratische Versammlung, die nicht-menschliche Wesen per se ausschließt, verharrt diesen gegenüber im Zustand einer absoluten Monarchie, in welcher der Mensch als „Krone der Schöpfung“ allein herrscht. Dieser Zustand hat sich bislang bestenfalls zur „aufgeklärten Monarchie“ verbessert, indem „Naturrechte“ nicht allein auf die menschliche Existenz bezogen bleiben, sondern wenigstens romantisch‑appellativ an weitere natürliche Entitäten verliehen werden. Durch die Verankerung von Schutzpflichten für die Natur wäre dann der Zustand einer konstitutionellen Monarchie erreicht, die den Alleinherrschaftsanspruch der menschlichen Spezies einschränkt und einen durch Menschen advokatorisch wahrgenommenen Weg der Klage und Gesetzgebung einschlägt.
Geht noch mehr? Erkenntnis- und demokratietheoretisch haben wir es mit einem „wicked problem“, einem verzwickten, unlösbar scheinenden Problem zu tun: Was macht eine planetare Entität aus und wie lassen sich planetare Entitäten sortieren? Die Denkschule der sogenannten Assembly Theory schlägt eine Abstufung nach dem Komplexitätsgrad der jeweiligen Entität vor. In diesem Sinne könnte man belebte von unbelebter Materie unterscheiden.
Die demokratietheoretische Frage lautet, welche speziellen Fähigkeiten und Vermögen welche Art und Form der Partizipation erlauben. Nach den Maßstäben menschlicher Intelligenz oder menschlichen Bewusstseins wären das: Common sense, Emotionalität, Fähigkeiten zur Argumentation, Artikulation, Kommunikation und Kooperation. Auch hier zeigt uns die biologische Forschung ganz erstaunliche Ergebnisse, wie klug nämlich eine Spezies untereinander kommuniziert und wie intelligent Schwärme kommunizieren, wie empathiefähig unterschiedliche Spezies im Austausch sind, und wie orchestriert alle Spezies auf die Einflüsse von Magnetismus, Gravitation und Vibration reagieren. Wenn sämtliche Beteiligte gehört werden sollen, wären das im Fall der Erderwärmung auch Gletscher, Regenwälder und flache Inseln, beim Biodiversitätsverlust Libellen, Dugongs und Rotkopfwürger. Und bei all dem wird künstliche Intelligenz eingesetzt werden, die ihrerseits eine elektronische Persönlichkeit haben beziehungsweise sein könnte.
Was für ein Panorama tut sich da auf, vor den Lebenswissenschaften und vor uns, dem staunenden Publikum!