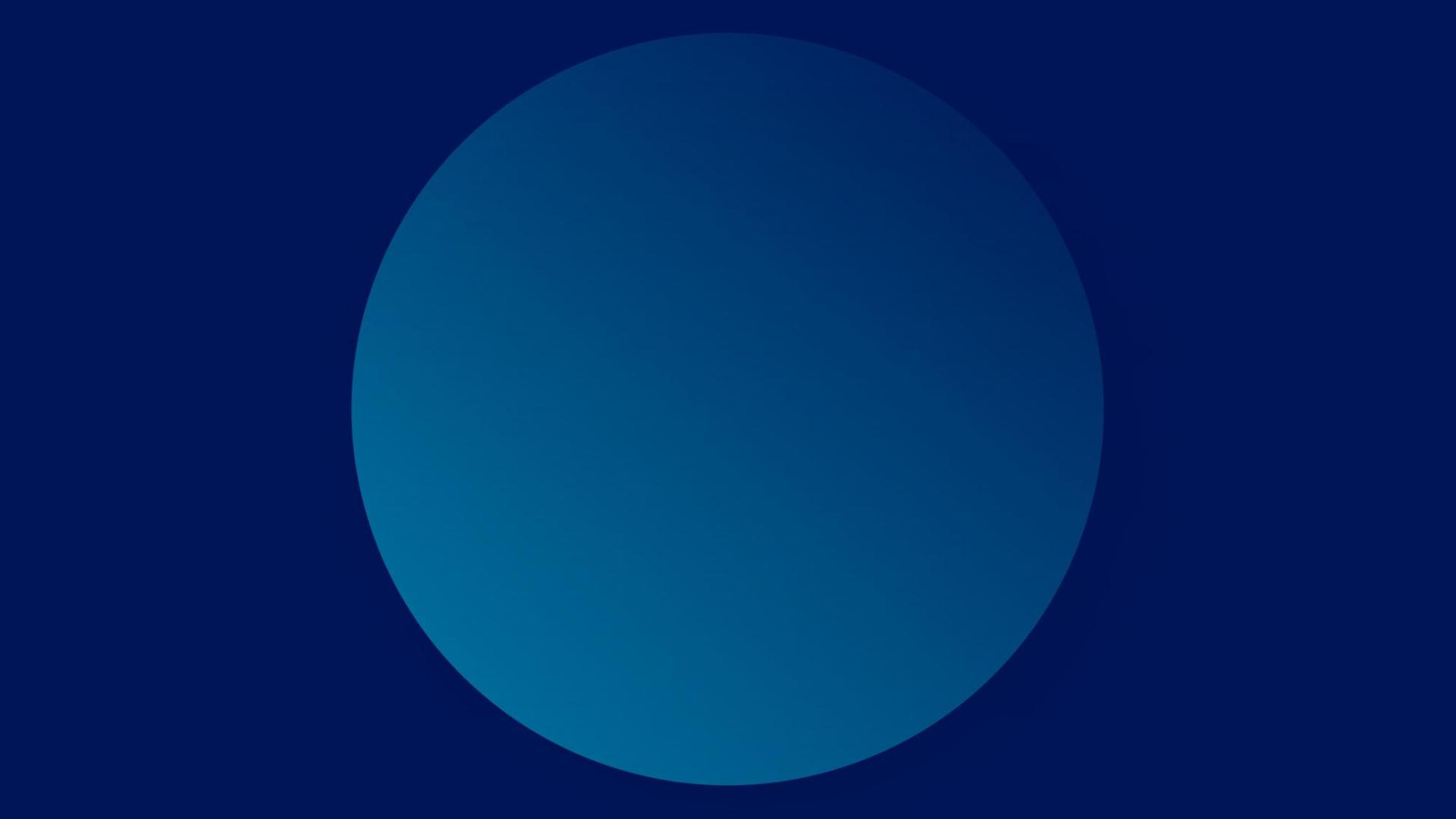Der Bundestag hat dem milliardenschweren Schuldenpaket für Verteidigung und Infrastruktur von Union und SPD am 18. März mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit zugestimmt. Drei Tage später folgte der Bundesrat und billigte die dafür nötigen Grundgesetzänderungen. Die Beschlüsse gelten als Weichenstellung für die künftige Regierungspolitik in den Bereichen Finanzen, Sicherheit, Infrastruktur und Recht. Eilanträge von Bundestagsabgeordneten gegen die Abstimmung zur Schuldenbremse und zum Sondervermögen wies das Bundesverfassungsgericht zurück. Die weiteren Koalitionsverhandlungen zwischen Sozialdemokraten, CDU und CSU dürften dennoch nicht einfach werden.
Finanzpaket
Nachdem der Bundestag noch in alter Zusammensetzung das historische Milliardenpaket für Verteidigung und Infrastruktur beschlossen hatte, stimmte am 21. März 2025 auch der Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit für die Änderung von vier Artikeln des Grundgesetzes. Im Detail geht es um folgende Punkte:
Die Schuldenbremse - die der Neuverschuldung des Bundes enge Grenzen setzt - soll für Ausgaben in Verteidigung, Zivilschutz, Nachrichtendienste und Cybersicherheit gelockert werden. Dazu zählt auch die Unterstützung von völkerrechtswidrig angegriffenen Staaten, etwa die Ukraine. Für alle Ausgaben in diesen Bereichen, die ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts überschreiten, dürfen Kredite aufgenommen werden.
Außerdem wird ein Sondervermögen geschaffen, für das die Schuldenbremse nicht gilt und das mit Krediten bis zu 500 Milliarden Euro gefüttert wird. Daraus soll die Instandsetzung der maroden Infrastruktur bezahlt werden. 100 Milliarden Euro sollen an die Länder gehen, weitere 100 Milliarden Euro sollen fest in Klimaschutz und den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft fließen. Außerdem soll das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 ins Grundgesetz kommen. Die Klima-Punkte waren Bedingungen der Grünen für eine Zustimmung im Bundestag.
Migrationspolitik
Nach den Anschlägen in Magdeburg, Aschaffenburg und München dominierte die Migrations- und Asylpolitik den Bundestagswahlkampf – und hier könnte es auch in den nun anstehenden Koalitionsverhandlungen noch einigen Streit geben.
Im Sondierungspapier verständigten sich Union und SPD unter anderem darauf, dass es "in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen" geben könne. Die Parteien wollen alle rechtsstaatlichen Maßnahmen ergreifen, "um die irreguläre Migration zu reduzieren". Auch eine "Rückführungsoffensive" ist geplant. Der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten soll befristet ausgesetzt werden.
Laut durchgestochenen Zwischenergebnissen der Koalitionsverhandlungen hat man sich auf einen Passus geeinigt, der Zurückweisungen an den Grenzen in Absprache mit den europäischen Partnern ermöglichen will. Doch hier herrscht weiter viel Interpretationsspielraum, wie die Diskussionen zwischen CDU und SPD vor den Verhandlungen zeigten.
So sagte Jens Spahn (CDU), "Abstimmung" erfordere nicht Zustimmung, notfalls könne auch gegen den Willen der Nachbarländer gehandelt werden.
SPD-Co-Chefin Saskia Esken interpretiert die Passage im Sondierungspapier hingegen strenger. "Wir haben was anderes vereinbart, und dabei bleiben wir auch", sagte sie mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen.
Eine Zurückweisung von Menschen an der bundesdeutschen Grenze verstoße - selbst in Absprache mit den jeweiligen Nachbarländern - gegen das Europarecht, teilte die Organisation Pro Asyl mit.
Bürgergeld, Mindestlohn und Steuerpolitik
Recht unterschiedliche Vorstellungen hatten CDU/CSU und SPD im Wahlkampf auch bei der Sozialpolitik. Nunmehr verständigten sich die Parteien im Sondierungspapier darauf, dass das bisherige Bürgergeldsystem zu einer Grundsicherung für Arbeitssuchende mit weniger Einzelleistungen umgewandelt werden soll.
Über den gesetzlichen Mindestlohn soll weiterhin eine "starke und unabhängige Mindestlohnkommission" entscheiden, heißt es im Sondierungspapier. "Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar."
Allerdings könnte zwischen Union und SPD noch hart um die gemeinsame Linie in der Sozialpolitik gerungen werden. Generalsekretär Matthias Miersch räumte ein, die Sondierungen seien bereits "nicht ganz einfach" gewesen. Die Koalitionsverhandlungen könnten durchaus auch scheitern - zumal am Ende die Parteibasis entscheide.
In der Steuerpolitik soll die "breite Mittelschicht" laut Sondierungspapier entlastet werden. Geplant ist eine Reform der Einkommensteuer. Außerdem soll die Pendlerpauschale in der Steuererklärung erhöht werden. Eine Unternehmenssteuerreform ist geplant. An diesen Punkten sind die bisherigen Vereinbarungen eher allgemein, weshalb in den Koalitionsverhandlungen noch viel Arbeit ansteht.
Energie, Landwirtschaft und Verbraucher
Das Energieangebot soll gesteigert werden - wobei vage bleibt, wie das kurzfristig gelingen könnte. Der Bau neuer Gaskraftwerke ist geplant. Bei den Energiekosten soll die Stromsteuer um fünf Cent pro Kilowattstunde "auf das europäische Mindestmaß" gesenkt werden. Das Bekenntnis zu den deutschen Klimazielen ist im Sondierungspapier enthalten, aber es gibt nur wenige Maßnahmen, mit denen dieses Ziel auch hinterlegt wird.
Den Landwirten wollen Union und SPD "den Rücken stärken". Deshalb soll die Agrardiesel-Rückvergütung wieder vollständig eingeführt werden. Um Gastronomie und Verbraucher zu entlasten, soll die Umsatzsteuer für Speisen dauerhaft auf sieben Prozent sinken.
Weitere Themen: Von der Cannabis-Legalisierung bis zum Deutschlandticket
Das Cannabis-Gesetz der Ampel oder die Wahlrechtsreform - beides wollte die Union eigentlich wieder rückgängig machen - spielten bei den Gesprächen bisher offenbar keine zentrale Rolle. Zum Wahlrecht heißt es im Sondierungspapier sehr knapp: "Wir prüfen eine erneute Reform". Die Mietpreisbremse wollen die möglichen zukünftigen Koalitionäre "zunächst für zwei Jahre verlängern".
Aus der SPD kommen einem Bericht zufolge mit Blick auf die laufenden Koalitionsverhandlungen Warnungen an die Union vor einem Stopp der Krankenhausreform. Die „Bild“-Zeitung berichtete unter Berufung auf Verhandlungskreise, dass Unionspolitiker verhindern wollen, dass viele Krankenhäuser künftig geschlossen werden müssen. Dazu wollten sie die Klinikreform anpassen. Das wiederum treffe auf den Widerstand der SPD-Verhandler. Das von der Ampel-Koalition reformierte Staatsangehörigkeitsrecht soll weiter Bestand haben.
Aus durchgestochenen Papieren der Koalitionsverhandlungen geht bereits hervor, dass das Deutschlandticket bestehen bleiben soll, allerdings ab 2027 teurer wird. Laut den Papieren soll auch die Bahn strukturell anders aufgestellt und nicht zerschlagen werden, wie es die CDU gefordert hatte. Außerdem soll die Autobahn GmbH begrenzt kreditfähig werden.
lkn, cp, tei, jfr, tha, aha, nm