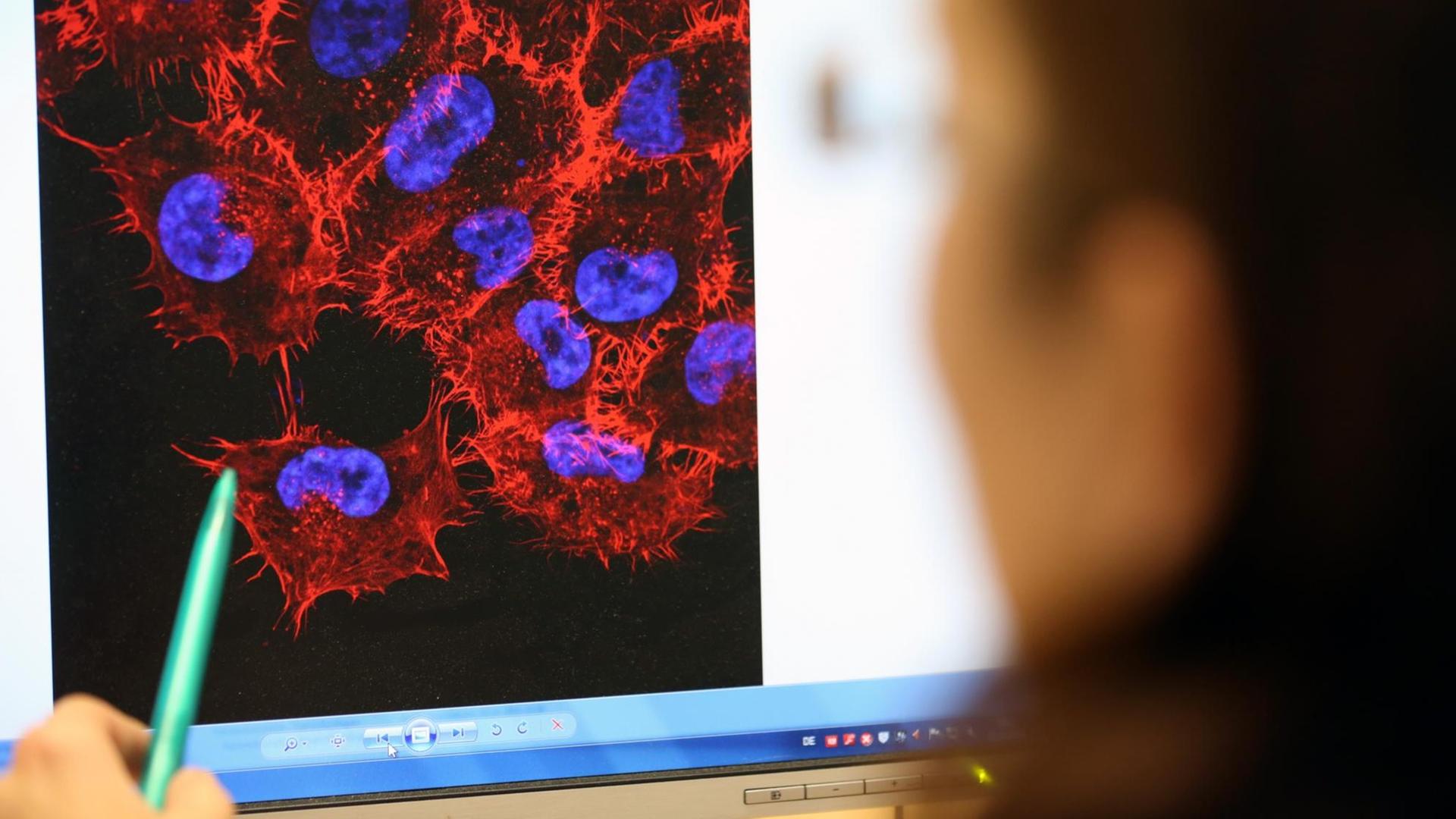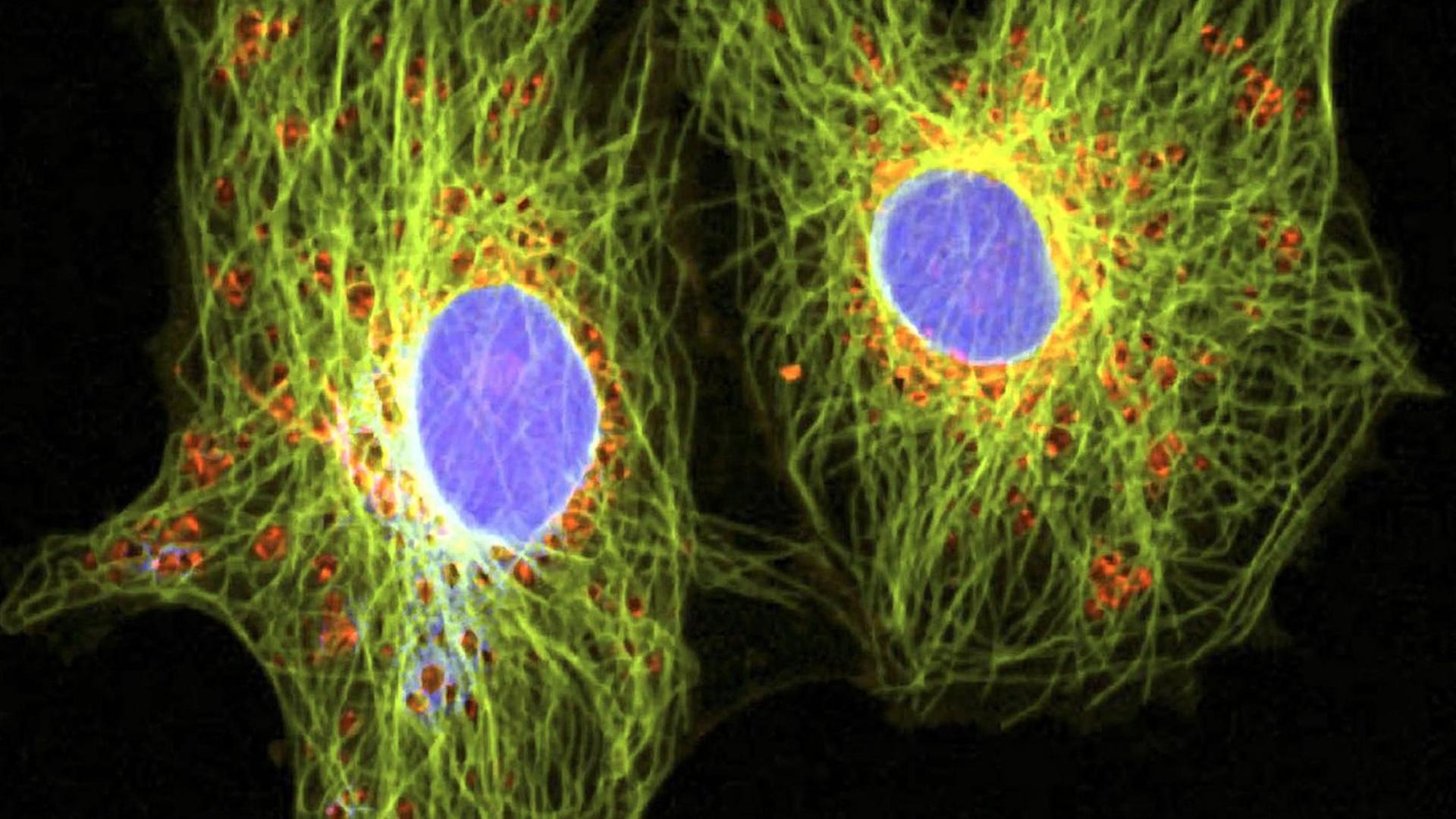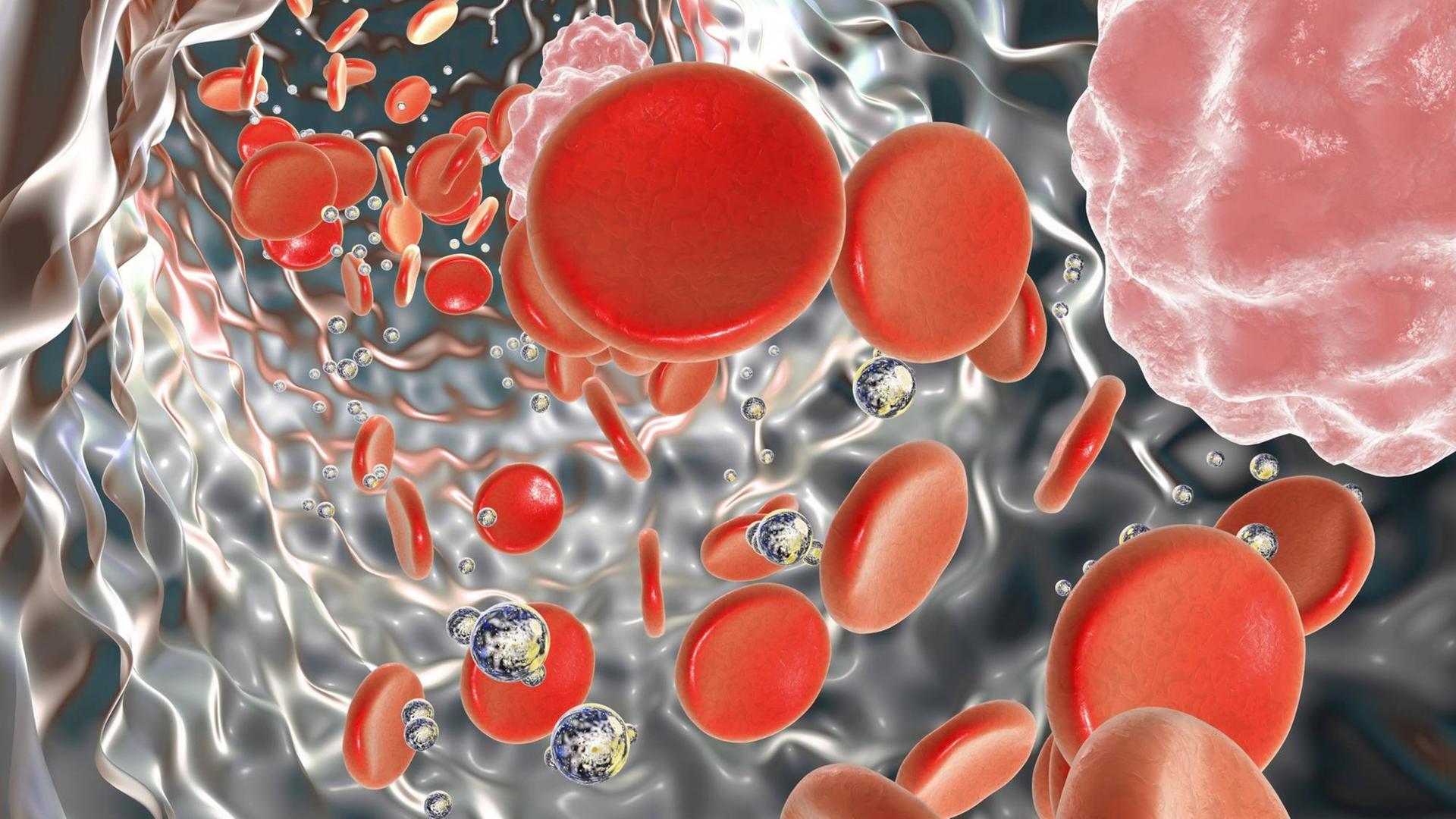Mario Dobovisek: Morgen ist Weltkrebstag, und ich spreche jetzt mit Karl Lauterbach, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag, dort für Gesundheitsthemen zuständig. Er ist auch Gesundheitsökonom an der Universität in Köln und warnt unter anderem mit seinem Buch „Die Krebsindustrie“ vor einer Kostenlawine. Guten Morgen, Herr Lauterbach!
Karl Lauterbach: Guten Morgen!
Dobovisek: Neue Therapien, Forschung, Entwicklung, dann die Produktion und der Vertrieb von Medikamenten zum Beispiel, wir haben gehört, wie aufwendig das sein kann. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für Krebsarzneien in Deutschland haben allein in den vergangenen fünf Jahren um 30 Prozent zugenommen, von 3,8 Milliarden Euro in 2012 auf zuletzt rund sechs Milliarden Euro. Für neue Krebstherapien werden immer höhere Preise verlangt, bis zu 100.000 Euro pro Patient und Jahr – ist das noch angemessen, Herr Lauterbach, oder einfach nur noch Wucher der Pharmaindustrie?
Lauterbach: Es ist in Teilen angemessen, aber es ist sehr häufig auch Wucher. In der Tat gibt es bei einigen Krebserkrankungen mit diesen gezielten Therapien große Durchbrüche, zum Beispiel beim schwarzen Hautkrebs und auch bei verschiedenen Formen des Nierenfellkrebses. Allerdings lassen sich die Ergebnisse bei anderen häufigeren Krebsarten leider nicht reproduzieren, auch dort kommen die Medikamente aber bereits zum Einsatz, haben dort zum Teil sehr viel weniger Wirkung. Dort wird die Lebenserwartung oft nur für wenige Monate verlängert, beim schwarzen Hautkrebs kann es sich um viele Jahre handeln. Somit will ich es mal wie folgt sagen: Wenn man die Medikamente jetzt sehr eng einsetzt, genau dort, wo sie benötigt werden, nach einer gründlichen Analyse der Fälle vorab, dann ist das richtig, dann sind auch die hohen Preise gerechtfertigt. Aber der Einsatz in der Fläche kann eine Verschwendung sein, die den Patienten oft auch mehr schadet als nutzt, weil wenn das Medikament nicht genau richtig eingesetzt wird, hat man nur die Nebenwirkungen, die zum Teil gravierend sind, und die Kosten, aber keinen Gewinn.
„Das deutsche System ist eines der allerteuersten für diese Medikamente“
Dobovisek: Bleiben wir bei den hohen Kosten – warum sind denn Krebsmedikamente in Deutschland zum Beispiel teurer als oftmals bei den Nachbarn, zum Beispiel in den Niederlanden?
Lauterbach: Na ja, bei diesen Krebsmedikamenten, über die wir gerade reden, gehen die Pharmafirmen hin und überlegen, was gibt das System dort gerade noch her, also welchen Preis können wir maximal verlangen.
Dobovisek: Das deutsche System kann man ganz gut melken aus Sicht der Pharmaindustrie.
Lauterbach: Das deutsche System ist neben dem amerikanischen System eines der allerteuersten gerade für diese Medikamente. Dort wird preisdiskriminiert, das heißt, tatsächlich überlegen sich die Pharmafirmen, wie viel kann ich aus dem System herausquetschen, welchen Preis kann ich so gerade noch verlangen, und sie versuchen dann sehr häufig auch, das Wirkprofil der Medikamente zu übertreiben, sodass es nach mehr aussieht, als es ist.
„Diese Preise könnten das System sprengen“
Dobovisek: Sie stehen seit Jahren, Herr Lauterbach, mit der SPD in politischer Verantwortung, warum ändern Sie das nicht?
Lauterbach: Zunächst das, was wir gerade beschrieben haben, diese sehr teuren Krebsmedikamente – tausend Patienten zu behandeln, kann dann also in Teilen bis zu 100 Millionen Euro kosten. Das haben wir erst seit wenigen Jahren. Wir haben vorher auch schon hohe Pharmapreise gehabt, aber diese Preise könnten, wenn sie flächendeckend um sich greifen, das System sprengen. An dem Problem arbeiten wir sehr intensiv, aber der Ehrlichkeit halber muss man sagen, die ersten dieser Medikamente, die so teuer sind, sind in den letzten zwei, drei Jahren auf den Markt gekommen. Wir stehen jetzt aber vor einem großen Problem, was wir lösen müssen.
Dobovisek: Diese Woche wurde eine Studie veröffentlicht von Wissenschaftlern aus London, nach der die Lebenserwartung mit einer Krebsdiagnose auch vom Land abhängt, in dem ich wohne, da gibt es auch Unterschiede innerhalb der Europäischen Union. So haben Patienten demnach in Dänemark zum Beispiel bessere Chancen zu überleben als in Deutschland. Was machen die Dänen besser als wir in Deutschland?
Lauterbach: Es ist tatsächlich so, dass einige Länder sehr stark davon profitieren, die Behandlung bei Krebs zu zentralisieren. Es gibt kaum eine Krankheit, wo das Ergebnis so stark davon abhängt, wie viel Erfahrung das Team hat, wie bei Krebserkrankungen. Und in Deutschland ist es leider so, dass wir ehrlich gesagt zu viele Krankenhäuser haben, die sich die Krebsbehandlung auch sehr fortgeschrittener Krebsfälle bei Patienten zutrauen – das hat zum Teil auch ökonomische Gründe. Und damit haben wir nicht die Qualität in allen Fällen, die wir haben könnten. Der Patient kann es auch nicht richtig einschätzen, er denkt, er bekommt die optimale Behandlung, er kann ja vom Auftreten der Klinik und auch vom Auftreten des Ärzteteams nicht ableiten, wie gut sind die da wirklich. Wir wissen aber, dass zum Beispiel Einrichtungen wie das Deutsche Krebsforschungszentrum oder auch andere Universitätskliniken oder Netze, die sich spezialisiert haben, ganz andere Ergebnisse bekommen bei fortgeschrittenem Krebs, als dass also kleinere Häuser, die das nicht so oft haben, bekommen. Das ist in Ländern wie Dänemark stärker zentralisiert, und daher bekommt man da bessere Ergebnisse.
Dobovisek: Auch das könnten Sie ja politisch ändern, Herr Lauterbach. Wer hat denn mit Krebs hierzulande in Deutschland eine bessere Aussicht auf Heilung, ein Kassen- oder ein Privatpatient?
Lauterbach: Man kann zunächst einmal sagen, dazu gibt es keine guten Studien, das heißt, dass was ich hier sage, entspricht meiner Beobachtung und Abschätzung, es gibt dafür keine wirklich harten Daten. Ich habe in dem Bereich viel geforscht, aber es ist tatsächlich so, es gibt keine gute Studie, was übrigens schon für sich schon ein großer Fehler ist, und wir müssen da dringend auch die Forschung auch verbessern. In der Tendenz ist es natürlich wie folgt: An einen Spezialisten heranzukommen, beispielsweise in einer Universitätsklinik, der sich auf eine bestimmte Krankheit spezialisiert hat, das gelingt als Privatpatient natürlich mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit als einem gesetzlich Versicherten. Der gesetzlich Versicherte muss in der Regel das lokale Angebot nehmen, weil die Spezialisten können sich natürlich die Patienten aussuchen, und sie verdienen deutlich besser, wenn sie sich auf privat Versicherte konzentrieren. Wir haben leider nicht so viele Spezialisten, daher wäre es eigentlich besser, dass wir diese Spezialisten für die schwersten Fälle einsetzen …
„Zweiklassenmedizin ist durch Studien nicht klar belegt“
Dobovisek: Aber halten wir fest, Herr Lauterbach, es gibt sie nicht, zumindest nicht nachweisbar, die Zweiklassenmedizin, gegen die Sie ja bei den Koalitionsverhandlungen mit der Union so leidenschaftlich kämpfen.
Lauterbach: Die Zweiklassenmedizin ist durch Studien hier nicht klar belegt, das muss man so einräumen, aber es ist von der klinischen Beobachtung Folgendes zu sagen, wir wissen Folgendes: Wir wissen von Zentren für Krebsbehandlung, dass diese bessere Ergebnisse haben als keine spezialisierten Kliniken, und wir wissen, dass der Anteil der Privatpatienten in diesen Zentren viel, viel höher ist. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die privat Versicherten, die dort behandelt werden, die guten Ergebnisse der Zentren haben. Es ist so, dass die Zentren schwerpunktmäßig privat Versicherte behandeln, zumindest weit überproportional, und darin dürfte ein großer Vorteil für den privat Versicherten liegen.
Dobovisek: Jetzt liegt die Bürgerversicherung, die Sie ja so gerne wollen, schon lange nicht mehr auf dem Tisch der Koalitionsverhandlungen, das ist mit der Union nicht zu machen. Jetzt reden Sie über das Angleichen von Ärztehonoraren – wie soll das funktionieren?
Lauterbach: Wenn wir eine gemeinsame Honorarordnung hätten, dann würde es natürlich keinen Unterschied mehr machen, ob der Patient gesetzlich oder privat versichert ist, das heißt, dann könnten Ärzte, Spezialisten sich auf die schweren Fälle konzentrieren, egal wie sie versichert sind, und würden dann an den schweren Fällen besser verdienen als an den leichten. Somit wären dann plötzlich die schweren Fälle eines gesetzlich Versicherten lukrativer als die leichten Fälle eines privat Versicherten, und dann würde sich natürlich etwas ändern.
Dobovisek: Jetzt wollen die Ärzte wohl kaum auf die hohen Privathonorare verzichten, also müssten im Umkehrschluss die Kassenhonorare deutlich angehoben werden. Wer soll das am Ende bezahlen?
Lauterbach: Zunächst, es wären dann ja nicht die Honorare für die gleichen Leistungen, sondern die gesetzlich Versicherten bekämen dann ja auch bessere Leistungen. Es ist ja nicht nur so, dass die gleiche Leistung dort anders bezahlt wird, sondern die Leistungen sind ja auch umfänglicher. Zum Beispiel diese Gentests werden bei gesetzlich Versicherten im Ausnahmefall auf Label bezahlt, also im Ausnahmefall eben nur, und bei privat Versicherten ist das die Regel. Das heißt, der gesetzlich Versicherte würde dann etwas mehr bezahlen, aber es ist falsch, wie ich es immer wieder höre, dass dann die gleiche Leistung teurer würde. Es würde dann der gesetzlich Versicherte auch eine bessere Medizin bekommen, dass die etwas mehr kostet, ist klar.
Dobovisek: Dann steigen die Beitragssätze von jetzt im Schnitt 15 auf 17 Prozent des Einkommens?
Lauterbach: Das halte ich für völlig abwegig. Zunächst einmal, wenn man die Honorarsysteme angleichen würde, kostet das etwa fünf Milliarden, dafür kämen zum Beispiel auch Steuermittel infrage, weil natürlich …
„Gerecht, dass auch Steuermittel herangezogen werden“
Dobovisek: Auch die müssen ja irgendwo herkommen.
Lauterbach: Ja, aber ich sage mal, eine bessere Medizin für 90 Prozent der Patienten lässt sich nicht bezahlen, ohne dass ich etwas mehr ausgebe für diese Versorgung, und ich hielte es für gerecht, dass dort auch Steuermittel herangezogen werden, weil es ist eine gesamtökonomische Aufgabe für uns, den Menschen die gleiche, und zwar die optimale Behandlung bei solchen Erkrankungen zu finanzieren.
Dobovisek: Ist das eine Bedingung für Sie, der Großen Koalition zuzustimmen?
Lauterbach: Wir sind ja in Verhandlungen, von daher werde ich keine Bedingungen formulieren, aber es ist ganz klar, dass wir hart verhandeln, auch heute wieder.
Dobovisek: Das sagt der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach im Interview mit dem Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen, Herr Lauterbach!
Lauterbach: Ich danke Ihnen!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.