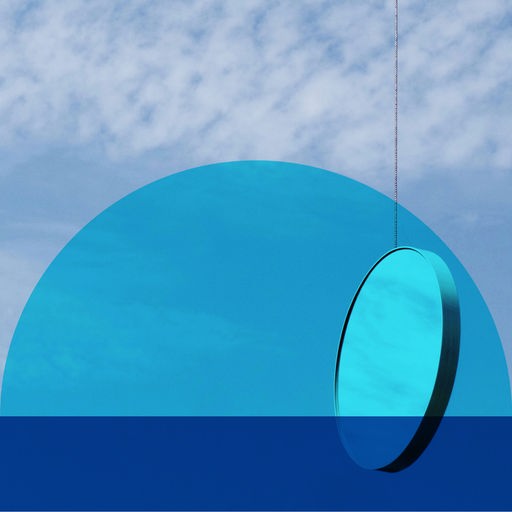Jörg Biesler: Die Bilderflut ist mittlerweile geradezu sprichwörtlich. Wo wir gehen und stehen, umgeben uns Bilder, auf Bildschirmen, Werbetafeln und Zeitschriften, auch die Titelseiten seriöser Tageszeitungen kommen heute, anders als noch vor einem Jahrzehnt, nicht mehr aus allein mit Worten. Und das Netz ist natürlich eine Bildermaschine endzeitlicher Dimension. Trotzdem sehen wir viele Bilder nicht. Die Gier nach immer neuen visuellen Eindrücken aus allen Teilen der Welt, vor allem von dort, wo Nachrichtenwertes geschieht, macht Halt vor dem, was doch eigentlich den Kern dieses Geschehens ausmacht: Das Grauen, das sehen wir nicht, nirgendwo.
Der Fotograf Christoph Bangert hat es gesehen und sieht es, wenn er aus Krisen- und Kriegsgebieten berichtet. Sein Buch "War Porn", in dem er uns zu Zuschauern von Folter, Leid und Tod macht, zeigt all das, was wir beim Frühstück nicht sehen wollen und vor dem wir auch sonst gern die Augen verschließen. Guten Tag, Christoph Bangert!
Christoph Bangert: Hallo!
Biesler: Sie leben in Köln mit Ihrer Familie, Sie berichten mit der Kamera aus Gegenden, in die normale Menschen gar nicht kommen, auch besser gar nicht fahren sollten, in denen es gefährlich ist, lebensgefährlich unter anderem. Das sind zwei Leben, die Sie führen, oder?
Bangert: Ja, auf jeden Fall, das ist so ein Spagat und das ist nicht einfach, das Privatleben mit dem Beruflichen zu vereinbaren.
Biesler: Man stellt sich natürlich, wenn man jemandem gegenübersitzt, der so arbeitet wie Sie, zunächst wirklich die Frage: Wie kommt man darauf, warum will man das machen, warum begibt man sich freiwillig in die Gefahr?
Bangert: Ja, die Frage wird mir oft gestellt und es ist nicht so einfach, sie zu beantworten. Das ist so eine Mischung aus Gründen, warum meine Kollegen und ich diese Arbeit machen. Wenn man jung ist, Mitte 20, hat man eigentlich die größte Angst davor, dass man ein langweiliges Leben führen könnte, so wie die eigenen Eltern vielleicht, und man will so was machen, was ganz ungewöhnlich ist, und man sucht nach einer Bedeutung, man sucht nach etwas Großem. Und macht sich dann auf in den Kick.
Und somit ist eigentlich ein Teil der Motivation, warum Journalisten in diese Gebiete fahren, nicht so viel anders als die Motivation von jungen Soldaten, die in den Krieg ziehen. Darüber hinaus ist natürlich der zweite Grund, eine solche Arbeit zu machen, auch immer der journalistische Gedanke. Dass man also versucht, von Orten zu berichten, wo die meisten Leute nicht hinfahren können oder nicht hinfahren wollen, dann was man vorfindet zu dokumentieren und die eigene Gesellschaft zu informieren.
Biesler: Sie haben Fotografie ja studiert, in Dortmund und in New York. War das schon vorher klar, dass diese Art von Fotografie Sie interessieren würde?
Bangert: Nee, das hat sich so entwickelt. Ich bin also nicht eines Tages aufgewacht und habe gedacht, jetzt muss ich unbedingt Kriegsfotograf werden. Ich bezeichne mich selbst auch nicht als Kriegsfotograf. Ich bin Fotograf und fotografiere so alles Mögliche, unter anderem auch in Krisen- und Kriegsgebieten. Das hat sich so ergeben, ich habe mal an der Fachhochschule Dortmund studiert und habe da einen Studentenaustausch gemacht in Jerusalem, in Israel, und da war ich dann im Gazastreifen und in der West Bank unterwegs, und da habe ich gemerkt, dass diese politischen Themen mich sehr interessieren. Und von da an ging es dann immer so weiter.
Biesler: Reisen hat Sie auch immer interessiert. Ich glaube, eine der ersten längeren Reportagen, die Sie gemacht haben, da sind Sie mit dem Auto von Argentinien nach New York gefahren, also einmal den ganzen amerikanischen Kontinent hoch. Das verbindet sich, diese beiden Interessen, in Ihrer Arbeit?
Bangert: Ja, dahinter steht natürlich auch große Neugierde und auch diese Idee des Abenteuers. Das muss man auch immer klar sagen, es spielt immer eine Rolle für Journalisten und Fotografen, die also aus schwierigen Situationen berichten, dieser Abenteuergedanke. Das darf man nicht verheimlichen, das spielt eine große Rolle und das ist unter anderem auch ein Motivationsgrund.
Licht macht ein Bild
Biesler: Wenn Sie so unterwegs sind in fremden Gegenden, Afrika haben Sie auch durchquert mit so einem Geländewagen, dann warten Sie auf was? Dann schauen Sie nach welchen Motiven? Dann steigen Sie aus dem Wagen, wenn Sie was sehen, und machen Fotos? Was macht das Bild aus?
Bangert: Um das mit einem Wort zu beantworten: Licht. Wir Fotografen beschäftigen uns mit Licht. Und interessant wird es immer dann, wenn das Licht ungewöhnlich ist, wenn eine gewisse Stimmung durch das Licht erzeugt wird. Und dann ist es noch interessant, wenn irgendwas passiert, wenn die Leute beschäftigt sind und nicht unbedingt auf den Fotografen achten, sondern etwas tun, was man dann dokumentieren kann.
Biesler: Wenn Sie unterwegs sind - ich zähle mal so ein paar Länder auf, in denen Sie gearbeitet haben: Palästina, Darfur, Japan, aber nicht einfach so Japan, sondern Fukushima, die Atomkatastrophe hat Sie interessiert, das Leben dort nach der Katastrophe, Afghanistan, Pakistan, Irak -, wir haben gerade schon gesagt, dass Sie in Ländern unterwegs sind, in denen normale Menschen nicht unterwegs sind. Aber wenn Sie da unterwegs sind in diesen Ländern, dann wird das in der Regel nicht das ästhetische Bild sein, das Sie interessiert. Also, Sie suchen nicht nach der Schönheit, die dann auf dem Foto nachher irgendeinen Glanz verbreitet, sondern es ist auch die Erschütterung, die völlige Zerrüttung der normalen Ordnung, die wir kennen, die Sie da interessiert?
Bangert: Grundsätzlich interessiert mich alles. Ich interessiere mich für Bilder, die über die Ereignisse, die ich miterlebe, die diese Ereignisse ehrlich dokumentieren. Und das kann sehr schön sein. Das kann unheimlich dramatisch sein. Das kann aber auch sehr schrecklich sein und sehr direkt und sehr verstörend. Aber ich glaube, diese Extreme sind eigentlich so interessant, dass man also diese vielen verschiedenen Extreme auch in Bildern kombinieren kann, die dann verwirrend und verstörend sein können, aber für den Betrachter eigentlich auch eine sehr gute Startmöglichkeit sind für eigene Gedanken. Also, unser Medium Fotografie ist so vielschichtig und so individuell erlebbar, und das macht es eigentlich so interessant. Dass jeder seine eigenen Gedanken entwickeln kann zu einem Bild.
Biesler: Die Bilder, die Sie machen, haben einen journalistischen Anspruch, das haben Sie gerade auch gesagt. Sie möchten möglichst wahrheitsgemäß berichten. Aber wie geht das eigentlich, in welcher Situation sind Sie, wenn Sie da sind, wie frei sind Sie, sich zu bewegen, wie nah sind Sie am Geschehen dran, wie stark ausgeschnitten ist das und welche Kontrolle haben Sie, welcher Ausschnitt das eigentlich ist, den Sie sehen?
Bangert: Meine Kontrolle als Fotograf ist immer sehr begrenzt. Das heißt, man muss immer nach den Regeln der anderen spielen. Entweder sind das Soldaten oder Polizei oder Rebellen, die einem sagen, was man nur fotografieren darf und was nicht, man muss sich da so ein bisschen durcharbeiten und das Beste aus schwierigen Situationen machen. Man hat also leider nicht diese große Freiheit, wirklich alles, was geschieht, zu dokumentieren, sondern man muss immer das nehmen, was man dokumentieren kann, und das Beste draus machen. Und dann versuchen, eine möglichst - Sie sagten wahrheitsgetreu - ich würde eher sagen, eine ehrliche Dokumentation zu schaffen, die mit dem übereinstimmt oder die mit meinem persönlichen Erlebnis übereinstimmt.
Biesler: Das heißt, in dem Bild spiegelt sich mehr, als in dem Moment passiert ist, in Ihrer Beurteilung nämlich, die Sie die Umstände kennen. Und ich glaube, gehört zu haben, dass Sie sich gar nicht frei bewegen können, es gibt immer irgendjemanden, der Sie auch in gewisser Weise beschützen muss oder dulden muss zumindest, der Ihnen erlaubt das Bild zu machen. Sie können sich nicht einfach zwischen den Fronten bewegen und fotografieren, was Sie möchten?
Zensur ist so alt wie der Krieg
Bangert: Wenn ich in Kriegs- und Krisensituationen fotografiere, findet immer Zensur statt. Zensur ist was, was von außen kommt. Und diese Zensur findet mittlerweile so statt, dass man in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Wenn ich mit Rebellen unterwegs bin oder mit einer Militäreinheit, dann zeigen die mir gar nicht Dinge, die ich nicht fotografieren soll. Also, wenn irgendwo gekämpft wird und diese jeweilige Gruppe nicht möchte, dass ich fotografiere, dann lassen die mich erst mal gar nicht dahin. Das ist Zensur und die hat es schon immer gegeben, Zensur ist so alt wie der Krieg selbst wahrscheinlich. Und man muss als Journalist, denke ich, versuchen, damit umzugehen, und diese Zensur versuchen zu umgehen.
Biesler: Das heißt, Sie arbeiten aber auch ständig dagegen an, Teil von Propaganda zu werden.
Bangert: Ja, natürlich. Ich arbeite als Journalist, ich bin also nicht Teil einer dieser kämpfenden Einheiten, sondern ich bin Journalist und versuche, so ehrlich wie möglich zu berichten. Das ist ein schmaler Grat, das Ziel ist, keine Propaganda zu produzieren, sondern einen journalistischen Beitrag.
Christoph Bangert hat an der Fachhochschule Dortmund und am International Center für Photography New York studiert. Mehrmonatige Reportagereisen führten ihn über den gesamten amerikanischen Kontinent und quer durch Afrika. Derzeit arbeitet er an einen Langzeitdokumentation über die Nuklearkatastrophe von Fukushima. Er lebt in Köln.
Publizistische Regeln halten Bilder zurück
Biesler: Ich habe es gerade schon gesagt, nicht alle Bilder finden den Weg in die Presse, in die Medien, ins Internet, wo auch immer sie publiziert werden, denn nicht alle Bilder können wir so einfach ertragen, nicht alle Bilder sollen uns zugemutet werden von der Redaktion jeweils. Was für Regeln gibt es da? Werden Ihnen die klar mitgeteilt, fahren Sie mit einem Auftrag hin, der heißt, wir brauchen Bilder, die so aussehen?
Bangert: Wenn ich für Publikationen arbeite, gibt es eigentlich zunächst keine Regeln. Ich versuche, das, was ich erlebe, zu dokumentieren, arbeite meistens im Team gemeinsam mit einem schreibenden Kollegen, und wir berichten über das, was wir erleben. Die Regeln kommen dann manchmal später erst. Es gibt Publikationen, die eine Regel haben, die besagt, dass sie keine Leichen zum Beispiel oder Schwerverletzte publizieren. Das ist natürlich frustrierend für mich als Fotografen, weil diese Bilder existieren, ich habe diese Bilder gemacht, und ich habe sie gemacht, um sie zu veröffentlichen. Das heißt, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass diese Bilder veröffentlicht werden, dann darf ich die eigentlich gar nicht machen. Und ich habe dann auch meinen journalistischen Auftrag nicht erfüllt, wenn sie nicht veröffentlicht werden. Teilweise aus diesem Frust ist dann auch dieses Buch entstanden, weil ich dachte, dass diese Bilder in einem gewissen Kontext unter anderem auch veröffentlicht werden müssen.
Das Buch ist eine Herausforderung an den Betrachter
Biesler: Die sind jetzt in dem Buch "War Porn" nicht großformatig veröffentlicht, sondern ganz klein, also sehr intim. Das finde ich eine gute Methode, sich dem anzunähern, denn man kann das Buch auch schnell wieder zuklappen, und es ist wirklich keins, was man sich auf den Kaffeetisch sozusagen legt und dann genüsslich anschaut, sondern da stockt einem wirklich der Atem. Es gibt sehr grauselige Fotos von enthaupteten Menschen, die auf Müllhalden liegen, all das, was man wirklich als eine Zumutung beschreiben muss. Sie wollten aber, dass die Menschen das sehen. Warum?
Bangert: Diese Bilder sind eine Zumutung, das ganze Buch ist eine einzige Herausforderung an den Betrachter. Das ist wirklich nicht einfach, selbst mir fällt es schwer, diese Bilder anzusehen, obwohl ich sie selbst gemacht habe, obwohl ich selbst dabei war und diese Dinge nicht nur im Bild gesehen habe, sondern auch ganz real. Aber ich denke, ich habe erst mal die Pflicht, diese Bilder zu veröffentlichen. Und ich denke, wir haben auch irgendwo alle als Bildbetrachter die Pflicht, uns unter anderem auch solche Bilder anzusehen. Denn wir erinnern uns in stehenden Bildern. Wenn wir also einen gewissen Aspekt eines Ereignisses weglassen, in diesem Fall diesen Horror, diesen tatsächlichen Schrecken selbst, wenn wir das weglassen, dann haben wir einen ganz wichtigen Teil weggelassen dieser Ereignisse. Und wenn wir uns diese Bilder also nie ansehen oder ansehen müssen, dann können wir uns auch gar nicht an diesen Teilaspekt, diesen Teil dieser Ereignisse erinnern. Dann ist es fast so, als hätten diese Ereignisse nie stattgefunden.
Biesler: Sie beziehen den Bildbetrachter, der das Buch in der Hand hat, ja auch mit ein, nicht alle Seiten sind schon aufgeschnitten, einige muss man sich erst selber öffnen, um dann da reinzugucken. Das heißt, Sie möchten auch so einen langsamen Prozess haben des Sich-Aneignens dieser Grauen, die da zu sehen sind, richtig?
Bangert: Ja, auf jeden Fall. Und ich will die Verantwortung auch dem Bildbetrachter zurückgeben, oder ich will ihn an seine Verantwortung, aber auch an seine Macht, die Entscheidung zu treffen, was will ich sehen, was muss ich sehen, an diese Macht will ich ihn erinnern. Wir haben alle die Verantwortung, aber auch die Macht zu entscheiden, was wir sehen wollen und was wir denken, sehen zu müssen. Und darum geht es in dem Buch und darum geht es auch bei diesen geschlossenen Seiten. Das heißt, einige Seiten dieses Buches sind verschlossen, man kann die öffnen mit einem Messer oder einem Brieföffner, man kann sie aber auch zulassen. Es ist einem wirklich selbst überlassen. Und es ist eben nicht wie Fernsehschauen oder Facebook-Gucken, sondern es ist was sehr Aktives, wir müssen diese Dinge aktiv entscheiden und nicht nur passiv das akzeptieren, was andere Leute uns vorsetzen.
Es kostet den Fotografen auch Überwindung
Biesler: Sie haben gerade gesagt, Ihnen selber stockt auch der Atem, wenn Sie die Bilder sehen, zum Teil auch die aus dem Buch, die Sie selber gemacht haben. Gibt es Fotos, gab es Fotos, die Sie nicht gemacht haben?
Bangert: Eigentlich nicht. Ich habe mich immer überwinden können, Bilder zu machen. Das ist nicht immer einfach, man ist dann auch nicht immer so der Allerbeliebteste, wobei man sagen muss, dass ich grundsätzlich nie Leute fotografiere, die nicht fotografiert werden wollen. Aber man muss sich trotzdem, man muss sich immer überwinden auch diese Bilder zu machen. Die natürliche Reaktion ist, wegzugehen und wegzuschauen, aber ich denke, wenn ich das machen würde, dann dürfte ich gar nicht da hinfahren, dann hätte ich auch gar nicht das Recht, dort zu sein. Weil ich fahre ja nicht in diese Gebiete zu meiner persönlichen Unterhaltung, sondern ich fahre dahin im Auftrag anderer, weil ich einen journalistischen Auftrag habe. Und wenn ich dann nicht arbeiten kann vor Ort, wenn es schwierig wird, dann habe ich eigentlich meinen Auftrag nicht erfüllt.
Biesler: Sie fotografieren keine Menschen, die nicht fotografiert werden wollen. Aber die Kontrolle über das Bild ist ja für die Menschen dann verloren, wahrscheinlich sehen die Sie nie wieder im Leben, das ist eine einmalige Begegnung. Wie stellen Sie sicher, dass das sozusagen verantwortliches Handeln ist, welche Auflagen erteilen Sie sich selber?
Bangert: Das ist eine ganz große Verantwortung, die man da übernimmt im Grunde, weil die Leute einem vertrauen und einem die Kontrolle an dem eigenen Bild übertragen. Ich kontrolliere jetzt die Bilder anderer Menschen. Die zudem noch oft in Extremsituationen sind. Und diese Bilder, mit denen muss ich verantwortungsvoll umgehen, ich muss versuchen, möglichst zu kontrollieren, in welchem Kontext diese Bilder veröffentlicht werden. Denn der Kontext ist ganz, ganz wichtig, mein Argument oder das Argument des Buches ist nicht, diese schrecklichen Bilder jetzt auf den Titelseiten von Boulevardzeitungen zu zeigen, nur um die Leute zu schocken.
Ich möchte ganz klar über diesen Schock auch hinausgehen und eine Reflexion ermöglichen, dass der Bildbetrachter auch diesen ersten Schock überwinden kann oder die Chance hat, diesen ersten Schock zu überwinden, und dann auch die Möglichkeit hat, sich selbst Gedanken zu machen zu dem, was er gerade gesehen hat. Im Buch ist das natürlich relativ einfach oder funktioniert es sehr gut, weil man sich das Buch ansehen kann und dann kann man es wieder weglegen und ein paar Wochen später oder Jahre später noch mal ansehen und die Bilder sind noch genauso in der Form da. Und das Erlebnis der Bildbetrachtung ist immer noch sehr ähnlich und bleibt auch konstant. Das heißt, es ist im Buch eigentlich viel einfacher, diese Reflexion hervorzurufen, als zum Beispiel bei einer Ausstellung im Museum oder einer Galerie oder, noch viel schwieriger, auf den sozialen Netzwerken oder online, wo dieses Seherlebnis sehr flüchtig ist.
Biesler: Sie selbst schreiben in dem Buch, das sei ein Experiment, mal zu sehen, was passiert, wenn Sie Ihre Selbstzensur ablegen. Das heißt, das sind alles Fotos, die Sie gar nicht erst an die Redaktionen weitergegeben haben zur möglichen Veröffentlichung, sondern wo Sie von vornherein wussten, schon im Augenblick des Erzeugens dieses Fotos, des Abdrückens sozusagen, das ist nichts für die Öffentlichkeit, das wird eh nicht gedruckt?
Bangert: Die meisten Bilder habe ich schon geschickt, die meisten Bilder habe ich tatsächlich an die Redaktion geschickt und sie wurden dann von den Redakteuren nicht ausgewählt. Also, sie wurden nicht veröffentlicht. Es gibt einige Bilder im Buch, die ich im Rahmen meiner Recherche oder meiner Suche in meinem Archiv gefunden habe, an die ich überhaupt keine Erinnerung hatte. Das gab es auch. Ich habe Bilder gefunden, bei denen ich mich nicht erinnern konnte, dass ich sie gemacht habe. Das heißt, mein eigenes Gehirn, meine eigene Erinnerung hat sich selbst zensiert, hat diese Dinge gelöscht. Das ist natürlich eine tolle Sache, ist natürlich auch wahrscheinlich der Grund, warum ich nachts schlafen kann. Aber das ist auch sehr gefährlich. Weil, wenn selbst ich diese Dinge vergesse und sie dann zudem bei der Redaktion aussortiert werden und nie beim Leser ankommen, dann haben wir uns eigentlich alle selbst zensiert.
Biesler: Wenn ich das aber jetzt richtig verstehe, wie Sie mit den Bildern umgehen, dann ist das so eine zweischneidige Sache vielleicht: Auf der einen Seite müssen Sie quasi qua Profession so eine Art Bilderjunkie sein, immer auf der Suche nach dem vielleicht noch tolleren Bild, vielleicht noch eindrucksvolleren Motiv, noch gewagtere Kompositionen, und auf der anderen Seite ist aber diese ständige Steigerung für Sie offensichtlich auch so schwer nur zu verarbeiten, das es nur geht, indem tatsächlich Ihr Hirn Ihnen selbst sagt, daran erinnere ich mich jetzt nicht. Leiden Sie darunter, ist das psychologisch leicht für Sie? Wie kommen Sie zurück, wenn Sie unterwegs waren?
Bangert: Ja ... Es ist nicht so, dass das noch schrecklichere Bild dann das noch bessere Bild ist. Wir suchen immer nach noch besseren Bildern, Bildern, die noch besser komponiert sind, die noch besseres Licht haben, die noch bessere Linien haben. Wir suchen also nicht noch nach immer schrecklicheren Bildern. Also ...
Biesler: Aber wenn ich mit einem fahrenden Panzer anfange, dann will ich ja auch irgendwann mal sehen, wie der schießt, das ist ja viel eindrucksvoller, so stelle ich mir das jedenfalls vor in der Kriegsberichterstattung. Wenn ich da ein Militär beim Exerzieren sehe, ist das weniger interessant, als wenn ich das im Kampf beobachten kann. Gibt es nicht so eine Entwicklung, nein?
Bangert: Nicht unbedingt. Wir als Fotografen, anders als die Textkollegen, sehen das also schon, denke ich, ein bisschen abstrakter. Das kann also eine völlig langweilige Situation sein, zum Beispiel auf dem Truppenübungsplatz oder so, aber das Licht stimmt und die Linien stimmen und man bekommt ein unglaubliches Bild zustande, und dann manchmal knallt und schießt es und man bekommt überhaupt nichts hin. Also, das kann man so nicht sagen. Die ursprüngliche Frage war aber natürlich, wie man damit umgeht, wenn man nach Hause kommt und so. Das ist natürlich nicht einfach. Das muss man sehr ernst nehmen. Ich denke, wichtig ist, dass man sich immer wieder Pausen gönnt, dass man also auch andere Themen bearbeitet, die nichts mit Krisen und Kriegen zu tun haben, wie in meinem Fall diese Reisen. Ich mache dann längere Reisen, mache dann ganz andere Themen und das hilft mir unheimlich weiter, dann auch wieder zurückzugehen.
Biesler: Und wenn Sie solche Fotos machen, kann man dann sagen, die Kamera ist eine Art Filter, auch eine Art Schutz für Sie, die Ihnen es eher ermöglicht, hinzuschauen als mit dem bloßen Auge?
Bangert: Ja, ich mag diese Idee nicht so sehr mit diesem Schutzschild Kamera. Was man sagen muss, wir arbeiten sehr intuitiv, relativ schnell, und man ist sehr konzentriert. Das heißt, wir haben gar nicht so richtig die Zeit darüber nachzudenken, was wir da gerade sehen. Man arbeitet dann sehr konzentriert und versucht, professionell zu arbeiten, technisch alles richtig zu machen. Und dann hat man gar nicht so richtig die Zeit darüber nachzudenken, was man da gerade sieht. Das kommt dann erst später. Bei der Bildauswahl, wenn man dann stundenlang vor dem Computer sitzt und die Bilder ansieht und auswählt, dann merkt man eigentlich oft erst, was man gerade gesehen hat.
Biesler: Das heißt, Sie schauen auch nicht, was die Digitaltechnik ja möglich machen würde, direkt nach dem Fotografieren auf das Display der Kamera oder auf den Laptop und schauen, wie sind die Bilder geworden, muss ich noch mal nachlegen oder ist das okay so, sondern Sie warten, genau wie man das früher mit dem Film gemacht hätte, Sie warten erst ab und sortieren abends, wenn Sie wieder ein bisschen zur Ruhe gekommen sind?
Bangert: Ich versuche, möglichst wenig hinten auf die Kamera zu gucken, weil man verpasst auch immer wieder mal was. Man hat also eigentlich erst so einen richtigen Überblick über das, was man so an dem Tag oder in der Woche sich erarbeitet hat, viel später am Computer. Und oft ist es so, dass ich möglichst lange warte mit der Bildauswahl. Das hilft einem unheimlich, weil man dann auf eine gewisse Distanz zwischen dem eigenen Erlebnis und dem Foto, dem Bild kommt, und man auch ein bisschen halt durch diese Distanz besser auswählen kann.
"Biesler: Dann gucken Sie professioneller drauf, wie auf fremde Fotos, Sie sind nicht mehr so in der Situation.
Bangert: Ja, ja. Gerade wenn es ein bisschen heikel war und ein bisschen brenzlig, dann hat man das Gefühl, die Bilder müssen ja auch gut sein. Aber oft ist es genau umgekehrt, immer wenn es langweilig ist, macht man auch ganz gute Bilder, und wenn es mal wirklich gefährlich war, dann sind meistens die Bilder relativ langweilig.
Der größte Teil der Arbeit ist ruhig
"Biesler: Wie brenzlig ist es denn mal geworden?
Bangert: Ja, da rede ich nicht so gerne drüber. Die Arbeit ist schon gefährlich. Es ist nicht so wie im Kriegsfilm, man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir da wie in einem Kriegsfilm wild durch die Gegend rennen mit zwei Kameras um den Hals und dann da ständig in Deckung gehen müssen und uns vor fliegenden Kugeln schützen müssen, so ist das nicht. Das gibt es auch, das ist aber ein kleiner Bruchteil der Arbeit.
Der größte Teil der Arbeit ist eigentlich viel ruhiger und nicht weniger schrecklich. Wenn man zum Beispiel in einem Krankenhaus arbeitet, das ist unbeschreiblich schrecklich, aber das ist relativ unspektakulär vom persönlichen Einsatz her, es ist relativ sicher. Aber das macht eigentlich den Großteil der Arbeit aus.
"Biesler: Aber Sie nennen keine Situation?
Bangert: Nee, lieber nicht. Meine Mutter könnte zuhören.
"Biesler: Gibt es Humor, gibt es die Möglichkeit dazu?
Bangert: Oh ja, natürlich, absolut. Das ist sehr schwer zu erklären. Wir sind dann immer mit einem schreibenden Kollegen unterwegs und einem Fahrer und Übersetzer, das ist also eine kleine Gruppe, und das ist total lustig. Die Fahrer erzählen immer Witze und es ist also schwer in Worte zu fassen. Aber das ist die meiste Zeit eigentlich eine ziemlich lustige und fröhliche Sache und dann schlägt es aber rasend schnell um und wird dann unheimlich traurig und elend.
"Biesler: Warum wollen Sie das trotzdem immer noch? Sie sind ja jetzt auch nicht mehr 20, das heißt, so ein bisschen von dem Abenteuerdrang ist vielleicht schon verflogen? Das bleibt Ihr Beruf?
Bangert: Ja, schon. Mit der Zeit wird dann dieser Abenteuergedanke, wie ich ihn nenne, ein bisschen weniger, der journalistische Gedanke wird ein bisschen mehr, die Balance stimmt also über die Zeit besser. So ganz fertig bin ich mit diesen Themen noch nicht. Ich muss jetzt sagen, ich bin 36, mit Mitte 50 will ich das also nicht mehr machen. Das ist auch körperlich anstrengend, irgendwann muss man auch mal vernünftige Arbeit abliefern. Aber im Moment macht mir das noch viel Sinn, diese Arbeit, und solange das so ist, mache ich auch noch weiter.
"Biesler: Ich möchte ganz gern noch mal zurückkommen auf die Fotografierten, die auf Ihren Bildern zu sehen sind. Wie genau wissen Sie, dass die fotografiert werden wollen? Gibt es vielleicht Aufforderungen sogar, dass Sie fotografieren, wie viel können Sie wissen davon, wie die Menschen in solchen Krisengebieten das tatsächlich vielleicht auch als eine Chance begreifen, oder als Bedrohung? Das ist sicherlich auch kulturell unterschiedlich?
Bangert: Es gibt keine Pauschalregeln, das ist immer anders. Jede Situation, jeder Tag, jedes Bild, jeder Mensch, den ich fotografiere, reagiert ganz anders. Wenn Leute in Extremsituationen sind, oft ist es so, dass sie wirklich wichtigere Dinge zu tun haben als sich noch an dem Fotografen zu stören, das heißt, man ist da, aber man ist eigentlich nicht da, weil es so eine Extremsituation ist, dass es gar keine Bedeutung hat, ob man nun da ist oder nicht. Dann gibt es viele Situationen, wo die Leute fotografiert werden wollen. Das ist eigentlich sehr überraschend. Oft habe ich erlebt, dass Leute, wo ich gezögert habe und vielleicht gar nicht sofort anfangen wollte zu fotografieren, dass die Leute gesagt haben, hier, du musst jetzt fotografieren, du musst jetzt zeigen, was uns hier passiert.
"Biesler: Und die haben die Hoffnung, dass es auch eine Wirkung hat?
Bangert: Ja, ich denke schon. Das ist natürlich eine Hoffnung, die leider nur in sehr seltenen Fällen tatsächlich diese Situation ... Dass eine direkte Veränderung stattfindet, ist sehr, sehr selten. Als Berichterstatter darf man also nicht den Anspruch haben, die Welt zu verbessern oder die Welt zu verändern. Alles, was wir tun können, ist, Ereignisse zu dokumentieren. Das ist nicht wenig, das ist also eigentlich eine sehr wichtige Aufgabe. Und was dann mit unseren Berichten, mit unseren Bildern geschieht, was der Leser, was der Bildbetrachter mit diesen Informationen macht, ist nicht wirklich in unserer Hand. Wir können also auch nicht das voraussehen, was dann passiert, wie die Leute auf unser Material reagieren. Wir können einfach nur das anbieten und versuchen, unsere Gesellschaft so gut wir können zu informieren.
Es sollte keine Publikationsregeln für Bilder geben
"Biesler: Wenn Sie es in der Hand hätten, würden Sie denn andere Regeln aufstellen für die Publikation von Fotos in Tageszeitungen, in Internetmedien, als sie jetzt momentan existieren, die Sie ja so ein bisschen versuchen zu umgehen durch Ihr Buch?
Bangert: Ich denke, es sollte keine Regeln geben. Denn jeder Tag, jedes Bild, jede Geschichte ist völlig anders. Man kann das nicht pauschal sagen, man muss wirklich jeden Tag neu entscheiden, ist dieses Bild, ist es angemessen, passt das zu dem, was wir als Publikation sagen wollen? Ich finde es sehr problematisch, wenn Publikationen zu viel darüber nachdenken, was der Leser sehen möchte. Ich denke, unsere Aufgabe als Journalisten ist eher, in einer Form zu berichten, wo wir festlegen, was uns wichtig ist, nicht, was der Leser sehen will, sondern was ist uns wichtig als Publikation und wie zeigen wir das? Das heißt, der Kontext, wie wir das zeigen, ist genauso wichtig wie die Entscheidung zu treffen, dass wir diese Bilder zeigen. Aber es sollte keine Regeln geben, es sollte nicht diese Pauschalregeln geben, es muss immer wieder neu entschieden werden: Ist es das, was wir zeigen wollen, oder eben nicht?
"Biesler: Es gibt ja Bilder, von denen man sagt, sie haben die Welt vielleicht nicht verändert, aber sie haben doch etwas bewegt in der Welt. Zum Beispiel vom Tian'anmen-Platz, also zumindest in der westlichen Welt ist da die Reaktion des allein vor dem Panzer stehenden Mannes mit den Tüten in der Hand doch sehr groß gewesen. Also, man hat das Gefühl gehabt, die Aufmerksamkeit wird eigentlich größer. Ist das die Hoffnung, die Sie auch haben, mit starken Bildern Konflikte stärker ins Bewusstsein rücken zu können?
Bangert: Eigentlich nicht. Eigentlich denke ich auch, dass das Zeitalter dieser Bildikonen auch ein bisschen zu Ende geht. Es gibt viel mehr Bilder als es früher gab, die großen Fotografen unserer Zeit arbeiten eher in Bildserien als in Einzelbildern. Daher finden diese Bildikonen weniger statt als noch früher. Oft werden diese Bilder, die so sehr bekannt werden, heutzutage auch nicht von Fotografen gemacht, sondern von irgendwelchen Leuten, zum Beispiel die Bilder, die in Abu Ghraib entstanden sind im Irak, die wurden von den Tätern gemacht, den Leuten, die diese Leute, diese Iraker da gefoltert haben. Die haben die Bilder selbst gemacht, diese Bilder kennt jeder. Von daher ist das also dynamischer geworden. Wir haben nicht mehr so ein Monopol vielleicht. Wir konzentrieren uns heute eher auf Bildserien. Wir versuchen, eine Geschichte zu erzählen. Nicht in einem Bild, aber auch nicht in sechs Millionen Bildern, sondern so in 16 oder in 35 Bildern.
"Biesler: Die dann auch in Ausstellungen gezeigt werden, also, da ist die Grenze zur Kunst fließend.
Bangert: Genau, in Ausstellungen, in Museen, in Büchern. Und auch noch nach wie vor in Magazinen.
"Biesler: Vielen Dank, Christoph Bangert!
Bangert: Vielen Dank!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Nächste Woche hören Sie ein weiteres Gespräch über die Ukraine - mit den Schriftstellern Katja Petrowskaja und Jurko Prohasko.