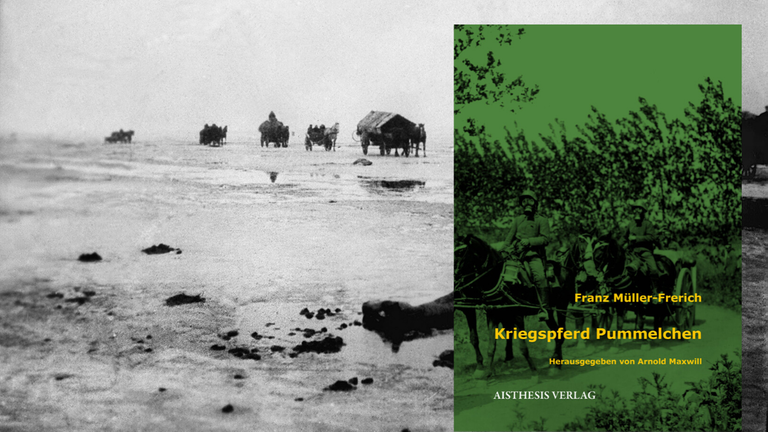
Kommt die Rede auf die literarische Aufarbeitung der Schrecken des Ersten Weltkriegs, also jener sogenannten "Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts", so fallen einem spontan Ernst Jüngers Erinnerungen "In Stahlgewittern", Erich Maria Remarques großer Anti-Kriegsroman "Im Westen nichts Neues" oder Karl Kraus` "Die letzten Tage der Menschheit" dazu ein. Und natürlich Jaroslav Haseks "Braver Soldat Schwejk".
Allein das Online-Kulturmagazin "Perlentaucher" listet aktuell 455 Titel zum Thema – darunter ebenso selbstverständlich Hermann Brochs berühmte "Schlafwandler-Trilogie" und Ernest Hemingways Roman "In einem anderen Land" wie Wolfgang Köppers 1930 im Berliner Horen-Verlag erschienener "Heeresbericht" oder Arnold Zweigs raumgreifender Romanzyklus "Der große Krieg der Weißen Männer".
Ein Werk aber, das man dort wie wohl auf den meisten anderen Titelsammlungen zum Thema vergeblich sucht, ist Franz Müller-Frerichs 1930 in der Westfälischen Verlags-Anstalt publizierter Kurzroman "Kriegspferd Pummelchen", der nun von Arnold Maxwill herausgegeben wieder in einer gut kommentierten Neuausgabe im kleinen Bielefelder Aisthesis Verlag vorliegt. Einen Grund dafür glaubt Maxwill rückblickend in der hohen Sättigung zu sehen, die zu Beginn der 1930er Jahre auf dem Buchmarkt angesichts der seinerzeit in großer Zahl erschienenen Publikationen zum Thema geherrscht hatte. Darüberhinaus führt er als mögliche weitere Gründe für die fortgesetzte Nichtbeachtung von Müller-Frerichs Buch in seiner Vorbemerkung zur Neuausgabe an:
Im Ton eines Kinderbuchs
"Das "Papiergewitter" der deutschsprachigen Literatur setzte nach dem Ersten Weltkrieg – in deutlich abgeschwächter Form - ein zweites Mal ein: Gemeint sind die Anti-Kriegsromane, die Ende der 1920er Jahre erschienen und sich unmittelbar in einem hitzigen Wettstreit um die Deutungshoheit über die mittlerweile mehr als zehn Jahre zurückliegenden Ereignisse befanden. Dass Franz Müller-Frerichs "Kriegspferd Pummelchen" in diesem publizistischen Sog nicht mehr Aufmerksamkeit erhielt, mag auch mit dem Titel zusammenhängen, der eher ein Kinderbuch vermuten lässt. Und resultiert natürlich nicht zuletzt aus der Unbekanntheit des Autors, Volksschullehrer in Dortmund-Grevel."
Tatsächlich kommt Müller-Frerichs kleines, eigenwilliges Buch zu Anfang im einem die Ereignisse verharmlosenden Kinderbuchton daher, der den Krieg, diesen Zustand entgrenzter Gewalt und gesellschaftlicher Neuordnung, wie ein fernes Donnergrollen am Erzählhorizont erscheinen lässt, das die bald einsetzende Handlung nicht zu tangieren scheint. Stattdessen konzentriert er sich ganz auf die Einführung seiner beiden anfänglichen Protagonisten zu. Diese sind der aus dem Westfälischen stammende Bauer Gottlieb Stiefelbein und seine trächtige Stute Liese, die im Begriff ist ihm seinen späteren Liebling Pummelchen zu gebären:
"Über den Leib der Stute rinnt ein schweres Zittern und Beben. Ihr Stöhnen vermengt sich mit leisem, schmerzlichem Wiehern. Das Tier spürt, was sich vollzieht, und es fühlt seinen Atem von hundert dunklen Gewalten umlagert. Sie wirft sich hin, legt den Kopf auf die Steine und seufzt in den Qualen aller Kreaturen, die gebären. Und es zittert und bebt und stöhnt noch qualvoller. Nie hat er so gebangt, wenn er früher bei der Geburt kleiner Pferdekinder mithalf. Bis ein Nachbar ihm in die Rippen schlägt: "Schiefelbein, Kerl, welch ein prächtiges Fohlen! Es war eine schwere Geburt!"
Das Pferd im Zentrum der Erzählung
Ganz dem schwelgerischen Gestus des Expressionismus verbunden malt Müller-Frerich Pummelchens Geburtsszene in entsprechend satten Farben aus. Und schon hier wird spürbar, dass seine Sympathie im Zweifelsfall ganz bei den Tieren liegt, denen er mit fortschreitender Erzählung immer menschlichere Züge angedeihen lässt. Denn anders als die meisten Chronisten der Kriegsschrecken, die alleine das kämpfende und leidende menschliche Individuum ins Zentrum ihrer Berichte stellten, und den Krieg nicht selten als eine Art Regulator aus den Fugen geratener gesellschaftlicher Zustände und Zusammenhänge priesen, ist Müller-Frerich geradezu diametral dazu bemüht, allem voran das Leid jener 16 Millionen in der Materialschlacht des Kriegs zu Tode gekommenen Pferde ins Zentrum seiner Erzählung zu stellen.
Ähnlich übrigens wie vor ihm Erich Maria Remarque, der in seinem Klassiker "Im Westen nicht Neues" bereits ebenfalls von schreienden Pferden, aufgerissenen Tierbäuchen und heraushängenden Gedärmen berichtete. In der zeitgenössischen Prosa Westfalens im Speziellen war dieser Aspekt bis zu Müller-Frerichs Buch nahezu unberücksichtigt geblieben.
Pummelchen bebt und zittert
Und genau darin liegt der besondere Wert seines Werks, das uns das nur schwer fassbare kreatürliche Leiden anschaulich fühlbar zu machen versteht, in dem es die geschundene, überstrapazierte, schlecht gepflegte, ständigem Futtermangel und Kriegslärm ausgesetzte Kreatur vermenschlicht – und seinen Leser mithilfe dieses an sich simplen Erzähltricks echte Empathie abzugewinnen vermag. So heißt es im Verlauf der Erzählung, als Pummelchen in den Kriegswirren gemeinsam mit anderen in unwirtlichem Gelände unter Beschuss gerät einmal:
"Die Pferde haben einen Sprung zur Seite getan auf das Fichtenwäldchen zu. Die beiden Vorderpferde sind über den Graben hinweg gekommen. Pummelchen aber und der Wilde sind gestürzt und liegen über dem engen Graben, die Vorderbeine jenseits, die Hinterbeine diesseits gestreckt. Der Wilde hat sich in seinem Geschwirr verstrickt und sucht sich mit aller Gewalt zu befreien. Er schlägt mit den Beinen, stößt den Kopf unter die Deichsel und wird noch verwickelter. Er wiehert klagend und verzweifelt. Pummelchen bebt und zittert. Es kann sich ja auch nicht bewegen, weil es in den Strängen verschlungen ist."
Ergreifende Liebesgeschichte zwischen Mensch und Tier
Das alles wird von Müller-Frerich höchst anschaulich erzählt – und öffnet hinter den vordergründig geschilderten Ereignissen Zug um Zug den Raum für eine ergreifende Liebesgeschichte zwischen Mensch und Tier, die in ihrer Darstellung unterm Strich als ebenso einfach wie bezwingend erscheint. Denn obwohl beide – Schiefelbein alsauch Pummelchen - zum Frontdienst verpflichtet werden und ihre Wege sich damit scheinbar für immer trennen, gibt der vielfach in Kampfhandlungen verstrickte Bauer die Hoffnung nicht auf, sein "Pferdekind" dereinst wiederzusehen.
"Den Fall hat Schiefelbein schon unzählige Mal durchdacht. Er wird dann Pummelchen einfach nehmen und es als sein Pferd führen. Wenn es auch gemerkt wird und auffällt. Was können sie ihm tun? Etwas Schlimmeres wie Front gibt es ja nicht. Und Pummelchen ist doch sein liebes Pferd. Was wissen die meisten Menschen um ein Tier und um die Liebe zu einem Tiere? Seine Sehnsucht nach dem Pferde muss doch noch einmal gestillt werden."
Tatsächlich kommt es, weil der Autor es so will, kurz vor Ende der Erzählung zu einem freudigen Wiedersehen der beiden. Doch das Glück des Bauern ist nur von kurzer Dauer: Bei einem Angriff lassen beide ihr Leben – und Müller-Frerich beschließt seine Geschichte, indem er seinen Lesern ein letztes Mal ungeniert an die Herzen greift.
Dabei schreckt er selbst vor überschießender Sentimentalität nicht zurück schreckt, indem er Pummelchen auf den letzten Lebensmetern noch schnell ein Fohlen gebären lässt, ehe es für immer die Augen schließt. Denn – und das ist Müller-Frerichs finale, leider allzu pathetisch formulierte Botschaft: Das Leben muss und wird weitergehen – allem voran das der von ihm so geliebten Pferde. Gegen alle Anfechtungen eines auch noch so brutalen Krieges.
Die Qualen des Verendens
"Pummelchen wirft sich neben seinen lieben, väterlichen Freund hin, legt den Kopf an seine Schulter und das Maul an seine Wange und will stöhnend und klagend sein geborstenes, gebrochenes und verschundenes Leben aufgeben. Noch einmal stöhnt das Tier hart und seufzt schwer. Dann ist es geschehen. Das Kind lebt. Die Qualen des Verendens mischen sich mit dem G der unendlichsten Lust, geboren zu haben, in dem Kind weiter zu leben und die lange, lange Kette der Wesen und der Gattung nicht gebrochen zu haben. Und Schiefelbein lächelt glücklich. Morgen ist er reklamiert und für ihn ist der Krieg aus. Er holt noch einmal tief, tief Atem, röchelt dumpf, reißt die Augen weit auf und ist tot."
Dem Kriegsteilnehmer Franz Müller-Frerich, der im November 1962 zweiundsiebzigjährig als pensionierter ehemaliger Schulrektor in Dortmund starb, gelang es seinerzeit anschaulich, den Prozess der Verrohung des Individuum in Zeiten des Kriegs weit über dessen Ende hinaus darzustellen. Dass sein nun vorliegender, ganz im Sprachgestus der damaligen Zeit abgefasster Text sprachlich nicht überlebt hat, ist das eine; seiner bleibenden Dringlichkeit aber nimmt dies nichts. Entschlossen erhob dieser Autor darin seinerzeit seine Stimme gegen den Krieg. Und so resümiert sein Herausgeber denn auch abschließend zu Recht:
"Innovativ ist die Darstellung dieses Anti- Kriegsromans, weil sie sich konsequent auf die Perspektive des Pferdes einlässt. In der Art und Weise, wie Krieg tagtäglich zu erdulden ist, zeigt sich bei Müller-Frerich zwischen Mensch und Tier kaum eine Differenz. Und noch bis in die letzte Szene hinein macht er deutlich, dass Empathie innerhalb der mentalen Kartierung allenfalls partielle Zufallserscheinung ist. So spricht das Buch – über den Umweg des leidenden Tieres – vor allem von uns, dem Mangelwesen Mensch."
Franz Müller-Frerich: "Kriegspferd Pummelchen".
Herausgegeben von Arnold Maxill.
Aisthesis Verlag, Bielefeld. 134 Seiten.
Herausgegeben von Arnold Maxill.
Aisthesis Verlag, Bielefeld. 134 Seiten.


