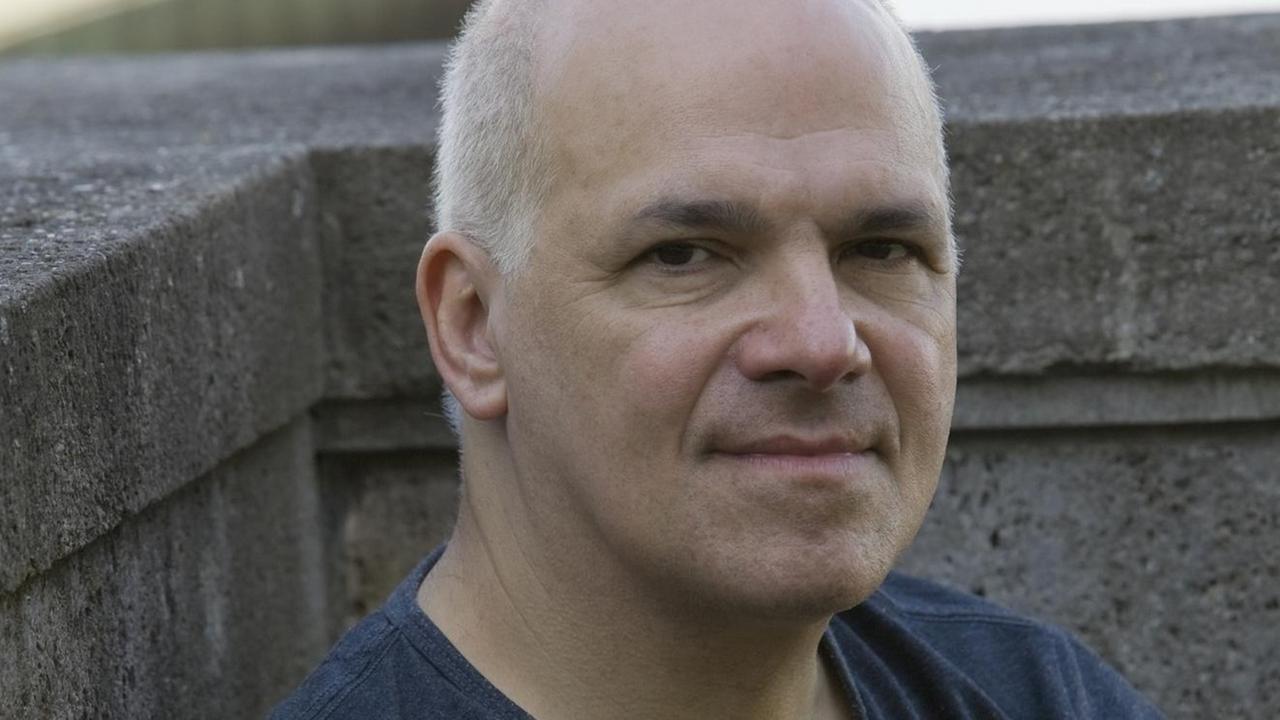Dem Vertrieb des Tiefsinns gelingt es mehr und mehr, allen Tiefsinn auszutreiben. So kündigt der Kiepenheuer & Witsch Verlag das Erscheinen der Kriegstagebücher von Heinrich Böll als Sensation an. Mit Sicherheit sind diese flüchtigen Notate eines unglücklichen jungen Mannes mitten im Krieg keine Sensation im Vordersinn. Das große Publikum wird etwas ratlos in diesen Aufzeichnungen blättern und der Wissenschaft verraten die sporadischen Notizen kaum Neues, geschweige denn Gewichtiges. Doch mit großer Wahrscheinlichkeit wird die sensationelle Ankündigung die Rezeption dieses Buchs überlagern. Und unsere Großkanoniker werden Heinrich Böll einmal mehr aus ihrem Kanon ausschließen.
Wer sich dem Schweiß der kulturellen Arena zu entziehen versteht, hätte allerdings die Chance in einem ganz anderen Sinne sensationelle Dokumente eines großen Zeitgenossen zu entdecken. Wohlgemerkt, wir haben es hier nicht mit dem Schriftsteller Heinrich Böll zu tun, sondern mit einem jungen Mann, der 1939 im Alter von 21 Jahren zum Arbeitsdienst eingezogen wurde und übergangslos im Inferno des Zweiten Weltkrieges landete. Das erste jener Kriegstagebücher stammt aus dem Jahre 1943, da war Böll 25 Jahre alt und hatte bereits vier Jahre Krieg auf dem Buckel. Nicht den heißen Krieg, sondern die Öde der Etappe. Bürodienst, Wachdienst, Dienst in Werkstätten unterbrochen von so martialischen wie stupiden militärischen Exerzitien in Polen, Frankreich oder heimischen Kasematten.
Böll hat seine Empfindungen in jenen Jahren sehr genau und beinahe täglich transkribiert in den Briefen an die Familie und an Annemarie Cech, die er im Mai 1942 während eines kurzen Heimaturlaubs heiratete. Man könnte sie so zusammenfassen: Heinrich Böll hasst den Krieg und er hasst seine Situation. Pausenlos errichtet er Zäune gegen jene Welt, die ihn 24 Stunden am Tag im Würgegriff hat. Das ist seine Revolte und die muss man erstmal verstehen.
Verweigerung der Realität
Böll ist gewissermaßen von Hause aus Antifaschist, mehr eine Angelegenheit des Herzens und des Anstands als Frucht politischer Reflexion. Ihm fehlen alle Voraussetzungen für eine politische Analyse und zu einer politischen Parteinahme. Mit aberwitziger Intensität flüchtet er sich in seine einzige Möglichkeit: Er verweigert sich der Realität. Das ist noch keine Literatur, aber ihre intimste Voraussetzung: Schöpfung setzt Verneinung voraus. Böll beweist eine fast unheimliche Sicherheit mitten in der allergrößten Unsicherheit: ein aberwitzig einsames Geschäft. Seine Verweigerung drückt sich in seiner militärischen Karriere aus: In mehr als sechs Kriegsjahren wird Böll nur ein einziges Mal befördert. Dabei stünde dem Abiturienten die Offizierslaufbahn offen. Und er weiß es. An seine Mutter schreibt er 1942:
"Es ist unheimlich verlockend, die Aussicht, die Möglichkeit, dem ganzen blöden Gesindel überlegen zu sein; einen Putzer zu haben, der alles erledigt, alle die Dinge, die für mich eine Qual sind, wie Waschen und Stiefelputzen; und ein Bett haben und Ruhe; ( ... ) ; ach, es hat vieles für sich, fast alles; aber es wäre ein Verrat, und deshalb will ich es nicht, Du wirst mich schon verstehen."
Offenbar hatte Böll von Anfang des Krieges an ein Tagebuch geführt. Den Verlust der ersten drei beklagte er noch selbst in seinen Briefen. Die erhaltenen drei beginnen im Oktober 1943 und enden im September 1945. Im November '43 wird Böll nach Russland an die Front geschickt, wo er mehrfach schwer verwundet wird. Es handelt sich um unterschiedliche Hefte ähnlichen Formats. Das Tagebuch, das 1943 beginnt, ist ein abgelaufener belgischer Taschenkalender, den Böll auf einem Transport durch Belgien erworben hatte.
Er führte diese Tagebücher weder regelmäßig noch systematisch. Es sind thematisch und im Tonfall völlig unterschiedliche Notizen. Manchmal finden sich drei Einträge unter einem Datum, dann wieder wochenlang nichts. Selten stoßen wir auf ausgeschriebene Sätze, meist handelt es sich um ein paar Worte, stichwortartige Bemerkungen und Anrufungen eines schweigenden Himmels.
3.2.44 Gott möge mir gnädig sein."
4.2.44 noch immer der Laufzettel. Schleichende Zeit, immer denk ich an Anne-Marie an meine teure Frau, Anne-Marie, mein Leben. Abends Brandwache! In der Kantine der Kölsche! Gott möge mir gnädig sein. Posten stehen im Flur bei Kälte und Wind viermal am Tage. Gott möge uns gnädig sein. Abends wieder Brandwache. "
Kluge verlegerische Entscheidung
Alles in allem kommen so vermutlich weniger als 50 Seiten Text zusammen. Doch Text wäre zu viel gesagt: Eher eine datierte Aneinanderreihung von Gelegenheitsnotizen, Schmerzensschreien, Sehnsuchtsgewimmer, Ortsangaben, Buchtitel, Anrufungen Gottes und Annemaries, Träume als Orakel, im Delirium auf Papier geworfene Zeugnisse vom Delirium. Der Verlag hat aber alle drei Hefte Seite für Seite in diesem Buch fast in Originalgröße faksimiliert und darunter den oft schwer leserlichen handschriftlichen Text transkribiert.
Was auf den ersten Blick wie ein Trick anmuten mag, um aus wenig Text ein Buch zu machen, das man dann zu Bölls 100. Geburtstag als Sensation präsentieren kann, erweist sich bald als kluge Entscheidung. Ohne die physische Rückbindung an die Umstände ihres Entstehens blieben die meisten Einträge Funksprüche aus dem Nichts für niemand. Vielleicht hat Heinrich Böll sie auch so verstanden: Rauchzeichen am Rande der Apokalypse.
"27.11.43 Gräben gebaut. Mittags trinke ich mit Leutnant Spieß einen wunderbaren Cognac und wir träumen zusammen vom Leben und erzählen uns.
Die ewige Qual des Essenholens durch das Trichterfeld bei schwerem Granatwerfer-Feuer.
2 Mann meiner Kp werden vom eigenen MG erschossen.
Die Läuse lassen mich nicht mehr schlafen. Nachmittags große Entlausung gehalten vor dem Bunker entsetzliches ekelhaftes Gezücht der Läuse.
Nachts Träume vom Bunker"
Sehnsucht nach Sprache
Doch es sind keine Rauchzeichen, es ist Schrift, die vielleicht nur von einem erzählt: von der Sehnsucht nach Sprache. Inständiger hat man das Verlangen nach Sprache mitten aus der Sprachlosigkeit kaum je erfahren können als in diesen Kurzgebeten und Stenoflüchen. Wer diese Tagebücher eines Sprachlosen gelesen hat, der versteht, warum Heinrich Böll nach dem Ende des Krieges nur eines im Sinne hatte: Schreiben. Worte als Brot.
"Man hat das noch nicht begriffen, was es bedeutete, im Jahr 1945 auch nur eine halbe Seite deutscher Prosa zu schreiben."
Wird er mehr als 20 Jahre später in seinen Poetik-Vorlesungen feststellen. In diesen Vorlesungen entwirft er auch sein literarisches Projekt: die Suche nach "einer bewohnbaren Sprache in einem bewohnbaren Land". Dazu musste er wahrscheinlich die tiefe und lange Erfahrung einer unbewohnbaren Sprache in einem unbewohnbaren Land auf sich genommen haben. Davon handeln seine Kriegstagebücher, davon zeugt ihre Ästhetik des Unsäglichen. Insofern sind sie tatsächlich auf ihre Weise sensationell.
Heinrich Böll: "Man möchte manchmal weinen wie ein Kind. Die Kriegstagebücher 1943 bis 1945", Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017, 352 Seiten, 22,00 Euro.