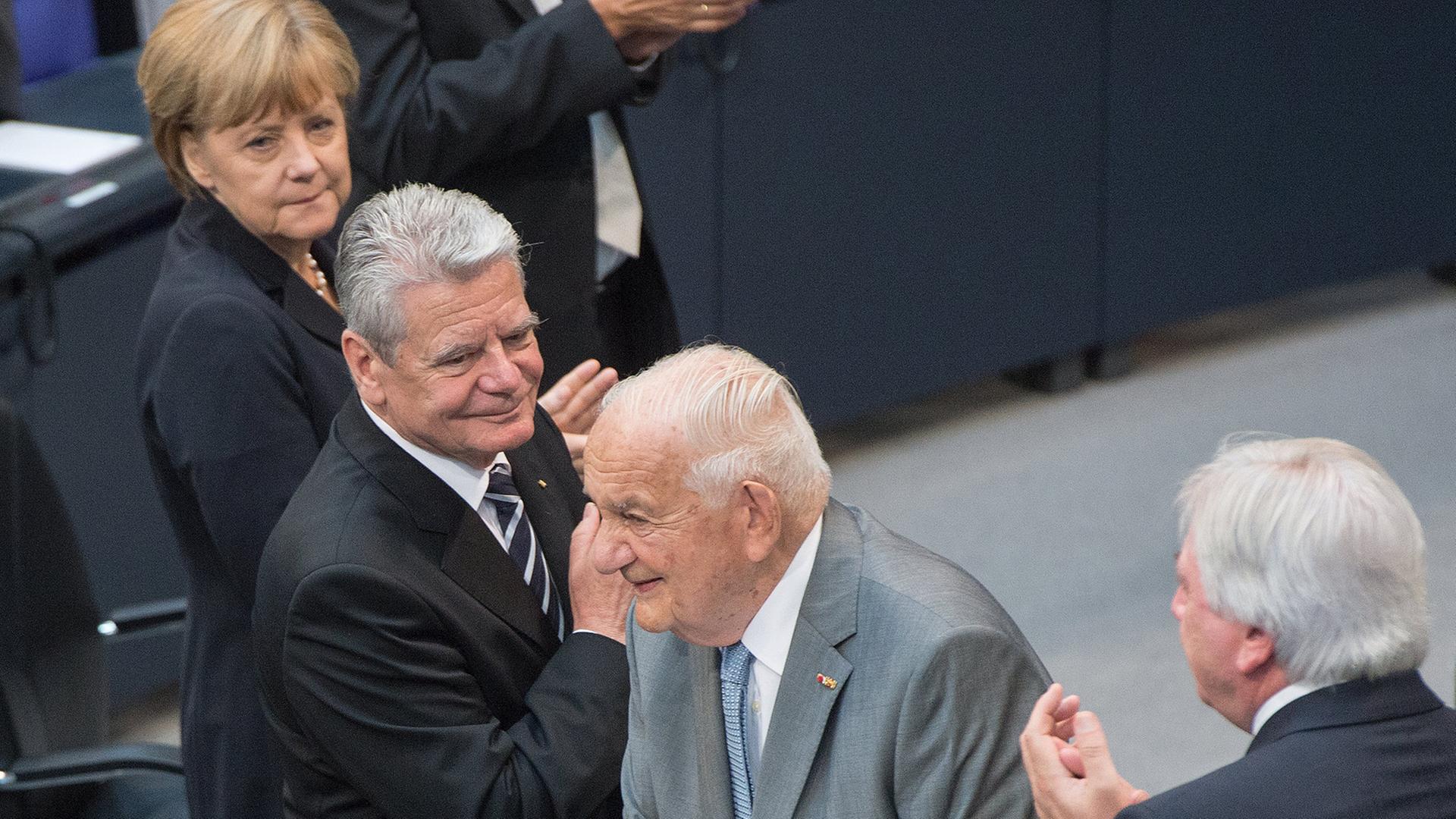Nicht mangelnde Gesprächsbereitschaft, sondern eskalierendes Misstrauen zwischen den europäischen Mächten sei 1914 der Hauptgrund für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gewesen, sagte Politikwissenschaftler Herfried Münkler im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Dies sei eine beunruhigende Parallele zu den Krisen der Gegenwart. Die Konfliktparteien würden auch heute den Worten des jeweils Anderen keinen Glauben mehr schenken. Dies zeige sich vor allem im Ukraine-Konflikt.
Der Politikwissenschaftler sieht momentan auch keine internationale Organisation, die stark genug sei, langfristige Perspektiven aufzuzeigen und damit stabilisierend zu wirken. Dennoch glaubt Münkler nicht daran, dass die Welt quasi unmittelbar vor der Ur-Katastrophe des 21. Jahrhunderts stehe. Geschichte wiederhole sich niemals eins zu eins – und die Atomwaffen würden ein leichtfertiges Spiel mit dem Krieg verhindern.
Mario Dobovisek: Srdjan Govedarica über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Und am Telefon begrüße ich Herfried Münkler. Er ist Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin und Autor des Buches „Der große Krieg“. Ich grüße Sie, Herr Münkler!
Herfried Münkler: Guten Morgen, Herr Dobovisek!
Dobovisek: Sie haben sich nicht allein mit den historischen Quellen befasst, vielmehr mit den politischen Zusammenhängen, mit den Akteuren von damals. Ein Mord in Sarajewo, das Spiel der Großmächte, der Wunsch nach Aufklärung, nach Rache. Heute Flug MH17, die Separatisten in der Ostukraine, Russland hier, der Westen dort – sehen Sie Parallelen, Herr Münkler?
Münkler: Ja, man kann schon Parallelen sehen, man muss nur mit diesen Parallelen vorsichtig umgehen und nicht glauben, dass sich Geschichte eins zu eins wiederholt. Aber man kann vermutlich doch sagen, dass auf der einen Seite Einkreisungsängste, also 1914 beim Deutschen Reich, die dazu führte, dass man eine eher riskante Politik machte. Und heute, bei der politisch-militärischen Elite in Moskau, die auch dazu führt, dass die Russen eine ausgesprochen riskante Politik machen. Das ist eine. Oder eine andere dieser Parallelen ist, dass solche Konflikte von der Peripherie her kommen, wo man sie eigentlich gar nicht erwartet hatte. Wir haben uns auf ganz andere Fragen eigentlich in der letzten Zeit konzentriert gehabt und hatten die östliche Ukraine und zuvor die Krim als eine der großen, schlagenden Herausforderungen der europäischen Sicherheit gar nicht auf dem Schirm. Man kann sagen, dass jedenfalls 1914, was die britische Politik anbetrifft, die mit ganz anderen Fragen lange Zeit beschäftigt war und keine Aufmerksamkeit für den Balkan hatten, und eigentlich war auch der Balkan nicht im Fokus der deutschen Politik gewesen.
Dobovisek: Die Politiker von heute haben gelernt, sie sprechen miteinander, telefonieren, treffen sich, verhandeln, dann herrscht wieder Funkstille, und wieder gibt es Verhandlungen. Und das unterscheidet das Heute vom Gestern vor hundert Jahren. Stecken wir dennoch in einer Art modernen, lang gestreckten Juli-Krise?
Münkler: Ach, das glaube ich nicht, denn unterm Strich haben wir ja diese Juli-Krise von 1914 vor Augen, und jetzt, anlässlich des 100. Jahrestags haben wir sie besonders vor Augen. Und man kann vermutlich sagen, dass jeder leidlich verantwortliche Politiker, und das gilt vermutlich auch für die Russen, im Schatten dessen agiert und versucht, alles zu vermeiden, was dann die Katastrophe vom späten Juli 1914 herausführt. Aber man kann, denke ich, wenn man die Juli-Krise von 1914 gegen die gegenwärtige Entwicklung legt, doch sehen, was man alles falsch machen kann. Und je weniger man falsch macht in diesem Zusammenhang, desto größer sind die Chancen, dass wir einigermaßen heil und vernünftig aus diesem Konflikt herauskommen.
Dobovisek: Der Historiker Christopher Clarke spricht von einem vereinten Amoklauf Europas, dem Schlafwandeln hinein in die Katastrophe. Wäre der Erste Weltkrieg mit dem heutigen Ansatz von Gesprächs- und Shuttle-Diplomatie vermeidbar gewesen?
Münkler: Ja. Er wäre in jedem Fall vermeidbar gewesen, nur glaube ich nicht, dass das Problem 1914 die fehlende Gesprächsbereitschaft gewesen ist. Es ist eher wohl so etwas wie eskalierendes Misstrauen gewesen, dass man also das, was man einander schreibt, telegrafiert, zusagt, nicht mehr ernst nimmt. Das ist etwas, was wir zurzeit auch beobachten.
Dobovisek: Welche sind die wichtigsten politischen Lehren aus dem Ersten Weltkrieg?
Münkler: Also nach meiner Auffassung ist der Erste Weltkrieg ja kein Krieg, bei dem man sagen kann, die Deutschen hat die Hauptschuld getroffen in dem Sinne, dass sie ganz bewusst diesen Krieg angezettelt und auf ihn hingearbeitet haben, sondern es hat bei dem Weg in diesen Krieg eine Fülle von Fehleinschätzungen und Illusionen – das ist deutsche Verantwortung –, aber auch von Zufällen gegeben. Und man braucht so etwas wie Institutionen, die solche dummen Zufälle wie gerade die beim Attentat von Sarajewo herausfiltern, die also die politische Ordnung eher für langfristige, rationale Perspektiven robust machen. Und vielleicht war ja auch der Abschuss dieser malaysischen Maschine über der Ostukraine einer dieser dummen Zufälle, die furchtbar weitreichende Folgen haben können. Und im Prinzip, kann man sagen, haben wir daraus gelernt. Die Arrangements des Kalten Krieges waren eigentlich so aufgebaut, dass solche Zufälle nicht passieren konnten.
Dobovisek: Welche Institution ist es denn heute, die als funktionierender Filter agiert, wenn es denn die Vereinten Nationen längst nicht mehr sein können?
Münkler: Das ist eine ganz schwierige Frage, wissen Sie. Ich meine, vor ein paar Monaten hätte man dann doch vielleicht gesagt, OSZE, und ein bisschen skeptisch auf die NATO geschaut, aber die geringen Handlungsmöglichkeiten der OSZE selbst bei der Sicherung einer Absturzstelle, und die Flucht vieler mittel-/osteuropäischer politischer Akteure in die NATO – sei es, dass sie schon drin sind, sei es, dass sie hinein wollen. Und dies spricht eigentlich dafür, dass sich auch hier die Gewichte wieder verschoben haben und ein starkes Bündnis den doch wohl zuverlässigeren Schutz bietet.
Dobovisek: Mit dem Ersten Weltkrieg zerbrachen die großen Imperien von einst, bis auf die Sowjetunion, die in gewisser Weise in die Fußstapfen des alten Russlands trat. Erleben wir in der Ukraine und den anderen Post-Sowjet-Staaten im Grunde die Folgen des Ersten Weltkrieges, nur mit deutlicher Verspätung?
Münkler: Das kann man sagen. Vom westlichen Balkan bis in den Kaukasus mit der Ukraine und dem Schwarzen Meer mittendrin, haben wir es mit postimperialen Räumen zu tun, in denen keine stabilen Nationalstaaten entstanden sind. Aber man muss dann auch hinzufügen, dass das nicht nur diese Räume sind, sondern auch der Mittlere und Nahe Osten – meine ich jetzt gar nicht den derzeitigen Konflikt um Gaza, sondern eher den fortlaufenden Bürgerkrieg in Syrien, den Zerfall des Irak und derlei mehr. Auch das sind ja im weiteren Sinne Ergebnisse des Ersten Weltkriegs. Und insofern ragen dessen Spuren und Folgen weit ins 21. Jahrhundert rein und werden vermutlich die Europäer in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten sehr intensiv beschäftigen.
Dobovisek: Was sagt uns das über die tatsächliche Lernbereitschaft?
Münkler: Na ja, man soll nicht glauben, in der Politik kann man etwas ein für alle Mal lernen, in trockene Tücher packen, in den Schrank legen und dann ist es ein fester Besitz, sondern man muss immer wieder von Neuem in riskanten Situationen sich darum bemühen, aus dem, was man gewissermaßen vor sich und analysiert hat, Schlussfolgerungen zu ziehen, die die negativen Elemente dessen vermeiden und die positiven Elemente dessen verstärken. Mehr ist vermutlich nicht drin.
Dobovisek: Deutschland, einst als Zentralmacht Europas, China heute, das Reich der Mitte Asiens, wirtschaftlich aufstrebend, durchaus mit imperialistischem Auftreten, wenn wir uns zum Beispiel den Inselstreit ansehen. Erleben wir hier den Beginn neuer Konfrontationen zum Beispiel mit den USA?
Münkler: Das ist nicht auszuschließen. China kann vor Kraft kaum laufen, hat aber politisch nicht sehr viel Erfahrung, dafür ökonomisch Riesenpotenz. Das verbindet es mit dem wilhelminischen Deutschland von vor 1914. Es ist so stark, dass sich von selber antihegemoniale Koalitionen bilden. Und es muss Zugriff auf See haben, so wie die Deutschen das damals glaubten, zu müssen. Und deswegen bauen sie jetzt eine Flotte auf, die die USA herausfordern könnte. Und das sind durchaus eher mit Skepsis zu betrachtende Entwicklungen.
Dobovisek: In den aktuellen Konflikten hält sich China aber auffällig zurück. Warum?
Münkler: In den aktuellen Konflikten hat sich Deutschland auch in vieler Hinsicht damals zurückgehalten. Und die Chinesen haben ein Interesse daran, ihre Umgebung unter Kontrolle zu haben, auf die Einfluss zu haben, aber sie haben kein Interesse daran, so etwas wie globale Verantwortung zu übernehmen. Das ist nach wie vor die Rolle der USA, die allerdings in Relation zu ihren potenziellen Konkurrenten an Überlegenheit abgenommen haben. Und das ist sicherlich auch ein Problem.
Dobovisek: Sehen Sie derzeit eine Krise, die so viel Potenzial in sich trägt, um die große Katastrophe des 21. Jahrhunderts zu werden?
Münkler: Nein, das glaube ich nicht. Wir haben halt diese Katastrophen des 20. Jahrhunderts vor Augen und handeln im Wissen darum. Und dann gibt es natürlich auch noch die Atomwaffen, die ein so leichtfertiges Spiel mit dem Krieg als einer Option, was für 1914 gilt, in dieser Weise verhindern. Die Probleme, die wir heute haben, das sind andere. Das sind eher kleine, unordentliche, häufig nicht-territoriale Akteure wie etwa diese ISIS in Syrien und im Irak oder auch die eigentümliche Mischung aus Separatisten, Räuberbanden in der Ostukraine, die hier Verwirrung und Irritationen hervorbringen und bei denen man nicht genau weiß, wie man sie auf eine rationale Verhandlungslinie zu bewegen hätte.
Dobovisek: Der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler über die Lehren des Ersten Weltkrieges. Heute vor 100 Jahren erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Ich danke Ihnen, Herr Münkler!
Münkler: Bitte schön!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.