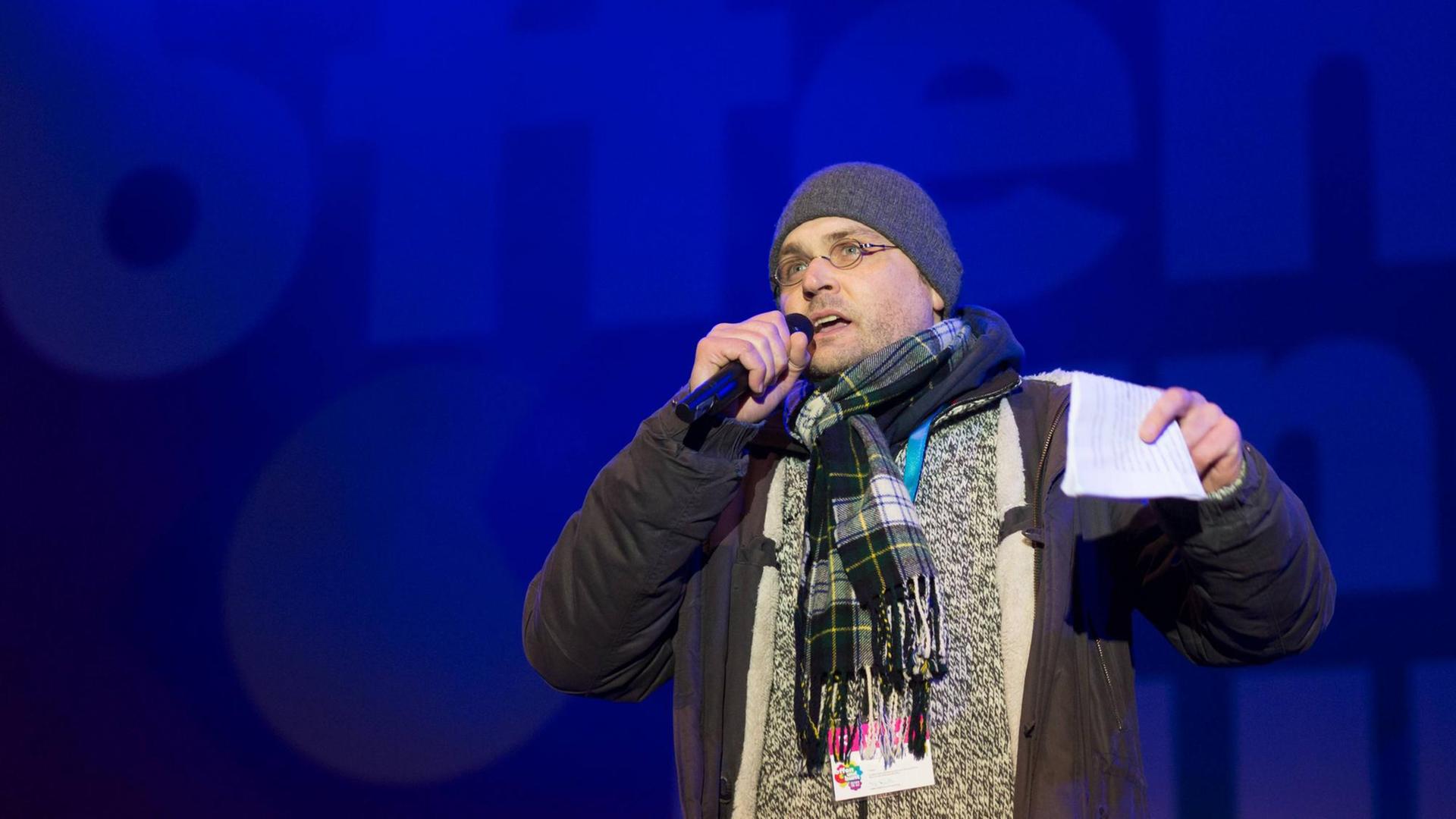Änne Seidel: Stardirigenten veranstalten Willkommenskonzerte für Flüchtlinge. Theaterregisseure kämpfen gegen Pegida und Fremdenhass und der Deutsche Kulturrat fordert auf zum Widerstand gegen die AfD. Egal wohin man schaut, die Kultur mischt sich ein in die drängenden Fragen, die Gesellschaft und Politik zurzeit beschäftigen. In "Kultur heute" sprechen wir in diesen Tagen über dieses politische Engagement von Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen und wir wollen fragen, wie politisch kann, darf und sollte die Kultur sein in Zeiten wie diesen. Heute hören wir dazu Bernhard Maaz, den Direktor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Er betreut die wichtigsten staatlichen Museen Bayerns, allen voran die Münchener Pinakotheken. Bayern ist aber, wie wir wissen, das Bundesland, das von Horst Seehofer regiert wird, und der ist bekanntermaßen nicht gerade ein Fan der sogenannten Willkommenskultur. Daher die Frage an Bernhard Maaz: Wird die Willkommenskultur in Ihren Museen trotzdem gelebt?
Bernhard Maaz: Ja. Wir haben etwas getan, was für Bayern neu ist und auch in dieser konsequent durchgeführten Art ganz neu. Wir haben in den letzten Wochen einen Ausstellungsraum nicht für Sonderausstellungen benutzt, sondern eingerichtet für die Arbeit mit Flüchtlingen. Das ist ein Paradigmenwechsel, der auch vor dem Hintergrund der politischen Situation in Bayern gar nicht problematisch ist. Im Gegenteil. Wenn wir die Willkommenskultur hinterfragen, dann hinterfragen wir die Kultur, und wir müssen in dieser Richtung weiter arbeiten. Wir müssen neue Wege gehen. Einen Raum einzurichten, in dem man museumspädagogische Programme starten kann, die interkulturell aktiv sind, heißt ja nur, auf die Situation, die wir gerade in Bayern sehr stark haben, zu reagieren, und zwar offensiv zu reagieren, einladend zu reagieren, und das kostet uns Arbeit, Kraft, Zeit, aber das ist nicht eine Frage von viel Geld, sondern eine Frage von viel Überlegungen.
"Sie schauen sich zunächst eine große Arbeit von Beuys an"
Seidel: Dieser Raum, den Sie eingerichtet haben - in dem führen Sie museumspädagogische Programme durch, sagen Sie. Vielleicht machen Sie das noch mal ein bisschen konkreter. Was genau passiert da?
Maaz: Es gab, um es jetzt ganz konkret zu machen, im Vermittlungsprogramm die Begegnung von 40 Migranten aus Nigeria, aus dem Kongo, es waren Syrer dabei, Somali, also viele Nationen, verschiedene Kulturen, verschiedene Sozialisierungen. Die arbeiten in diesem Raum. Sie schauen sich zunächst eine große Arbeit von Beuys an.
Seidel: Welche ist das?
Maaz: Das ist die Arbeit mit den Schlitten, die die Besucher natürlich kennen. Schlitten, Taschenlampen, Fett, was die klassischen Beuys-Materialien sind, und das sind Materialien, die wollen zeigen, dass der Mensch unterwegs ist, und die Taschenlampe und das Fett, das sind die ultimativen Ressourcen, die man haben muss. Es wurde mit diesen Migranten gewissermaßen etwas angeschaut, was zeigt, man kann unterwegs sein. Der Schlitten ist ja ein Fortbewegungsmittel, wenn auch ein sehr spezifisch auf der Nordhalbkugel unterwegs seiendes. Es sind archetypische Elemente des Wagen, des Wandernden, der Not, und diese Veranstaltung hat die Migranten damit beschäftigt, was ist Kunst bei uns, was hat diese Kunst vielleicht mit ihrem Leben zu tun. Wenn man das klassische Material von Beuys, nämlich den Filz hernimmt und dann sagt, daraus können wir Taschen machen, dann wird gezeigt, wie man sich in einer anderen Kultur orientiert, wie man mit der Not und dem Elementaren umgeht. Es geht um kulturelle Erfahrungen und darum, wie man sich darüber austauscht.
Seidel: Dieses Programm richtet sich aber ja ausdrücklich nicht nur an Flüchtlinge, sondern auch an bayerische Mitbürger. Ist das auch der Versuch, eventueller Kritik da gleich zuvorzukommen, Kritik, die etwa lauten könnte, warum immer nur für die Flüchtlinge, wo bleiben eigentlich die Deutschen?
Maaz: Das ist nicht ein Ansatz, den wir verfolgen, sondern das ist ein Kollateralnutzen, wenn man so will. Integration funktioniert ja nicht, wenn wir nur die Migranten untereinander integrieren wollen, sondern sie funktioniert ja nur dann wirklich, wenn es kulturelle Begegnungen mit dem Land gibt, in das sie gekommen sind.
"Wir haben nicht die Aufmärsche der Pegida vor der Galerie"
Seidel: Jetzt sind solche Angebote für Flüchtlinge das eine. Solche Angebote lassen sich ja sehr gut einbetten in die kulturpädagogische Aufgabe, die Museen ohnehin zu erfüllen haben. Es gibt zurzeit aber viele Kulturinstitutionen, die noch weit darüber hinausgehen, die auch ganz klare politische Statements abgeben. Die Dresdener Semperoper ist da ein gutes Beispiel, die sich ja mit vielen Aktionen, mit Bannern überm Eingang etc., gegen Pegida einsetzt und für ein offenes Dresden kämpft. Warum machen Sie so etwas nicht?
Maaz: Zum einen ist die Spezifik von Dresden natürlich landauf, landab bekannt. Wir haben nicht die Aufmärsche der Pegida vor der Galerie oder vor der Semperoper, aber wir sind dadurch nicht unpolitisch, sondern wir suchen diesen Weg der konkreten Begegnung von Mensch zu Mensch. Darin sehen wir unsere Stärke und wir müssen nicht die Plakate raushängen, dass wir ein offenes Haus sind, sondern hier ist die Zielgruppe etwas anders.
Seidel: Jetzt gab und gibt es aber ja in der bildenden Kunst immer auch sehr politische Strömungen. Joseph Beuys haben Sie gerade schon angesprochen. Aktuell gibt es zum Beispiel einen Künstler wie Ai Weiwei, der Installationen aus Rettungswesten bastelt, um aufmerksam zu machen auf das Leid der Flüchtlinge. Wäre es dann nicht durchaus passend, zu sagen, auch das Museum soll ruhig tagespolitisch reagieren, genau wie es zum Beispiel auch viele Theater tun?
Maaz: Kunst, bildende Kunst ist langsamer als das Theater. Sie reift, sie ist bildend, da bildet sich etwas heraus. Das Theater ist schneller. Das ist ein altes Phänomen. Bildende Kunst war immer politisch. Wenn Sie unser Dürer-Selbstporträt sich vergegenwärtigen, dann werden Sie wissen, der hat einen Pelz und damit hat er eigentlich die Standesgrenzen des Bürgers überschritten. Er hat sich politisch manifestiert, indem er die Kleiderordnung des Hofes auf sich applizierte. In der Kunstgeschichte gibt es das immer wieder. Es gilt, das herauszuarbeiten, es gilt, das aufzuzeigen, es gilt, das in der Vermittlung deutlich zu machen. Und in der Gegenwartskunst - wir hatten vor Kurzem eine Ausstellung mit Olaf Metzel. Da hat er eine Arbeit gezeigt in der Neuen Pinakothek, also im Kontext des 19. Jahrhunderts, mit dem Titel "Lampedusa", also genau die Insel, über die die Flüchtlinge ja schon sehr lange kommen. Eine Arbeit, die in den letzten zwei Jahren entstanden ist und die genau diesen Konflikt zwischen Schönheit, eine Insel, oder zwischen dem Italien-Bild, Italien als das Land der Sehnsucht, und den politischen Entwicklungen dort überbrückt und die das thematisiert. Die Einbettung politischer Fragen in die bildende Kunst ist ein Teil der Aufgabe der bildenden Kunst. Es geht um Menschheitsfragen und darunter sind politische Fragen natürlich auch enthalten.
"Kultur ist auch verletzlich, angreifbar"
Seidel: Kommen wir vielleicht doch noch mal kurz zurück auf Dresden. Sie kennen Dresden sehr gut, Sie waren bis zum vergangenen Jahr Direktor der Dresdener Gemäldegalerie alter Meister und des Kupferstich-Kabinetts. Würden Sie denn sagen, dass das Engagement der Dresdener Kulturinstitutionen für eine Stadt wie Dresden, in der die Stimmung zurzeit sehr angespannt ist, dass diese Haltung dort angemessen ist, oder würden Sie sagen, auch da geht das vielleicht ein bisschen zu weit?
Maaz: Ich glaube, dass die Dresdener Kultureinrichtungen in der Stadt die aktivsten sind, die damit umgehen, und insofern finde ich das sehr respektabel, zum Teil sogar mutig, denn man muss sich ja vergegenwärtigen, dass Kultur auch verletzlich ist, angreifbar ist. Ich glaube, dass die gesamte Gesellschaft der Stadt noch viel stärker aus allen Ecken ihre Positionen beziehen müssten, und ich glaube, dass in Dresden die Kultureinrichtungen mit ihren Sprüchen, mit ihren Fahnen an den Gebäuden schon eine ganze Menge beigetragen haben dazu, dass der Diskurs über die Fragwürdigkeit von Pegida in der Stadt sichtbar geführt wird und nicht nur am Küchentisch und nicht nur in den Villen am Elbhang.
Seidel: Ich frage mich trotzdem manchmal, ob vielleicht unter dem Dresdener Kulturpublikum nicht doch auch Menschen sind, die vielleicht nicht unbedingt auf Pegida-Demos gehen, aber die trotzdem nicht jedes Jahr Hunderttausende Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen wollen und die das vielleicht durchaus abschrecken könnte, wenn sich die Oper, wenn sich das Theater so klar positioniert, und zwar pro Flüchtlinge positioniert.
Maaz: Kultur muss angeboten werden für alle. Nicht alle werden sie annehmen. Wir wissen, dass es immer nur ein Anteil der Bevölkerung ist, der sich dafür wirklich interessiert und engagiert. Kultureinrichtungen sind einer der wichtigsten Diskursräume der Gesellschaft und insofern ist es völlig richtig, dort solche Fragen zu stellen, die Frage nach dem Menschheitlichen, nach der Humanität. Und wenn wir uns erinnern: Lessing hat mit seiner Ring-Parabel letztendlich den ganzen Diskurs exemplarisch geführt auf dem Theater, den Diskurs, wie tolerant ist der Mensch dem anderen, dem Fremden gegenüber, der anderen Konfession gegenüber. Theater war immer politisch, Kunstwerke - wir haben das vorhin berührt - sind auch immer wieder politisch gewesen, vor 500 Jahren wie heute. Aber die Politik ist innerhalb der Menschheitsfragen eben nur das eine und es geht auch um die Individualität, um die Integrität des Menschen, die sich zum Beispiel in Porträts manifestieren kann. Es geht darum, Menschlichkeit zu vermitteln und nicht nur Politik. Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass das Kunstmuseum nicht die Plattform ist für die Karikatur. Es gibt die tagesaktuelle Karikatur in der Zeitung und es gibt das Kunstmuseum, das die Aufgabe hat, längerfristige Fragen zu stellen.
Seidel: … sagt der Direktor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, sagt Bernhard Maaz auf die Frage, wie politisch sollte Kultur, sollten Kulturinstitutionen sein.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.