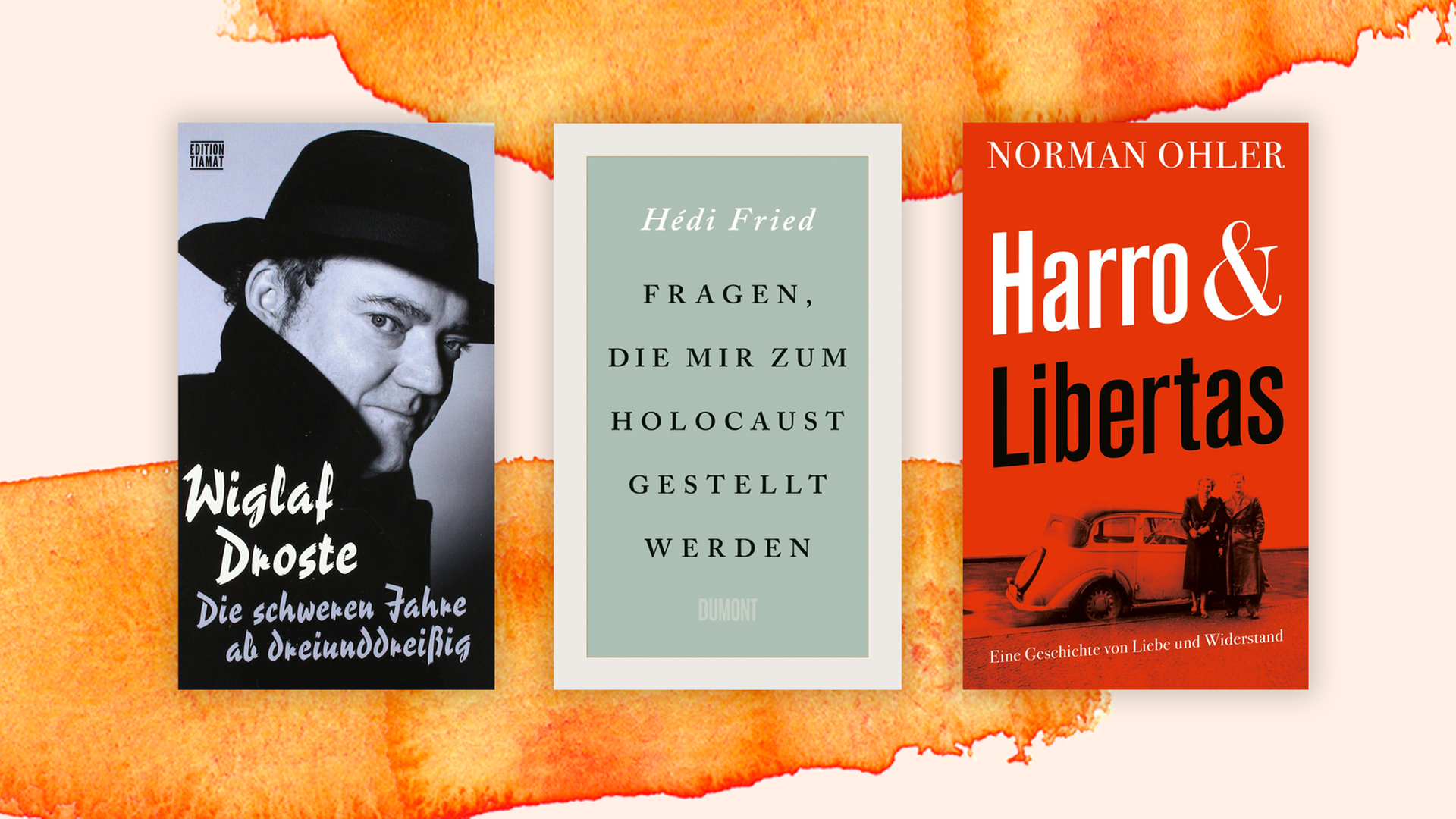„Lesen ist zunächst eine Kompetenz mit der wir Geschriebenes verarbeiten“, erklärt Dr. Simone Ehmig, Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen in Mainz.
„Lesen wird aber auch verstanden häufig – und das ist sicher für Deutschland noch einmal sehr spezifisch – als ein Kulturgut im Sinne von Bücher lesen, von Literatur lesen, das ist häufig ein Synonym dafür in unserer Gesellschaft – aber es meint viel mehr.“
Lesen findet ständig und überall statt. An der Bushaltestelle, im Straßenverkehr, in der Apotheke, im Restaurant, am Bahnsteig, im Beruf und natürlich in der Schule. Da wundert es kaum, dass jedes Mal, wenn ein neues Medium auftaucht, eine Art Kulturverfall befürchtet wird. Das war schon bei der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert so. Doch trotz Comics, Film, Fernsehen und Internet, ist das Lesen nicht verschwunden.
„Wir sehen seit Ende der 90er Jahre, seither gibt es solche Studien, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in Büchern lesen überhaupt nicht zurückgegangen ist.“
Digitale Lese-Lern-Programme
Die Studien zum Leseverhalten von Kindern lassen Simone Ehmig von der Stiftung Lesen relativ entspannt auf die digitale Konkurrenz blicken. Sie erhofft sich vielmehr von guten digitalen Lese-Lern-Programmen künftig Unterstützung für die erstaunlich hohe Zahl der Menschen, die auch nach 9 Jahren Schule nicht oder nur schlecht lesen und schreiben können.
„Wir haben in Deutschland 6,2 Millionen Erwachsene, die im Lesen benachteiligt sind, die es nicht richtig können, maximal auf Satzebene. Wir haben unter den 15jährigen, das sind die letzten Pisa-Ergebnisse, fast 17 % Jugendliche, die nicht gut lesen können und wir haben unter den Grundschülerinnen 4. Klassen fast 19%.“
Die Angst vor der Verdrängung des Bücher-Lesens durch digitale Medien sei nicht ganz unbegründet, meint der Kognitionsforscher Prof. Sascha Schröder von der Universität Göttingen. Lesen macht Grundschülern mehr Mühe, als ein Video anzuschauen.
„Die Gefahr besteht, weil wir pessimistisch formuliert in einer medialen Konkurrenzsituation sind. Verschiedene Sinneskanäle konkurrieren umeinander. Und das was gerade am Anfang vielleicht schwieriger fällt, muss dann zwischen dem Einfachen sich erstmal durchsetzen.“
Aufwachsen mit Smartphones
Seit 2012 haben wir erstmals eine Vollversorgung mit digitalen Geräten, insbesondere Smartphones. Diesen Sommer sind also die ersten so aufgewachsenen Kinder in die Schule gekommen. Sie alle haben vermutlich schon viele spannende Stunden an Handys, Tabletts und PCs verbracht. Was macht das mit ihrer Bereitschaft, sich jetzt mühsam Wort für Wort, Satz für Satz zu erarbeiten? Die Forschung steckt hier noch in den Kinderschuhen. Sie weiß wenig über die Wechselwirkung zwischen analogen und digitalen Lesemedien, gerade bei Leseanfängern.
„Das Problem ist, dass die Forschung immer den politischen und öffentlichen Diskurs hinterherhinkt. Wir haben jetzt Digitalpakt Schule, es werden Millionen, Milliarden für Hardware ausgegeben und wir haben nur bedingt Vorstellungen davon, wie wir die überhaupt gut oder sinnvoll einsetzen können.“
Genau das war der Grund, warum die Norwegerin Prof. Anne Mangen vom Zentrum für Leseforschung an der Universität in Stavanger zusammen mit anderen Leseforschern vor knapp fünf Jahren das Projekt E-Read ins Leben gerufen hat.
„In Norwegen wurden die Schulen gerade im großen Stil mit digitalen Medien ausgerüstet, ohne dass irgendjemand genau wusste, welche Auswirkungen das hat. Diese Entscheidungen sind nicht auf irgendeiner wissenschaftlichen Grundlage getroffen worden.“
Tiefes Lesen braucht Papier
Unter dem Akronym E-READ versammelten sich deshalb rund 130 Sozialwissenschaftler, Neurowissenschaftler, Kognitionsforscher, Psychologen und Geisteswissenschaftler aus mehr als dreißig Ländern, die gemeinsam über die Veränderungen des Lesens durch die Digitalisierung forschten und diskutierten. Im Januar endete das Projekt mit der sogenannten Stavanger Erklärung:
„Wir beginnen zu verstehen, welche Faktoren einen Unterschied machen könnten. In vielen Bereichen des Lesens macht es keinen Unterschied, ob der Text digital oder auf Papier gelesen wird. Das sind vor allem die kleinen, typischen Leseschnipsel zwischendurch hier und da auf social-media, Blogs. Aber längere Texte verlangen eine größere Aufmerksamkeit und kognitive Präsenz über einen längeren Zeitraum, was man meist als vertieftes Lesen bezeichnet. Und hier sehen wir, dass dieser Leseprozess weniger gelingt mit digitalem Lesen.“
Qualitatives und vertieftes Lesen braucht Papier – zumindest noch, erklärten die Stavanger-Wissenschaftler.
„Es sind drei Metastudien und eine davon ist direkt aus dem Projekt entstanden. Es gibt einen Unterschied, das ist ein sehr solides Ergebnis.“
Digitale Vorteile kaum erforscht
Verglichen wurde das Leseverständnis linearer Texte auf dem Bildschirm und auf Papier. Die größte der drei Studien, die Delgado-Metastudie, untersuchte 54 vergleichende Lese-Analysen mit mehr als 170 000 Teilnehmern. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Erinnerungsleistung und das Textverständnis der Leser sind auf Papier besser als am Bildschirm. Allerdings gilt das nur für einen schmalen Ausschnitt des Lesens, schränkt Sascha Schröder ein, der selbst am Forschungsprojekt E-Read beteiligt war.
„Es ist zum Beispiel nur für das Lesen von Sachtexten relevant, nicht für narrative, fiktionale Texte, was aber häufig so verstanden wurde. Es ist nur relevant wenn Zeitdruck besteht, nicht wenn sozusagen freies Leseverhalten ist und es ist auch nur dann der Fall, wenn wir Texte haben, die vergleichbar sind. Die Studien, die dort untersucht worden sind waren so dass man den gleichen Text entweder auf dem Papier oder auf dem Papier oder auf dem Computer gesehen hat. Das ist eine sehr spezielle Form von Text. Also all die potenziellen Vorteile, die digitale Formate bieten können, konnten aus rein methodischen Gründen gar nicht untersucht werden, einfach weil ihre Vergleichbarkeit sonst nicht gegeben wäre.“
Denn Texte wie sie beispielsweise Wikipedia liefert haben Hyperlinks, bieten Hintergründe, verweisen auf andere Texte, Audio und Bildmaterial. Das gibt es auf Papier so nicht.
„Wir wissen, dass mediale Formen sehr gut genutzt werden können in Unterrichtssituationen. Wir kennen auch bestimmte Prinzipien, die dabei eingehalten werden sollten, die sich auch immer wieder in der Forschung bestätigen. Zum Beispiel sollte nicht der gleiche Inhalt schriftlich und mündlich gleichzeitig dargeboten werden, also über zwei unterschiedliche Sinneskanäle. Das ist das Problem mit den übervollen Powerpoint-Folien, weil man muss Lesen und Hören gleichzeitig, sowas hat keine guten Effekte. In Bezug auf das Lesen lernen in den neuen Kontexten und der Lesesozialisation wissen wir eigentlich fast noch nichts und das liegt daran, dass die erste Generation ja jetzt heranwächst.“
Vorlesen hilft
Wenn Eltern ihren Kindern vorlesen und mit ihnen sprechen, dann haben sie bessere Chancen selbst gute Leser zu werden. Das wissen wir schon lange. Noch vor der Schule setzen Eltern in ihrem Medienverhalten als Vorbild deutliche Zeichen, erklärt Simone Ehmig von der Stiftung Lesen.
„Wir haben gerade die neue Vorlesestudie veröffentlicht, und dort sehen wir, dass wir aktuell 32 Prozent Kinder haben zwischen zwei und acht Jahren, denen die Eltern nicht oder zu selten vorlesen.// Hier liegt eine ganz klare Bildungsbenachteiligung, die sich dann auch fortsetzt, wenn wir nichts dafür tun, diesen Kreislauf zu unterbrechen.“
„Mich interessiert vor allen Dingen, was sind die Prozesse, die beim Lesen ablaufen, warum fallen die bestimmten Personen schwer und was können wir dagegen tun? Das heißt meine Perspektive ist pädagogisch gedacht.“
Der Kognitionsforscher Sascha Schröder setzt dabei auf die Potenziale des Digitalen.
„Zum ersten Mal in der Historie der Schriftsprache können Bücher sich den Lesern anpassen und nicht die Leser an die Bücher. Wir wissen, dass gerade Kinder mit Dyslexie von größeren Abständen zwischen den Buchstaben profitieren würden. Das hat was damit zu tun, dass es sowas wie eine visuelle Überlastung gibt.“
Relativ einfach ließe sich der Buchstabenabstand in digitalen Programmen für Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche vergrößern. Der Psychologe forscht in Göttingen gerade daran, wann Kinder mit Leseproblemen aus einem Text herausgeworfen werden. Das geschieht durch die einfache Installation einer Kamera über dem Bildschirm, die die Blickbewegungen des Lesers aufzeichnet.
Interaktive Lese-Programme
„Wir können zum Beispiel verfolgen ob ein Leser gerade Probleme mit dem Text hat oder nicht. Und in Abhängigkeit von dieser Entscheidung, die online vorgenommen wird, wäre es auch möglich zum Beispiel die sprachliche Komplexität herunter oder hochzuschrauben. Thema einfache Sprache usw.“
Indem die Blickbewegungen verfolgt werden, lässt sich auch erkennen, ob jemand den Text wirklich liest oder sich nur so durchklickt. Künftig könnten interaktive Programme dann zwischendurch eine Verständnisfrage stellen oder zur Erhöhung der Motivation auf ein Bild oder ein kurzes Video umlenken.
„Da haben wir genau interaktive Systeme, die in den Lernprozess eingreifen in einer Form, wie es sonst in Unterrichtssettings nicht möglich ist. Das hat zumindest ein großes Potenzial. Wir als Grundlagenforscher sind aber gerade erst dabei zu untersuchen, woran erkennen wir denn, dass jemand beim Lesen Probleme hat, was sind das für Merkmale, sind die in der dritten und der achten Klasse gleich und wie können wir die Prädiktionsgenauigkeit von solchen Systemen erhöhen?“
Aufmerksamkeit, Konzentration und Zeitmanagement sind weitere Merkmale, mit denen sich die aktuelle Leseforschung befasst. Jeder kennt wohl das Phänomen: Die Internet-Recherche beginnt bei der Suche nach einem bestimmten Laubbaum und endet in den neuesten Szenarien der Klimaforschung. Das Netz ist manchmal verlockend weit gespannt, da kann die gezielte oder gründliche Lektüre schnell zu kurz kommen.
Das hat die norwegische Leseforscherin Anne Mangen zusammen mit einer US-amerikanischen Linguistin in einer gerade beendeten qualitativen Studie festgestellt. Die Forscherinnen fragten Professoren verschiedener Fakultäten in den USA und Norwegen, ob sie in den letzten Jahren Veränderungen in dem Umgang mit Texten bei ihren Studenten beobachtet haben.
Hyperlinks liefern Kontextwissen
„In vielerlei Hinsicht haben sie unsere Annahmen bestätigt. Da ist ein Bedauern, dass Studenten weniger lesen. Sie haben mehr Probleme längere und komplexe Texte zu lesen und zu verstehen. Und das in Studiengängen wie Literatur, Geschichte oder Englisch und Philosophie. Ein Professor sagte uns, er könne sich nicht mehr vorstellen Studenten zu bitten Kant zu lesen. Das sollte uns zu denken geben. Vielleicht ist es nicht der beste Weg, dass wir die Inhalte reduzieren und Bücher durch Videos oder kleine Präsentationen ersetzen. Aber genau das ist es, was wir gerade machen.“
Wenn „Madame Bovary“, die leidenschaftliche Liebesromanleserin aus der Feder von Gustave Flaubert, heute noch in der Schule gelesen wird, schauen sich Jugendliche Lesemuffel schon mal gerne ein solches Erklärstück mit Playmobilfigürchen auf Youtube an. Möglich, dass es für einige die Lektüre gleich ganz ersetzt. Das muss keine Leseverweigerung sein, sondern vielleicht mangelndes Interesse an dem Skandal eines Ehebruchs im 19. Jahrhundert. Hier könnten digitale Texte mit ihrer Hyperlinkstruktur zum Lesen motivieren, meint der Germanist Prof. Rolf Parr von der Universität Duisburg-Essen.
„Man kann schwer einen 200seiter Goethe lesen, weil man sich unheimlich viel drum herum erschließen muss. Da hören jüngere Leute auf. Habe ich eine Hypertext-Struktur, die mir dieses Kontextwissen mitbringt, dann kann ich da vielleicht sogar wieder zum Lesen motivieren. Aber sie muss geliefert werden. Beim traditionellen Buch, da muss ich mir das selber erschließen.“
Der Germanist hat gerade zusammen mit seinem Kollegen Alexander Honold von der Universität Basel ein Handbuch in der Reihe „Grundthemen der Literaturwissenschaft“ über das Lesen veröffentlicht. Sein Fazit ist ausgewogen: Jedes Medium hat Vorzüge und Schwächen, die Mischung macht den neuen Leser. Und das digitale Lesen könne auch das Lesen von Literatur fördern, zum Beispiel durch Blogs.
„Im Grunde das, was es schon seit dem 17. Jahrhundert gegeben hat, als der Lesestoff noch so teuer war, dass man ihn nur zusammen lesen konnte. Heute bildet man im Netz Gemeinschaften, die ganz schnell sein können im Wechsel zwischen Lesen und sich darüber austauschen. Dadurch können qualitative Sprünge entstehen, weil auf diese Weise das hineinkommen kann, was ich eben diese vermissten Kontexte nannte. Der eine kennt das, der andere das, der nächste weiß das. Und dann kann da auch eine neue Qualität des Lesens und auch Verstehens eines Textes durchaus entstehen.“
Lesen ist keine Kunst, sondern eine Notwendigkeit. Und die Leseforschung ist angesichts der schnellen technischen Entwicklungen und politischer Entscheidungen gezwungen schnell zu arbeiten, will sie die Diskussion weder den Bücherwürmern noch den Bildschirmjunkies überlassen, meint der Kognitionsforscher Sascha Schröder.
„Beide Extrempositionen sind unrealistisch in dem Sinne, dass es nur gut wäre oder nur zu negativen Effekten führt. Genau dort die gesunde Mischung zu diskutieren und auf einer sachlichen Basis versuchen herauszubekommen, was müssen wir insbesondere der nächsten Generation von Lesern mitgeben, was für Kompetenzen sind für die besonders relevant. Das scheint mir das Essenzielle zu sein.“