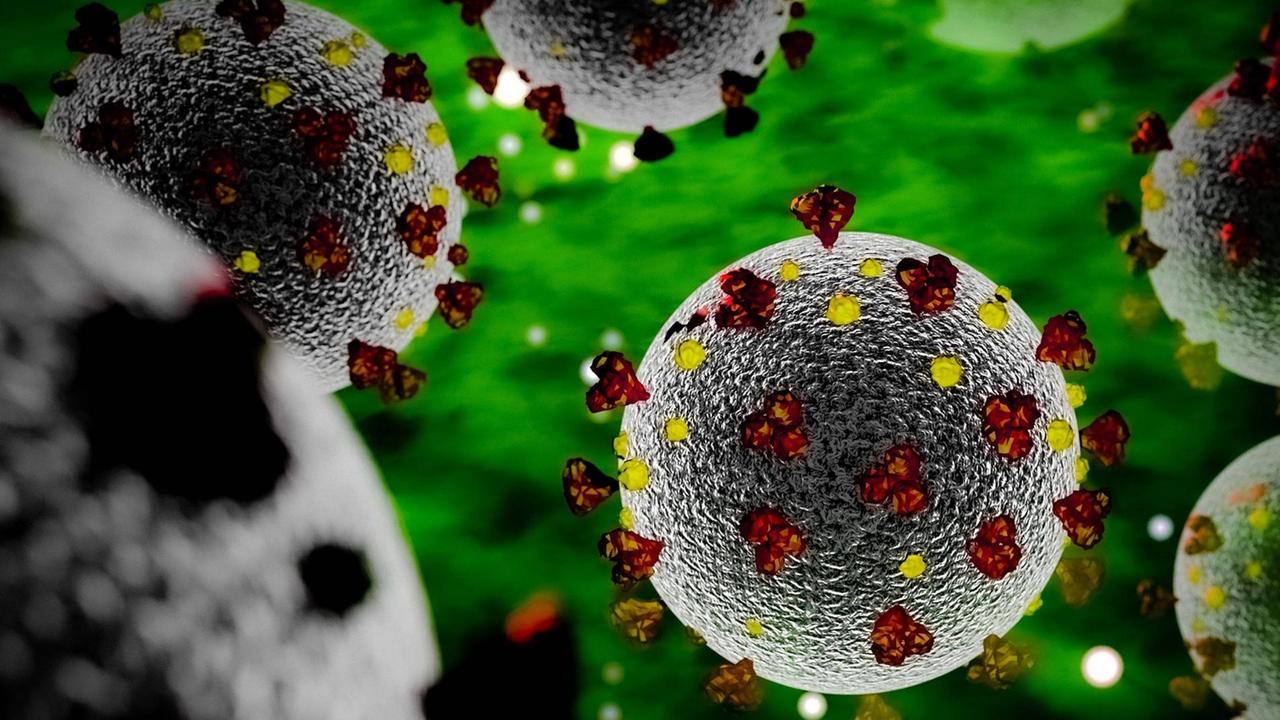"Herr Minister, ich muss nochmal auf das zurückkommen, was Sie am Anfang gesagt haben."
Berlin im März 2020. Gesundheitsminister Jens Spahn stellt sich im Parlament den Fragen zur Corona-Pandemie. Die SPD-Patientenbeaufragte Martina Stamm-Fibich stellt fest:
"Die Produktionsausfälle in China und Indien aufgrund der Corona-Pandemie könnten auch bei uns in naher Zukunft zu Arzneimittelengpässen führen, und wir wissen ja aus dem Bereich der Antibiotika, dass es zu Lieferschwierigkeiten kommen kann."
Abhängig von Arzneimittelimporten aus China
Zwar verlangt das Arzneimittelgesetz von Herstellern und Händlern eine angemessene und kontinuierliche Bereitstellung von Medikamenten, doch was früher in Deutschland kein Thema war, ist inzwischen Alltag – Lieferengpässe. Die ersten traten Anfang des Jahrtausends auf, akut wurden die Probleme dann ab 2012. Die Corona-Pandemie, so die Befürchtung, könnte nun alles verschlimmern.
"Die derzeitige Situation demonstriert uns die seit Langem bestehende Abhängigkeit Deutschlands von Arzneimittelimporten aus China und Indien eindrücklich."
"Ja, Frau Kollegin, das ist ein Thema, das uns schon vor der aktuellen Coronasituation intensiv beschäftigt hat."
Die Lieferengpässe betreffen vor allem Generika, also die Mittel, deren Patentschutz ausgelaufen ist. Sie machen mehr als 80 Prozent des deutschen Arzneimittelmarkts aus. Dabei sind die Ursachen dieser Engpässe zwar vielfältig. Aber ein Grund aber sticht immer wieder heraus: Die Verlagerung der Produktion von Wirkstoffen und Medikamenten nach Asien – insbesondere nach Indien und noch mehr nach China.
"Im Moment spüren wir alle, dass diese Abhängigkeit - ökonomisch und in den Lieferketten - von einem einzigen Land auf der Welt für Europa und für Deutschland kein guter Zustand ist und dass wir uns glaube ich im Nachgang, auch was die Außen-, Handels- und Wirtschaftspolitik angeht, mit diesen Themen noch beschäftigen werden müssen."
Erklärt Jens Spahn. Derzeit spitzt sich die Lage jedoch nicht zu. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft:
"Es gibt derzeit keine eindeutigen Hinweise darauf, dass in Folge der Coronavirus-Pandemie zusätzliche kurzfristige Einschränkungen in der Versorgung mit relevanten und für die Bevölkerung unverzichtbaren Arzneimitteln auftreten."
In der Provinz Hubei, von der die Pandemie ihren Ausgang nahm, werden zwar elf von rund 500 Wirkstoffen produziert, die als "versorgungsrelevant" gelten. Sprich: sind solche Wirkstoffe längere Zeit nicht erhältlich, kann das Kranke gefährden. Doch diese elf Wirkstoffe werden in China auch andernorts hergestellt.
"In China werden die versorgungsrelevanten Arzneimittel an verschiedenen Orten, also nicht nur in der von der Pandemie besonders stark betroffenen Provinz Hubei und seiner Provinzhauptstadt Wuhan hergestellt. Hinzu kommt, dass infolge der chinesischen Feiertage größere Vorräte an Arzneimitteln angelegt wurden."
Rund 500 versorgungsrelevante Wirkstoffe
Außerdem soll die Produktion WHO-Informationen zufolge wieder angelaufen sein, sagt Bork Bretthauer, Geschäftsführer des Verbands Pro Generika:
"Also im Moment, denke ich, können wir sagen, dass wir kurzfristig nicht davon ausgehen, dass es aufgrund des Ausbruchs des Corona-Virus zu Liefer- oder Versorgungsproblemen in Deutschland kommt. Das kann man ganz sicher sagen. Es liegt vor allem daran, dass Generika Unternehmen eben nicht ‚just in time‘ produzieren. Das sieht man ja in anderen Wirtschaftsbranchen, wo sehr viel schneller Beeinträchtigungen in der Produktion zu sehen sind. Das ist bei uns nicht so. Also kurzfristig gehen wir nicht davon aus, dass es zu Problemen kommt hierzulande."
Auf der Liste der rund 500 versorgungsrelevanten Wirkstoffe stehen Substanzen wie Abacavir, das in der Aidstherapie eingesetzt wird, aber auch Ibuprofen. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft:
"Und die Wirkstoffgruppen, die seit einigen Jahren am häufigsten betroffen sind, sind Arzneimittel zur Behandlung von Krebserkrankungen, Onkologika, Arzneimittel zur Behandlung von Infektionserkrankungen, vorwiegend Antibiotika, aber auch durchaus Psychopharmaka zur Behandlung von Depressionen beispielsweise, Medikamente zur Behandlung der Epilepsie, zunehmend auch ganz banale Mittel wie Schmerzmittel. Und ein großes Problem im Krankenhaus war, dass auch Narkotika häufig betroffen sind."
Manche Engpässe machen Schlagzeilen. Etwa beim Krebsmittel Melphalan, das auch bei Stammzelltransplantationen eingesetzt wird:
"Dieser Wirkstoff ist seit einigen Jahren immer mal wieder nicht verfügbar gewesen, was dazu geführt hat, dass wir unsere Patienten nur verzögert behandeln konnten."
Melphalan sei zuvor viele Jahre auf dem Markt gewesen, ohne dass es Anzeichen für Engpässe gegeben hätte:
"Aus internen Papieren ging dann hervor, dass hier eine künstliche Verknappung teilweise vorgelegen hat. Das heißt, dass der Hersteller von Melphalan dieses Arzneimittel, obwohl es in den Lagerbeständen vorhanden war, nicht bereitgestellt hat, weil er versucht hat, durch diese künstliche Verknappung den Preis in die Höhe zu treiben."
Wenn Infusionslösungen fehlen
Meistens sind die Gründe für die Engpässe allerdings weniger mutwillig: Qualitätsmängel, Herstellungsprobleme, Produktionsverzögerungen, Lieferverzögerungen für Rohstoffe und Ausgangsmaterialien oder die Produktionseinstellung von älteren, unprofitablen Arzneimitteln.
"2019 waren es insgesamt knapp 280 Lieferengpässe, die wir bei den verschiedenen Präparaten hatten."

Und in diesem Jahr sind es bislang auch nicht weniger, erläutert Kim Green. Der Apotheker am Arzneimittelinformationszentrum des Universitätsklinikums in Heidelberg hat auf seinem Computer die Liste der Arzneimittel aufgerufen, die derzeit nicht wie bestellt geliefert werden können:
"Bei uns sind die dramatischen Produkte wirklich i.v.-Präparationen."
Arzneimittel also, die injiziert werden. Das kann kritisch werden, wenn in der Intensivmedizin bei akuten Herz-Kreislauferkrankungen Infusionslösungen von Acetylsalicylsäure fehlen. Oder eine Infusionslösung, die gegen Bluthochdruck bei Kleinkindern eingesetzt wird. Für letztere gibt es auf dem deutschen Markt keinen Ersatz:
"An sich ist das ein sehr, sehr komplizierter Wirkstoff. Deswegen ist es vielleicht auch nicht unwahrscheinlich, dass es da Probleme gab. Sobald der Wirkstoffe an die Luft kommt oder ans Licht, dann zerfällt er und dann können sie nicht garantieren, dass die Qualität über die Zeit gewährleistet ist."
Deshalb sei es auch unmöglich, das Medikament selbst herzustellen. Wenn so ein Engpass auftritt, bleibt also nichts anderes als den Mangel zu verwalten. Kim Greens Chef, Torsten Hoppe-Tichy, der seit 25 Jahren die Apotheke leitet, blättert in einer langen Liste:
"Sie sehen hier ja auch auf unserer Liste, das ist natürlich durchaus immer der Fall in der Krebstherapie, dass wir irgendwelche Lieferengpässe haben."
Krebsmedikamente, aber auch Antibiotika, werden in der Regel nur noch von wenigen Anbietern hergestellt. Fällt einer aus, kommt es in der Klinik fast automatisch zu einem Versorgungsengpass:
"Und da versuchen wir eben, weil das für uns die essentiellen Therapien gerade hier bei uns in Heidelberg sind, einen hohen Lagervorrat zu haben. Aber das kostet richtig viel Geld."
Geld, das dann für andere Zwecke nicht zur Verfügung steht.
"Wir haben - und das ist nicht nur bei uns der Schnitt, sondern auch wenn man europäische Daten heranzieht, die der europäische Verband der Krankenhausapotheker erhoben hat, bei seinen Mitgliedern – eigentlich mehr als eine Kraft, die nichts weiter zu tun hat, als sich mit Lieferengpässen zu beschäftigen. Das ist der Umfang."
Lieferengpässe haben viele Auswirkungen
Auch die niedergelassenen Apotheker müssen sehr viel Zeit aufwenden, um bei Engpässen mit Ärzten, Großhändlern und Patienten nach Lösungen zu suchen:
"Wir haben also regelmäßig unheimliche Lieferengpässe in leider fast allen Kategorien von Arzneimitteln. Das fängt halt bei Schmerzmitteln an und hört bei Psychopharmaka auf. Dazwischen liegen die Schilddrüsenpräparate, dazwischen liegen die Medikamente zur Behandlung von Gicht und so weiter und so fort."
Dennoch: Bei vielen Medikamenten ist die Suche nach Alternativen zwar mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden, doch letztendlich erfolgreich. So gibt es oft ein anderes Antibiotikum, das auch gegen einen bestimmten Erreger wirkt, erklärt Matthias Arnhold, Vizepräsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände:
"Das wird schwieriger bei Psychopharmaka, die über lange Zeiträume eingenommen werden müssen, wo der Patient eingestellt ist. Ein solcher Austausch ist dann auch nicht möglich ohne einen Arztkontakt. Das heißt, hier muss ich dann wieder versuchen, den Arzt zu erreichen, was ja auch nicht so einfach ist, weil: Der Patient kommt ja nicht zwingend zur Sprechzeit des Arztes in die Apotheke und ich muss aber mit dem Arzt klären, wie wir verfahren wollen. Und dann ist es im Regelfall so, dass ein Mitarbeiter der Apotheke dahinfährt und das Rezept ändern lässt."
Inzwischen gibt es etliche Studien zu den Auswirkungen von Lieferengpässen: Verzögerungen in der Chemotherapie werden angeführt, die Zahl der Nebenwirkungen steigt, manchmal bleibt nichts anderes übrig, als Behandlungen durchzuführen, die nicht dem medizinischen Standard entsprechen. Dabei hat die Bundespolitik in den vergangenen Jahren Einiges getan, um das Problem anzugehen: Im Mai 2017 trat das Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversorgung in Kraft, 2019 das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung. Erst am 13. März gab der Bundesrat Grünes Licht für das sogenannte Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz. Sie alle haben unter anderem zum Ziel, die Versorgungsengpässe auszuräumen. So dürfen die Apotheker bald auch teurere Medikamente an die Patienten ausgeben, wenn ein Lieferengpass vorliegt, ohne dass die Kunden zuzahlen müssen. Und dass die bislang freiwilligen Engpass-Meldungen von Herstellern und Großhändlern an das Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte nun verpflichtet sind. Doch das löse das Kernproblem nicht. Sebastian Schütze vom Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie:
"Sie bekämpfen zum Teil Symptome, und das noch nicht einmal besonders erfolgreich. Wenn man wirklich gegen das Problem der zunehmenden Lieferengpässe angehen will, dann muss man die Ursachen bekämpfen. Und die liegen primär in dem sehr niedrigen Preisniveau, was hier im generischen Markt haben."
Rabattverträge: die Rolle der Krankenkassen
Sebastian Schütze bezieht sich auf das von den Krankenkassen entwickelte System von Rabattverträgen, das verhindern soll, dass Gesundheit unbezahlbar wird: Die Kassen schließen diese Verträge mit einem oder mehreren Anbietern, die ihnen oft beträchtliche Preisnachlässe einräumen. Der Vorteil für die Produzenten ist ein gesicherter Absatz. Die Krankenkassen halten dagegen. Tim Steimle, Leiter Arzneimittel bei der Techniker Krankenkasse:
"Die Rabattverträge sind erst mal ein wichtiges und notwendiges Instrument, welches wir benötigen, um die Kosten in den Griff zu bekommen. Mit den Rabattverträgen reduzieren sich die Kosten in der gesetzlichen Krankenversicherung um etwa viereinhalb Milliarden Euro jedes Jahr, Tendenz steigend. Das ist etwas, was wir hinsichtlich der Kostenbelastung in diesem Bereich in jedem Falle weiterhin benötigen."
Doch eine Kritik an den Rabattverträgen kann Tim Steimle nachvollziehen: Manche Krankenkassen schließen ihre Verträge nur mit einem Generikaproduzenten ab:
"Es gibt Krankenversicherungen, die mit einem Mehrpartnermodell arbeiten, wo mehrere Hersteller unter Vertrag genommen werden können. Wir haben das analysiert in unseren Daten und kommt zu dem Ergebnis, dass unsere Verträge etwa doppelt so häufig lieferfähig sind oder nur doppelt so selten Lieferprobleme auslösen."
Sollten bei einem der Partner Probleme auftreten, können die anderen weitaus eher einspringen als bei dem Ein-Partner-Modell, wo alle anderen Hersteller leer ausgegangen sind und deshalb auch keine Produktionskapazitäten vorhalten. Dass jedoch die Rabattverträge ein wesentlicher Grund für die Probleme mit den Lieferengpässen sind, da widerspricht Tim Steimle vehement. Beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte stünden im Durchschnitt 280 von 80.000 verfügbaren Arzneimitteln auf der Liste:
"Also in Österreich haben wir Lieferengpässe von bis zu 800 Arzneimitteln. In der Schweiz sind es knapp 600 Arzneimittel, die nicht lieferbar sind. Und was man wissen muss: Sowohl in Österreich, als auch in der Schweiz haben wir keine Rabattverträge."
Beim Preis seien nicht die Rabattverträge prinzipiell das Problem, sondern die Exklusivverträge, urteilt auch Wolf-Dieter Ludwig von der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft:
"In Deutschland ist es sicherlich so, dass auch der Preisdruck dann auch die Hersteller nicht ausreichend motiviert, die Wirkstoffe in den Markt zu bringen und dass letztlich auch in Deutschland Engpässe entstehen, die dann natürlich für die Patienten große Probleme bedeuten."
Arzneimittel in Europa produzieren lassen
Durch die günstigen Personal- und Herstellungskosten in Asien lohnt sich die Produktion in Deutschland nicht mehr. Zusätzlich drängte China hiesige Produktionsstätten für Antibiotika durch massive Subventionen aus dem Markt. Gleichzeitig verengte sich auch der Markt: Viele der in Europa benötigten Wirkstoffe und Arzneimittel werden in China und Indien nur noch von wenigen oder sogar einem einzigen Hersteller produziert. Ein Ereignis kann ausreichen, um eine globale Versorgungskrise auszulösen: So wie 2016, als durch eine Explosion in einer chinesischen Fabrikmehr als 50 Prozent der Weltmarktproduktion eines Antibiotikums ausfiel.
"Ich glaube wir haben keine Möglichkeit, den Herstellern vorzuschreiben, wie viele Hersteller von Rohstoffen beispielsweise in Asien existieren. Da wäre wirklich die einzige Lösung, dass wir sagen: Wir fordern, dass wieder verstärkt diese Arzneimittel in Europa produziert werden und dass bei versorgungsrelevanten Arzneimitteln, also bei Arzneimitteln zur Behandlung sehr schwerwiegender Erkrankungen beispielsweise, dass dort natürlich ganz besonders Wert darauf gelegt wird, dass wir auch in Europa Produktionsstätten haben und nicht abhängig sind von Asien."
Das Problem:
"Gegenwärtig können wir für viele Arzneimittel eine Produktion in Europa oder in Deutschland überhaupt nicht realisieren. Das geht gar nicht, weil Sie dann zu den Preisen, für die Sie diese Arzneimittel dann eben erstattet bekommen, hier keine Produktion durchführen können."
Thomas Brückner leitet beim Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie den Bereich Pharmazie. In vielen Fällen liege der durchschnittliche Preis für eine Tagesdosis im unteren Cent-Bereich. Als bei einem so komplex herzustellenden Medikament wie dem Krebstherapeutikum 5-Fluoruracil der Literpreis vor einigen Jahren unter 2,50 Euro fiel, gingen mehrere große Hersteller aus dem Markt.
"Im Augenblick ist es schlicht und ergreifend ökonomischer Selbstmord, wenn sie bestimmte Wirkstoffe oder bestimmte Fertigarzneimittel in Europa produzieren würden. Und deshalb machen es die Firmen halt nicht."
Die Rückverlagerung von Produktion nach Europa wäre ohne flankierende Maßnahmen des Staats kaum möglich, urteilt Sebastian Schütze vom Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie – und da kommen unter anderem die Rabattverträge ins Spiel:
"Wenn man also das Problem der Abhängigkeit von asiatischen Staaten in der Produktion, gerade auch bei den Wirkstoffen, aber auch bei Fertigarzneimitteln etwas mindern möchte, dann muss man bereit sein, im unteren Cent-Bereich etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen aus Gründen der Arzneimittelliefersicherheit. Das kann man durch veränderte Ausschreibungsbedingungen machen, dass man insbesondere Produktionsschritte besonders honoriert, wenn sie in Deutschland oder in Europa erfolgt sind. Das wäre ein wichtiger Ansatz. Und dann sind es allgemein auch infrastrukturelle Aspekte, die eine Rolle spielen können. Grundsätzlich muss es rein ökonomisch rechnerisch wieder möglich sein, in Europa produzieren zu können, und das ist in manchen Bereichen gerade der Wirkstoffproduktion aktuell nicht der Fall."
Vielleicht erhöhe nun das Corona-Virus das Problembewusstsein, hofft Wolf-Dieter Ludwig von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft:
"Die aktuelle Situation verdeutlicht allerdings erneut die große Abhängigkeit von Asien und sollte die Politiker in Europa daran erinnern, dass es jetzt höchste Zeit ist, die Produktion von Wirkstoffen und fertigen Arzneimitteln wieder nach Europa zurück zu verlagern."
Denn obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass die chinesische Produktion schnell wieder anläuft, wirkt sich das Corona-Virus weiterhin global aus:
"Das ist ja nicht nur die Frage, dass die Produktion angefahren werden kann, sondern es geht ja auch um die Logistik. Dann geht es auch um die Frage, zum Beispiel, ob Schiffe an der Stelle sind, wo man sie braucht, um dann Güter wieder nach Europa zu transportieren, weil auch der Schiffsverkehr ja unterbrochen war oder teilweise immer noch ist. Gleiches gilt für die Luftfracht."
Ganz aktuell kommt allerdings ein Problem hinzu, das mitnichten aus dem Ausland kommt – sondern aus der Zivilgesellschaft selbst. André Blümel, Vorsitzender des Bundesverbands des pharmazeutischen Großhandels:
"Wir sehen hier auch bereits Hamsterkäufe, und das belastet natürlich das System. Wenn die Patienten den Bedarf, den sie für sich und ihre Angehörigen benötigen, einkaufen, dann können Großhändler und Apotheken diesen Bedarf auch decken. Darauf sind die Systeme des Großhandels und auch die Systeme und die Vorräte der Apotheken eingestellt und natürlich auch der Hersteller. Aber bei Hamsterkäufen kann es natürlich zu einer Verknappung führen."
Dass zu verhindern, sagt Blümel, liege in der Hand jedes Einzelnen.