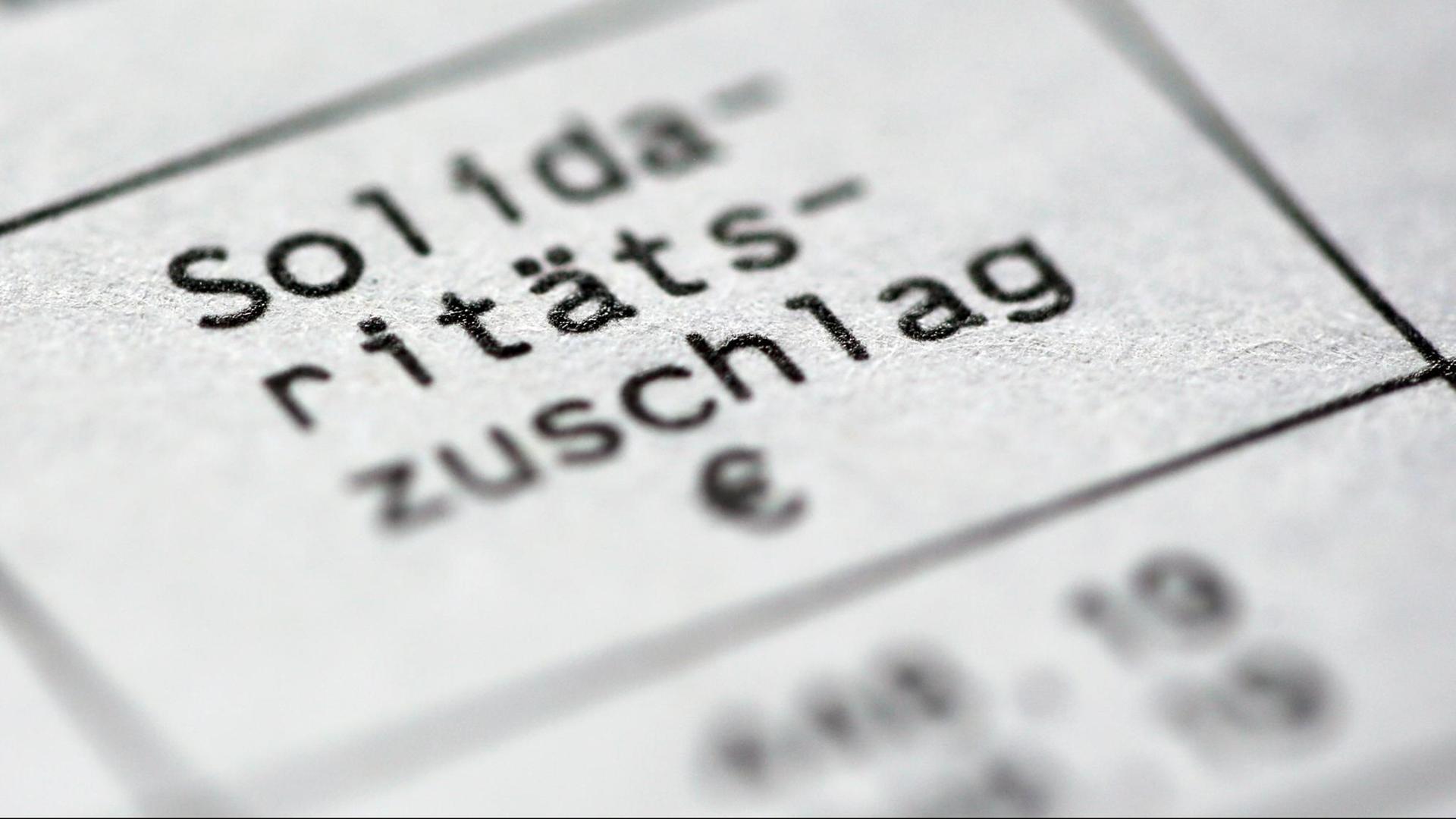
Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags gehöre in den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Adrian, äußerte sich ähnlich. Die vollständige Aufhebung des Soli wäre für Firmen ein wichtiges Signal für spürbare Entlastungen.
Der Kritik schloss sich auch der FDP-Politiker Dürr an. Der CDU-Haushaltspolitiker Middelberg erklärte, man akzeptiere das Urteil. Aber jetzt brauche es dringend steuerliche Entlastungen für die Unternehmen und die arbeitende Mitte. Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Kukies von der SPD begrüßte dagegen die Entscheidung, die Klarheit für die Aufstellung des Bundeshaushalts schaffe.
Verfassungsgericht weist FDP-Beschwerden ab
Zuvor hatte das höchste deutsche Gericht eine Verfassungsbeschwerde mehrerer FDP-Politiker gegen den Solidaritätszuschlag abgewiesen. Die Ergänzungsabgabe wurde 1995 eingeführt und ursprünglich mit den Kosten der deutschen Einheit gerechtfertigt. Wörtlich heißt es in der Begründung des Verfassungsgerichts: "Ein offensichtlicher Wegfall des auf den Beitritt der damals neuen Länder zurückzuführenden Mehrbedarfs des Bundes kann auch heute (noch) nicht festgestellt werden. Eine Verpflichtung des Gesetzgebers zur Aufhebung des Solidaritätszuschlags ab dem Veranlagungszeitraum 2020 bestand und besteht folglich nicht."
Die FDP-Politiker hatten argumentiert, dass der Solidarpakt zur Herstellung gleicher Lebensverhältnisse in den alten und neuen Bundesländern 2019 ausgelaufen war. Danach habe es keine Rechtfertigung für die Ergänzungsabgabe gegeben. Außerdem bestehe eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung, weil seit 2021 nur noch Gutverdiener herangezogen würden. Die Bundesregierung verwies dagegen auf einen weiteren zusätzlichen Finanzbedarf infolge der Wiedervereinigung und auf ein entsprechendes Gutachten aus dem Jahr 2020. Auch der Bundesfinanzhof hatte den Solidaritätszuschlag für zulässig erklärt.
Der Solidaritätszuschlag wurde mit den Kosten der Wiedervereinigung begründet und gilt seit 1995 unbefristet. Seit 2021 müssen ihn nur noch die oberen zehn Prozent der Steuerpflichtigen bezahlen. 90 Prozent liegen unter der Freigrenze. Die Abgabe beträgt zusätzlich 5,5 Prozent der Einkommensteuer. Außerdem wird der Zuschlag auf Kapitalerträge und die Körperschaftsteuer erhoben. Die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag, die ausschließlich dem Bund zukommen, betrugen zuletzt gut 12,6 Milliarden Euro im Jahr.
(Az. 2 BvR 1505/20)
Soli: Welche Folgen hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts?
Zukunft des Soli: Wirtschaftsexperte fordert Reform statt Abschaffung
Zukunft des Soli: Wirtschaftsexperte fordert Reform statt Abschaffung
Diese Nachricht wurde am 26.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
