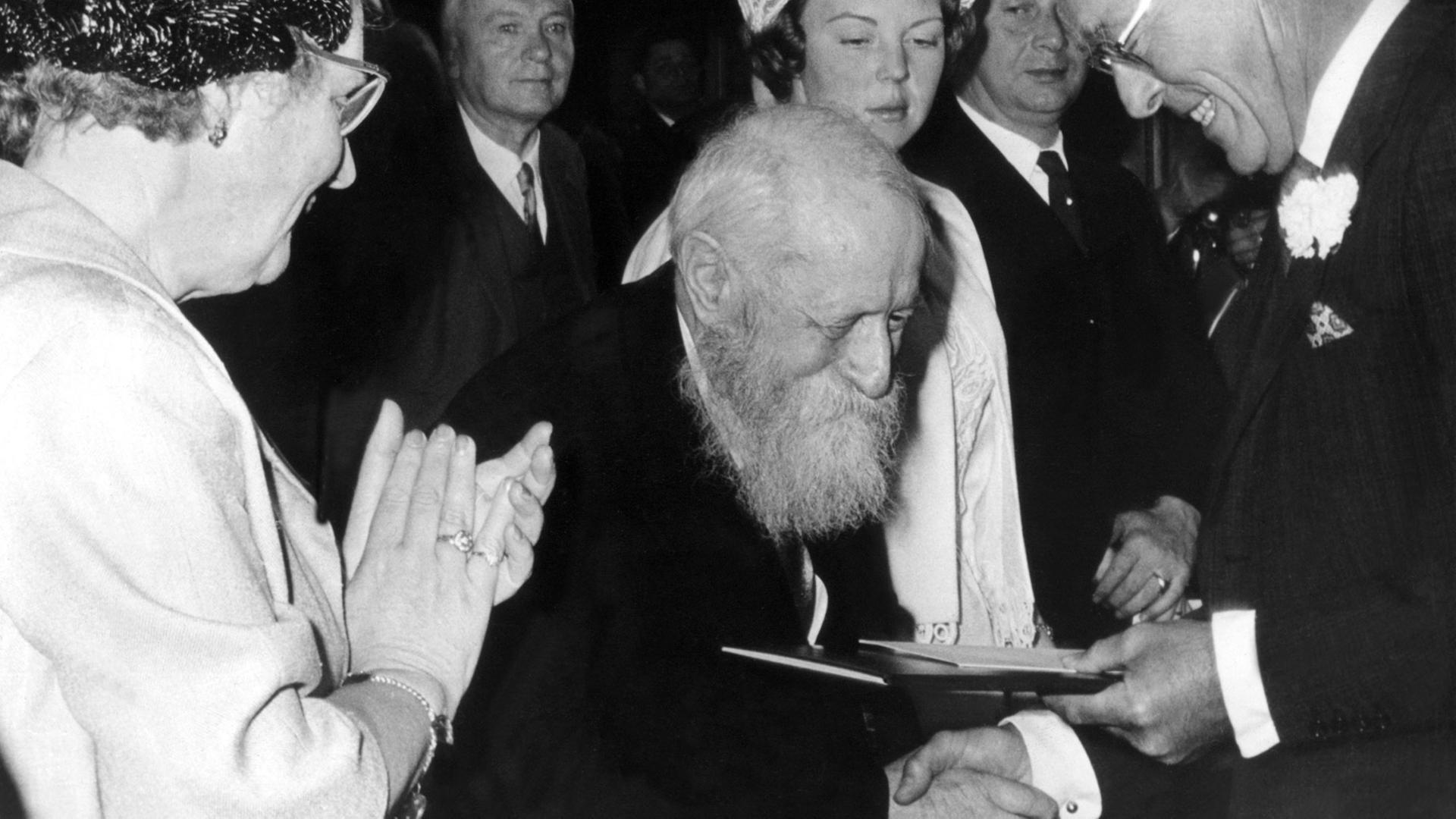Professor Karl-Josef Kuschel ist katholischer Theologe; er ist ein Küng-Schüler. Zum 50. Todestag von Martin Buber am 13. Juni 1965 hat Kuschel ein Buch geschrieben mit dem Titel: „Martin Buber – seine Herausforderung an das Christentum“.
Andreas Main: Herr Kuschel, beginnen wir mit einem Einwand, der womöglich erhoben werden könnte gegen Ihren Untertitel – aber auch gegen die Herangehensweise unseres Gesprächs. Wenn wir den jüdischen Religionsphilosophen heranziehen als Herausforderung für Christen, ist das eine unzulässige Vereinnahmung?
Karl-Josef Kuschel: Nein, auf keinen Fall, denn Martin Buber selber gibt ja Vorgaben. Er setzt sich eben mit den christlichen Überlieferungen auseinander. Er hat zum Beispiel 1950 noch im hohen Alter eine große Schrift veröffentlicht mit dem Titel „Zwei Glaubensweisen“, indem er eben die jüdische Art zu glauben und die christliche Art zu glauben miteinander konfrontiert, wo er sich mit den neutestamentlichen Quellen eingehend auseinandersetzt. Er selber suchte ja das Gespräch mit Christen. Er suchte auch klar die Unterscheidung von Juden und Christen. Insofern sind wir völlig berechtigt, ja geradezu neugierig und versessen darauf, als christliche Theologen zu wissen: Was hat ein Mann vom Format Martin Buber zu einem Glauben von Christen zu sagen, der sich auf den Juden Jesus von Nazareth stützt?
Main: Jeschajahu Leibowitz, auch ein Mann von Format, auch ein wichtiger Denker wie Buber und gleichzeitig scharfer Buber-Kritiker, er hat Buber als jüdischen Theologen für Nicht-Juden bezeichnet. Er meinte das verächtlich. Was störte ihn?
Kuschel: Ja, Buber hat es eben abgelehnt, und zwar zeit seines Lebens von Anfang an, sich an dem jüdischen Religionsgesetz zu orientieren: der Halacha, der religionsgesetzlichen Ordnung. Die Thora und ihre Gebote – das war nicht sein Diskurs, den er geführt hat. Und das haben ihm die Orthodoxen aller Couleur im Judentum schwer übelgenommen. Insofern konnte er sich auch dort nicht durchsetzen. Er war der Meinung, Gesetze sind nicht einfach nur überflüssig. Die Gebote und Verbote der Thora sind nicht einfach Nebensächlichkeiten. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist diese lebendige Ich-Du-Beziehung des Menschen zu Gott, zu diesem ewigen Du. Da sah er auch die Gefahr in der Vergesetzlichung der Religion, die Gefahr der Verdinglichung, die Gefahr, dass sich doch wieder ein Mittler zwischen Gott und den Menschen herausbildet, zum Mittler wird, zu einer vermittelnden Instanz wird. Genau das wollte er ja aufbrechen, weil er das Gespräch mit dem lebendigen Gott suchte.
Main: Um die Bedeutung Bubers zu beleuchten, lassen Sie mich drei ganz einfache, aber womöglich schwer zu beantwortende Fragen stellen und dabei das Jüdische, das Christliche und das Philosophische voneinander trennen. Warum war und ist Martin Buber wichtig für Juden?
Kuschel: Aus zwei Gründen. Ein politischer Grund und ein theologischer Grund. Er suchte das Gespräch mit der Bibel, mit der hebräischen Bibel, die er ja wie kein anderer – zu Anfang zusammen mit Hans Rosenzweig ins Deutsche übertragen hatte. Er suchte das Gespräch mit chassidischen Überlieferungen, also mit den Überlieferungen des osteuropäischen Judentums seit dem 18. Jahrhundert. Das sind die Chassidim, das ist ein anderes Wort für die Vollkommenen, die Gerechten. Aus diesen jüdischen Quellen heraus, die den lebendigen Gott zeigten, den Unverfügbaren, mit diesen jüdischen Quellen versuchte er zu argumentieren, versuchte er, seine Glaubensposition zu umschreiben. Das machte ihn zu einer Herausforderung an all die Juden, die meinen, das Judentum hat nur eine Identität über die Halacha, also über die religionsgesetzliche Ordnung. Und der zweite war ein politischer. Er hatte eine andere Vorstellung von Israel als Volk Gottes, als einen Staat Israel zu gründen. Vor allen Dingen wollte er, wenn ein Staat gegründet wird, wenn ein Gemeinschaftswerk gegründet wird, Gerechtigkeit für die arabischen Nachbarn – von Anfang an hat er dafür gestritten. Auch das hat ihn isoliert in Israel, denn der Weg der israelischen Politik mit der Staatsgründung unter David Ben-Gurion ist ein anderer gewesen. Da geriet Buber in die Minderheit.
Main: Warum ist Buber wichtig für Christen?
Kuschel: Um es auf die Formel zu bringen, Christen stützen ihren Glauben an Jesus als Erlöser, Messias, Gottessohn auf einen Juden des ersten Jahrhunderts. Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Und Buber hat als jüdischer Gelehrter mit all den Kenntnissen, die jemand mitbringt, wenn er mitten in diesem Volk Israel aufgewachsen ist, hat dazu etwas zu sagen und auch etwas Kritisches zu sagen. Denn er war der Überzeugung und hielt uns Christen den Spiegel vor: Habt ihr nicht aus Jesus etwas gemacht – angefangen von den hohen christologischen Aussagen bis hin dann zur dogmatischen Entfaltung im 3., 4. Jahrhundert, denken Sie an die Trinitätslehre, die Dreifaltigkeitslehre – habt ihr aus diesem Juden Jesus von Nazareth etwas gemacht, was dieser gar nicht sein wollte, was dieser möglicherweise auch gar nicht verstanden hätte? Müssen wir uns nicht viel stärker wieder an seine ursprüngliche Botschaft, der Reich-Gottes-Botschaft, der Botschaft der Vergebung Gottes für jeden Menschen – müssen wir uns nicht da orientieren? Habt ihr nicht aus der Reich-Gottes-Botschaft eine Heilsanstalt-Kirche gemacht? Das sind schon scharfe Fragen, die man sich auch als Christ immer wieder gefallen lassen muss, denn es geht letztlich um diesen Juden Jesus von Nazareth und wie man ihn zu verstehen hat.
Main: Und die Philosophie. Warum ist Buber wichtig für die Philosophie oder auch Religionslose?
Kuschel: Ja, er hat ja was ganz Eigenartiges entdeckt, was vorher noch niemand so in dieser Klarheit und Prägnanz entdeckt hat. Er hat diese Gedanken niedergelegt, dann in seiner ungemein einflussreichen Schrift „Ich und Du“ von 1923. Was war das eigentlich Neue? Das eigentlich Neue war, dass er in dieser Prägnanz, in dieser zusammenfassenden, fast formelhaften Weise uns die Augen dafür geöffnet hat, dass es zwei Grunddimensionen des Menschen gibt. Buber nennt das die Ich-Es-Beziehung und die Ich-Du-Beziehung. Unter Ich-Es-Beziehung versteht er all das, was wir so täglich tun. Wir benutzen andere Menschen oder Gegenstände für unsere eigenen Zwecke. Wir funktionalisieren, wir verdinglichen, wir nutzen etwas aus, um eines Vorteils willen, um Erkenntnisse willen und so weiter. Das unterscheidet er radikal von einer anderen weiteren, wenn Sie so wollen, tieferen Dimension – der Ich-Du-Beziehung. Die Ich-Du-Beziehung ist eben genau die Beziehung, die nicht verzweckt wird, die nicht funktionalisiert wird. Da öffnet sich ein Raum des Zwischen, sagt Buber. Und diesen Raum hatte vorher niemand so gesehen oder beschrieben. Dass sich zwischen zwei Menschen in Begegnungen so etwas wie ein Raum des Unverfügbaren, des Nicht-Kontrollierbaren, auch des Nicht-Herstellbaren, Nicht-Verfügbaren auftut und dass das die eigentliche Dimension ist, die sozusagen tief ins Herz geht, die etwas verändert und die uns Menschen eigentlich zu Menschen macht. Das Gegenüber nicht zu funktionalisieren, nicht zu instrumentalisieren für eigene Zwecke, sondern sich öffnen für den anderen. Von aufgeschlossener Person zu aufgeschlossener Person, wie Buber sagt. Einer der schönsten Sätze, die ich mir von Buber gemerkt habe, lautet: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Das ist ein wunderbarer Satz – unterstrichen wirkliche Leben. Also dieses Moment des Unverfügbaren, das mich aber total verändern kann.
Main: Dass Buber diese Bedeutung bekommen hat, wie Sie sich jetzt in drei Punkten dargelegt haben, das hat auch etwas mit seiner Kindheit und Jugend zu tun. Buber ist 1878 in Wien geboren. Er muss den Verlust der Mutter verkraften. Er wächst dann bei seinen jüdisch aufklärerischen Großeltern auf, später dann auch noch mal bei seinem Vater. An welchen Punkten prägt dieser Verlust der Mutter, einer intakten Familie sein Denken?
Kuschel: Er sagt das selber in einer seiner autobiografischen Skizzen, die wir von ihm haben. Ein sehr, sehr später Text um 1960 mit diesem Titel „Begegnung“ – das schildert er eine Szene aus seiner Kindheit. In der Tat – die Mutter hatte sich früh von der Familie getrennt – geht eine andere Bindung ein, ist dann quasi nicht mehr anwesend, auch dem Jungen gegenüber. Viel, viel später erst kehrt sie mal wieder in die Familie zurück, als Buber schon verheiratet ist. Er wächst bei seinen Großeltern auf. Und er sagt, als er der Mutter dann wieder begegnet-– nach vielen, vielen Jahren, konnte er – so wörtlich „in ihre immer noch schönen Augen nicht blicken“, ohne dass ihm das Wort „Vergegnung“ eingefallen wäre. Es ist ein wunderbares Wortspiel, das er ja dem Wort „Begegnung“ gegenüberstellt. Begegnung – Vergegnung. Und man kann ja auch aus seiner eigenen Lebensgeschichte viele Momente benennen, wo es eben nicht zu Begegnungen kommt, in diesem lebendigen unverfügbaren Sinne, sondern zu Vergegnungen, verspielte Beziehungen. Beziehungen, die nichts gebracht haben, ein flüchtiger Kontakt, eine ganz kurzfristige Sache. Das ist das, was Buber aus der Erinnerung speist. Und was er dann auch in den Dialog-Prozess einbringt. Er sagt, viele Begegnungen Menschen verschiedenen Glaubens, etwas Juden-Christen, Juden-Christen-Muslime, sind ja nicht Begegnungen. Sie sollten Begegnungen sein, sich öffnen für den anderen, sondern sie sind Vergegnungen. Man geht aneinander vorbei oder monologisiert sich was vor und es kommt eigentlich nicht zu einer wirklichen Begegnung.
Main: Das anti-judaistische Umfeld seiner Jugend – und auch das anti-semitische – auch das hat ihn geprägt. Ausgegrenzt sein als Erfahrung – auch dies dürfte seine Einstellung zur Welt der Religionen geprägt haben. Ist also womöglich seine scharfe Ablehnung nicht nur der christlichen Judenmission, sondern jeglicher Missionsversuche, eine Folge dieser Erlebnisse?
Kuschel: Ja, zweifellos. Er hat es ja gewissermaßen mit einem doppelten Komplex zu tun, der ja ungemein bedrückend auf ihm lag und auf den Juden im deutschen Kaiserreich schon vor 1914. Nämlich den Jahrhunderte alten, immer wieder wiederholten Anti-Judaismus der Kirchen. Die Kirchen haben das Judentum dämonisiert. Sie haben das jüdische Volk als verworfen bezeichnet, als zerstreut über die Weltvölker, weil man eben Christus gekreuzigt habe, Christus nicht als Messias anerkannt habe. Also dieser Anti-Judaismus, der zu einer fürchterlichen Diskriminierung von Juden führte. Und dazu kam Mitte des 19. Jahrhunderts der rassische Antisemitismus. Juden als eine eigene Rasse, ‚artfremd‘ den Deutschen, wie ein Fremdkörper im deutschen Volkskörper existierend und ihn schwächend. Zweifellos, dieses Zusammenspiel dann von Anti-Judaismus und Antisemitismus hatte dann ja tödliche Folgen für das jüdische Volk. Und Martin Buber hat alles getan, um gegenzusteuern. Auf der einen Seite die eigene jüdische Identität zu stärken, vor allem durch große Programme in der Erwachsenenbildung, in der universitären Arbeit in Frankfurt, und gleichzeitig das Gespräch zu suchen und Christen klar zu machen, das jüdische Volk hat seinen eigenen Weg zu Gott, seine eigene Auszeichnung von Gott bekommen, nämlich die Bundesverpflichtung, die Gott eingegangen ist diesem Volk gegenüber. Dass das die Shoah nicht aufgehalten hat, dass es dann zum Grauen der Gaskammern führte, wie Buber mal sagte, das wissen wir alle. Aber er hat ein Niveau vorgegeben, das uns auch heute noch verpflichtet.