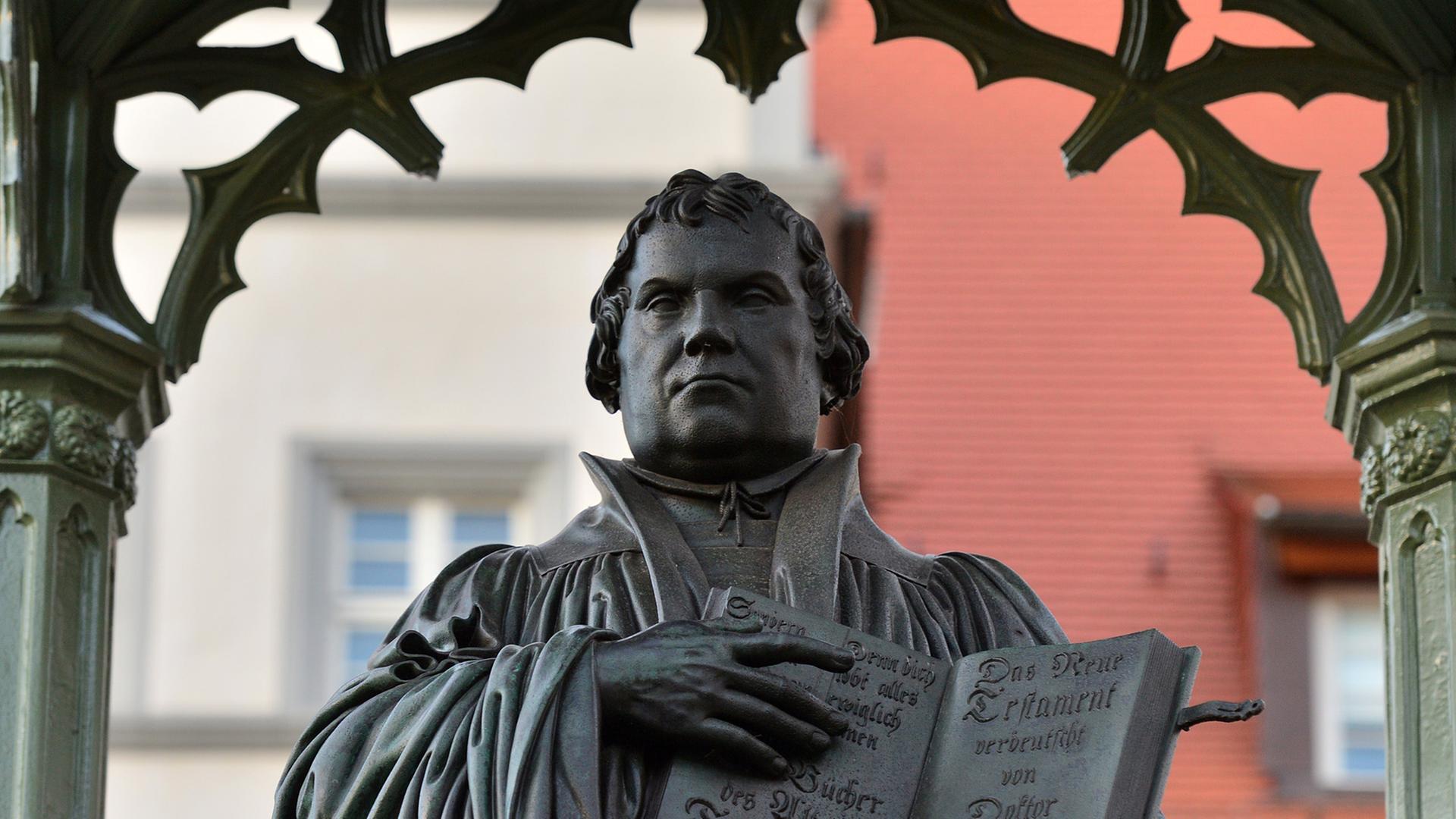
"Wir stehen jetzt direkt an der Lutherpforte, wo Martin Luther ja am 15. Juli 1506 in das Kloster der Augustiner-Eremiten eingetreten ist. Vier oder fünf seiner Studentenfreunde haben ihn hierher begleitet in dem Glauben, dass er ja gar nicht im Kloster bleiben wird. Man hat ihm nicht zugetraut, dass er hier drinnen bleiben wird, aber er hat gesagt beim Eintritt in das Kloster, so wie ihr mich hier stehen seht, werdet ihr mich nie wieder sehen. Er ist in das Kloster eingetreten und kam auch nicht wieder raus."
Die Freiheit eines Christenmenschen hätte für den angehenden Juristen, der auch die artistische Fakultät durchlaufen hatte, durchaus anders aussehen können. Ein weltliches Leben in Erfurt, wo er viele Freunde besaß. Oder im Dienst bei den Grafen von Mansfeld und die spätere Übernahme des elterlichen Bergbauunternehmens, wie vom Vater erwartet.
Eine der vielen Legenden berichtet von einem Blitz, der das Leben des Studiosus grundlegend verändert habe, das Damaskuserlebnis eines zweiten Paulus.
"Als er auf der Rückreise von seinem Elternhaus wieder zu seinen Studentenfreunden kam, kam er kurz vor Erfurt nach Stotternheim, wo heute der große Lutherstein steht, wo angeblich das Gewitter über ihn hinein brach und er schrie, ‚Oh, heilige Anna hilf. Ich will ein Mönch werden'. Also wir sagen heute spaßeshalber: Das ist der Ort, an dem Luther geblitzt wurde. Und sich da eben geschworen hat, ins Kloster einzutreten. Dann hat's ja auch nicht mehr lange gedauert. Zwei Wochen noch, dann stand er hier vor der Tür," sagt Carsten Fromm, Kurator des evangelischen Augustinerklosters Erfurt.
Die Wahl fiel auf den Augustiner-Orden
Warum hatte sich Martin Luther, der damals noch Luder hieß, ausgerechnet für die sehr strengen Augustiner-Eremiten entschieden? Er hätte Franziskaner, Dominikaner oder Karthäuser werden können. All diese Orden waren in Erfurt zu finden. Über seine Motive könne nur spekuliert werden, so Fromm:
"Da liegt die Wahrscheinlichkeit sehr nahe, das Augustiner-Kloster oder der Augustiner-Orden war schon immer ein Orden, der sich der Wissenschaft und des Lernens verschrieben hat, er war ja ein sehr studierte Menschen und wollte deswegen in diesen Orden."
Außerdem stand das Kloster dem Kreis der Humanisten sehr nahe, so Michael Ludscheidt, Leiter der 1646 gegründeten Luther-Bibliothek des Erfurter Augustinerklosters. Sie ist eine der ältesten Bibliotheken der Evangelischen Kirche in Deutschland überhaupt, seit Zerstörung des historischen Bibliotheksgebäudes am Ende des 2. Weltkrieges im ehemaligen Schlafsaal der Mönche untergebracht.
"Das wird ja mitunter unterschätzt auch, wie eng die Verbindung der Ordenshäuser auch zu den Humanisten gewesen ist. Es hat in den Orden und Klöstern viele Humanisten gegeben, Mutian in Gotha, der das Haupt des Erfurter Humanistenkreises ist, ist ja ein Kanoniker, ist ja ein Stiftsgeistlicher beispielsweise."
Mutianus Rufus, der mit Geistesgrößen seiner Zeit wie Erasmus von Rotterdam korrespondierte. Zu dessen Umfeld gehörten auch der junge Dichter Ulrich von Hutten, der zunächst in Erfurt und dann auch in Wittenberg studierte, oder Georg Spalatin, später ein enger Vertrauter Kurfürst Friedrichs des Weisen und Martin Luthers in Wittenberg.
Auch der schon ältere Philosoph und Hebraist Johannes Reuchlin stand dem Humanistenkreis um Rufus sehr nahe, zu dem der junge Luther aufblicken konnte.
"Hierher zu gehen bedeutete, dass man mit den neuesten geistigen Strömungen in Berührung kommen kann. Und wir wissen ja auch, dass Martin Luther beispielsweise über Johannes Lang Verbindungen in die Humanistenkreise hier in Erfurt hatte."
Johannes Lang, der spätere Reformator von Erfurt. Luther hatte bisher nur die enge Welt des elterlichen Mansfeld oder des Franziskanerstifts in Eisenach kennengelernt, abgesehen von einem Abstecher in die Magdeburger Domschule.
Johannes Lang, der spätere Reformator von Erfurt. Luther hatte bisher nur die enge Welt des elterlichen Mansfeld oder des Franziskanerstifts in Eisenach kennengelernt, abgesehen von einem Abstecher in die Magdeburger Domschule.
Erfurt eröffnet neue Welten
Mit rund 20.000 Einwohnern war Erfurt damals eine große Stadt in Deutschland, gelegen an der Handels- und Pilgerstraße Via regia. Die Erfurter Universität gehörte zu den wichtigsten Geisteszentren in Europa. Der gewaltige gotische Dom und weitere 20 Kirchen in der Altstadt erinnern bis heute an die Bedeutung Erfurts im Spätmittelalter.
Nachdem Luther 1501 das Studium in Erfurt aufgenommen hatte, musste er zunächst die Artistische Fakultät durchlaufen. Musik, Rhetorik, Grammatik, Dialektik und die Lehre des griechischen Philosophen Aristoteles gehörten zum Grundwissen. Luther soll ein guter Sänger und Lautenspieler gewesen sein, beste Voraussetzungen für seine später berühmt gewordenen evangelischen Kirchenlieder. Als Magister Artium begann er im Sommer 1505 das Jurastudium. Das wurde allerdings sehr bald durch jenes Blitz-Gelöbnis von Stotternheim beendet. Das vermeintlich göttliche Zeichen überstrahlte den Willen des Vaters und legitimierte Luthers Klostereintritt. Kurator Carsten Fromm:
"Als er eintrat, hatte er nicht gleich sein Noviziat beginnen können. Er wurde erst einmal aufgenommen als Gast für die nächsten acht Wochen ungefähr, wurde untergebracht im Gästehaus damals, um erst mal zu klären, ob er irgendwelche ansteckenden Krankheiten mit sich bringt oder ob er Schulden hat, oder ob er irgendwo Leibeigener sei. Das sind alles Voraussetzungen, um damals in ein Kloster aufgenommen zu werden."
Seit dem 13. Jahrhundert lebten Augustiner-Eremiten in Erfurt, die wegen ihrer geistigen Freizügigkeit immer wieder angefeindet wurden. Sie unterstanden nicht der bischöflichen Aufsicht, sondern dem Ordensgeneral in Rom. Das Leben in evangeliumsgemäßer Armut bedeutete auch Unabhängigkeit für den Bettelorden. Mit dem Klosterbau wurde 1276 begonnen. Neben Nürnberg gehörte Erfurt zu den wichtigsten Augustiner-Konventen überhaupt.
"Jetzt sind wir hier im Kapitelsaal. Der Kapitelsaal ist der Raum, der noch am besten erhalten ist im Originalzustand, wie er damals gebaut wurde. Heute ist es unsere Winterkirche, früher war's der ganz wichtige Raum für die Mönche. Hier hat sich das Mönchskapitel getroffen, am Morgen, wo der Tagesheilige bestimmt wurde oder die Tagesaufgabe definiert wurde, wo sich aber auch abends die Mönche getroffen haben mit dem Prior, um die kleinen Sünden, die die Mönche begangen haben, zu gestehen."
Oder über theologische Fragen zu diskutieren. Hier entwickelte Luther möglicherweise auch die ersten reformatorischen Gedanken im Disput mit den Ordensbrüdern. Überhaupt war der Kapitelsaal der einzige Ort des Klosters an dem die Novizen und Mönche reden durften.
"Also auch der Fußboden hier im Kapitelsaal ist noch so der Originalfußboden, wo wir heute sagen, hier ist Luther gelaufen."
Im Dormitorium, also im gemeinsamen Schlafsaal, in den Mönchszellen, im Kreuzgang oder im Refektorium mussten die Bewohner schweigen. Das Klosterleben war vor allem auf das Bibelstudium und den Gottesdienst ausgerichtet.
"Jetzt sind wir hier bei der letzten nachweislich bewohnten Zelle, in der Martin Luther gelebt hat, die eigentlich nur ganz spärlich möbliert ist mit einer Betbank. In die Zellen sind die Mönche eingetreten, um zu beten, zu meditieren oder eben das Bibelstudium zu betreiben. Schlafen war streng verboten in den Zellen damals, wurde mit Strafe belegt."
"Ein wacher Geist braucht keinen Schlaf"
Eine Zeittafel, angebracht zwischen den Mönchszellen, erklärt den streng geregelten Tagesablauf, dem sich auch Luther seit 1505 unterordnen musste. Ein Umstand, über den sich der Reformator später bei seinen berühmten Tischreden eher lustig machen konnte.
Dennoch, hier bekam der angehende Ordenspriester sein theologisches Rüstzeug.
Dennoch, hier bekam der angehende Ordenspriester sein theologisches Rüstzeug.
"Da sieht man, dass der Tag der Augustiner-Eremiten sehr früh begonnen hat, schon nachts um zwei mit den ersten Stundengebeten bis zum Kompletgebet, was so gegen 21 Uhr war. Ein wacher Geist braucht keinen Schlaf, wurde damals gesagt."
Am 5. April 1507 erhielt Luther die Priesterweihe im Dom. Erfurt litt damals unter einer Pestepidemie. Den Eltern in Mansfeld war zu Ohren gekommen, dass sich auch Martin unter den Opfern befände. Dass er überlebte, habe der Vater als Zeichen höherer Gnade verstanden, was zur Versöhnung mit dem Sohn beitragen sollte, so Fromm.
Wir stehen hier vor dem Altar der Augustinerkirche. Der Altar ist noch das Originalteil, an dem Martin Luther seine erste Primiz gelesen hat, nachdem er im Dom zum Priester geweiht wurde. Und wir stehen hier auf der Grabplatte von Johannes Zachariae, derjenige, der dafür verantwortlich war zum Konstanzer Konzil, 100 Jahre bevor Luther im Kloster war, den Böhmischen Reformator Jan Huss verbrannt zu haben als Ketzer, als Widersacher der Kirche damals."
Allerdings bleibt umstritten, ob der Augustiner-Eremit Johannes Zachariae – Anfang des 15. Jahrhunderts selbst ein Kirchenreformer – tatsächlich aktiv zur Verurteilung von Jan Huss beigetragen hatte. Schließlich sicherte König Sigismund dem Prager Reformator freies Geleit zu, brach dann aber sein Wort. Martin Luther soll dem Theologen später eine Mitschuld am Tode von Huss zugewiesen haben.
"Aber auf der Grabplatte hat Luther gelegen – mit ausgebreiteten Armen, wurde als Mönch in das Kloster aufgenommen, hat hier seine Profess erfahren."
In der Augustinerkirche blieb auch die alte Sedilien-Nische erhalten, eine steinerne Bank im Altarraum, wo die Priester, Diakone und Messdiener während des Gottesdienstes saßen.
Sie blickten direkt auf ein Bleiglasfenster, welches vom Leben des Heiligen Augustinus erzählt. Rechts daneben leuchtet das Löwen-Papageien-Fenster. Wie die anderen beiden Chorfenster stammen sie aus dem Jahre 1310 und gehören somit zu den ältesten Kirchenfenstern von Erfurt, noch älter als die berühmten Maßwerkfenster des Doms. Im Löwen-Papageien-Fenster lüftet sich auch das Geheimnis der Lutherrose. Carsten Fromm:
"Die erste Scheibe zeigt zwei Löwen, das ist ja die Gestalt Jesu. Und dazwischen sieht man eine Rose. Und das ist die sogenannte Lutherrose, die Martin Luther damals ja auch jeden Tag sehen musste, woraus dann später die sogenannte Lutherrose entstanden ist als sein Familienwappen oder Siegel für seine Post zum Beispiel – hat die Lutherrose, wie man sie hier sieht, etwas abgeändert – mit 'ner goldenen Umrandung, mit 'nem schwarzen Kreuz in der Mitte. Etwas anders, wie man sie hier sieht im Original."

