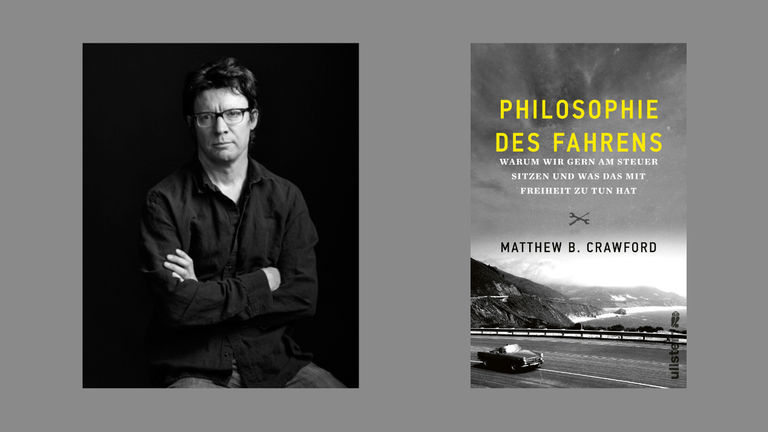
Matthew B. Crawford ist Philosoph und Mechaniker, eines seiner vorherigen Bücher heißt: „Ich schraube, also bin ich“. Wo die Vorlieben hier liegen, ist also klar. Der Original-Titel dieses Buches lautet: „Why we drive“, also „Warum wir fahren“ und macht deutlicher als der deutsche Titel, worum es Crawford im Kern geht.
Um die Freude am Fahren, mit welchem Fahrzeug auch immer, um die Fertigkeiten, um die Nutzung eines komplexen Werkzeugs zur Fortbewegung, um alles, was seiner Ansicht nach den Homo Moto ausmacht. Ja, noch eine Kategorie der menschlichen Natur bzw. das Fahren als Erfahrung der menschlichen Identität.
Das Risiko Mensch aus dem Straßenverkehr tilgen
Das geht Ihnen etwas zu schnell? Verständlich, denn genau darum geht es:
„Plötzlich ist das Fahren ein Thema, das dringend einer kritischen humanistischen Untersuchung unterzogen werden muss.“
Plötzlich und dringend deshalb, weil das Projekt des autonomen Fahrens, also das selbstfahrende Auto, bereits erprobt wird. Diese neueste Entwicklung aus dem Silicon Valley könnte nicht nur unsere Mobilität, sondern auch weitere Teile unseres Menschseins und sogar der liberalen Gesellschaften verändern, meint Crawford.
Denn während es in Deutschland eher darum geht, autofreie Zonen in den Städten zu schaffen und Fahrradstraßen einzurichten, dreht sich in den USA die politische Diskussion darum, das Risiko Mensch nach Möglichkeiten aus dem Straßenverkehr zu tilgen.
„Die Botschaft dieses Buches ist im weitesten Sinn politisch. Angesichts der fortschreitenden Verwaltung und Befriedung zahlreicher Lebensbereiche möchte ich diese eine Domäne des Könnens, der Freiheit und der individuellen Verantwortung – das Fahren – untersuchen, bevor es zu spät dafür ist. Und ich möchte Argumente vorbringen, die dafürsprechen, die Menschen fahren zu lassen.“
Das Fahrzeug erweitert die körperlichen Fähigkeiten
Bevor Matthew Crawford zu den konkreten Eigenheiten und Gefahren des autonomen Fahrens kommt, geht es ausführlich um das, was es seiner Ansicht nach zu bewahren gilt. Die Gedankenspiele des Autors durchlaufen alle Bewegungsmodi, vom Gehen über das Fahrradfahren bis zum Fliegen. Die Vielfalt der Fortbewegungsarten kreiert laut Crawford den Homo Moto, ein Hybridwesen, das ein Fahrzeug wie eine Prothese benutzt, um die körperlichen Fähigkeiten zu erweitern.
Eines steht dabei immer im Vordergrund: das Selbstfahren, die aktive Rolle, die Kontrolle. Passagier will Crawford in der Regel nicht sein. Und so klingt während des Lesens im Hinterkopf auch der entsprechende Song von Iggy Pop immer wieder an, bis auch der Autor ihn explizit nennt:
„Ein Passagier ist unbeteiligt, von anderen isoliert, während das Geben und Nehmen des städtischen Straßenverkehrs eine Interaktion darstellt, in der die Fähigkeit zu Kooperation und Improvisation gefordert ist. Als solches ist das Fahren eine Form von organischem bürgerlichem Leben […] Aber aus Sicht einer Zentralmacht (sei es eine Regierung oder eine utopische technologische Macht) ist ein idealisiertes Subjekt anderer Art wünschenswert, nämlich ein asoziales, das es ermöglicht, eine atomisierte Darstellung des menschlichen Wesens zu operationalisieren. Dieses Subjekt hat Ähnlichkeit mit dem Erzähler des Songs ‚The Passenger‘ von Iggy Pop: ‚Ich bin ein Passagier / Ich bin unter Glas.‘ Eine Gesellschaft derart isolierter Subjekte ist formbarer und kann effizienter regiert werden.“
Sicherheit als Ideologie?
Um sein Schreckensszenario deutlich zu machen, zieht der Autor immer wieder den Film Wall-E heran, in dem Menschen durch technische Überversorgung über Generationen verlernt haben zu gehen, einander direkt anzusprechen oder auch Entscheidungen der Hierarchie zu hinterfragen.
Crawford ist allerdings nicht technologiefeindlich, er hebt ausdrücklich die technischen Errungenschaften der Fahrassistenzsysteme hervor, lobt Fortschritte in Sachen Sicherheit. Allerdings drohe Sicherheit in manchen Bereichen zu einer Art Selbstzweck zu werden, zu einem moralischen Gebot, dem nur schwer etwas entgegen zu setzen sei.
Wenn alles der Sicherheit untergeordnet werde, wirke diese ideologisch in unsere Gesellschaft hinein. Dem Menschen würden immer mehr Fähigkeiten abgesprochen, das kann nach Ansicht Crawfords eben diese Fähigkeiten verkümmern lassen und eine Infantilisierung vorantreiben, die er bereits am Werk sieht. Der Mechaniker-Philosoph plädiert dafür, einander Kompetenzen zuzugestehen, damit letztlich auch die Demokratie lebensfähig bleibt.
„Wenn plötzlich Ampeln ausfallen, fühlen wir uns manchmal so, als seien wir aus einem langen Schlummer erwacht. Wir erkennen, dass wir Aufgaben mit ein wenig Vertrauen zueinander selbst bewältigen können.“
Solche passenden Bilder zu entwerfen, gelingt Crawford oft. Das entkräftet anfängliche Befürchtungen, die sich beim Lesen einstellen, hier könnte ein US-amerikanischer Ulf Poschardt schreiben. Der leitende Journalist der Welt-Gruppe äußert sich gern und oft über seine Vorliebe für das Autofahren und gegen ein mögliches Tempolimit auf Autobahnen. Zwar führt auch Crawford das Freiheitsargument ins Feld, aber auf elegante und stimmige Art. Bei ihm geht es nicht um einen Ego-Road-Trip, es geht ihm um angemessene Regeln zur gemeinsamen Nutzung der Ressource Raum.
Die problematischen Seiten des Freiheitsstrebens
Das freiheitsliebende Ich könne sich auf mannigfache Art dem Gemeinwesen unterordnen, ohne gleich moralisch beschämt werden zu müssen. „Verkehrsregime“ hingegen, also auf strikte Regelbefolgung beruhende Systeme, schränkten den Problemraum wie auch die verfügbaren Lösungen ein, meint Crawford:
„In Infrastrukturen, die auf einem unflexiblen Ideal der Kontrolle beruhen, ist kein Raum für die Ausübung unserer menschlichen Fähigkeiten [...] – was zu einer Verkümmerung des Menschlichen führt.“
Diese Befürchtung äußert Crawford immer wieder, dass Fähigkeiten verkümmern bzw. weiter verkümmern. Und er bringt überzeugende Beispiele an: Statt auf unsere Orientierung zu setzen oder Karten zu studieren, verlassen wir uns auf mittlerweile auf Navigationssysteme. Bei durchgehenden Tempolimits verlieren wir die Fähigkeit einschätzen zu können, welches die angemessene Geschwindigkeit für welche Situation und welche Straße wäre.
Matthew Crawford fordert keine Freiheit um jeden Preis. Im Gegenteil, er thematisiert die problematischen Seiten des Freiheitsstrebens der Autofahrer, etwa die Nähe zu populistischen Gruppierungen oder Parteien, wenn es um Aussprüche wie „freie Fahrt für freie Bürger“ geht.
Schwächen in der Argumentation
Die Argumentation ‚Sicherheit versus Risiko‘ im Text ist ausgewogen und anschlussfähig, jedoch macht Crawford in weiten Teilen des Buches keinen Hehl aus seiner ausgeprägten Risikobereitschaft. Wir erfahren, dass er gerne schnell Motorrad fährt, auch offroad, er berichtet von seinen Bußgeldverfahren und vom Besuch von Wettrennen. Da ist er also doch, ein beträchtlicher Freiheitsdrang.
Man kann Crawfords Buch als Impuls gegen die überregulierten Verhältnisse in den USA lesen – schließlich gelten Geschwindigkeiten von mehr als 130 km/h dort als „rücksichtsloses Fahren“, worauf mindestens Geldbußen, aber auch Haftstrafen drohen. Und sein Text ist zugleich ein Versuch der Selbstregulierung nach Maßgaben, für die er Modelle in aller Welt sucht.
Und natürlich darf Deutschland nicht fehlen, wenn jemand übers motorisierte Fahren und Geschwindigkeit nachdenkt. Auch wenn die Autobahnstrecken ohne Tempolimit mittlerweile übersichtlich sind, gilt die deutsche Lösung der Richtgeschwindigkeit vielen Autofans auf der Welt als Schlaraffenland. So überzeichnet und idealisiert erscheint sie auch bei Crawford. Und ist ein Beispiel für einige Stellen im Buch, an denen er es nicht so genau nimmt: mit den Fakten, mit den Recherchen.
Denn er zitiert schlicht die New York Times, in Deutschland hätte die Diskussion über ein mögliches Tempolimit auf Autobahnen 2019 beinahe Unruhen ausgelöst. An anderer Stelle führt er Korruption in der Verkehrspolitik an, um die Phänomene Wutbürger und Trumpisten zu erklären. Seine Argumentation wirkt hier spontan und unausgegoren. An manchen Stellen im Text zieht der Praktiker eben die Schraube fest, noch bevor der Philosoph die richtige Position für sie austariert hat. Meist gelingt das Spiel jedoch.
Was wirklich überzeugt, ist erstens, wie der Autor die Auswirkungen von Überregulierung auf gesellschaftliche und letztlich demokratische Verhältnisse beschreibt und zweitens seine Beobachtungen und Befürchtungen zum Autonomen Fahren.
Zum ersten Punkt: Bürgerräte, mehr Mitbestimmung, mehr Verantwortung des Einzelnen sind die meist genannten Rezepte gegen die Krise der Demokratie, gegen den Legitimationsverlust. Wenn mehr Eigenverantwortung der Demokratie also gut tut, sind Crawfords Warnungen vor Überregulierung durch Autoritäten durchaus plausibel.
Fahrberechtigung in Stufen
Manchmal gleitet seine Argumentation hier allerdings in Eitle ab. Ginge es nach Crawford, gäbe es ein Führerschein-System in Stufen, das fahrerische Kompetenz und möglichst geringe Umweltbelastung mit mehr Befugnissen belohnte. Die gute Idee daran ist, dass die leichteren und mit weniger Ablenkung ausgestatteten Fahrzeuge mehr Berechtigungen hätten. Aber der Autor versteigt sich hier in eine selbstgerechte Perspektive, weil er sich und sein Verhalten zum Maßstab macht.
Sehr greifbare und einladende Gedanken entwirft der Autor, wenn er sich der Verwaltung widmet, die mit Mobilität zusammenhängt. Crawford schildert Besuche beim Verkehrsamt, die sich genauso abspielen wie in Deutschland. Ein solcher Gang diene der Erziehung in bürgerlicher Tugend, schreibt er, wobei mit Tugend an dieser Stelle die Unterwerfung gemeint sei.
„Hier haben wir es mit der Wiederbelebung einer tatsächlich vormodernen Form von Autorität zu tun. Wir halten uns für ultramodern, aber der eigentümliche Charakter des institutionellen Lebens in den Vereinigten Staaten scheint uns in die entgegengesetzte Richtung zu führen, denn er erschüttert das Vertrauen der Bürger, dass man mit Logik der Welt einen Sinn abgewinnen kann. Auf dem Spiel stehen unsere Bereitschaft, uns um Verständnis zu bemühen, und unser Vertrauen in unser Verständnisvermögen.“
Auch hier warnt Crawford offensichtlich vor antidemokratischen Tendenzen. Aufklärerische Ideen und Eigenschaften seien wenig erwünscht. Was ihn zu seinem Hauptanliegen führt: vor den Gefahren zu warnen, die von den Tech-Konzernen, vom Überwachungskapitalismus ausgehen.
Machtbegrenzung für Google & Co.
Zunächst einmal fordert Crawford dazu auf, die angebliche Unvermeidbarkeit zu hinterfragen, mit der technologische Neuerungen angekündigt werden. Das selbstfahrende Auto werde oder müsse kommen, weil es mehr Sicherheit und einen besseren Verkehrsfluss bringe. So laute die Botschaft aus dem Silicon Valley, die wichtige Vertreter Washingtons aufgenommen hätten und wiederholten. Bevor Crawford diese fragwürdige Gewissheit zerpflückt, benennt er die Haltung und die Marktmacht, die hier demonstriert werden.
„Sollten diese Fragen nicht von uns entschieden werden, im demokratischen Wettbewerb und im Spiel der Marktkräfte? So passiert es aber nicht. Vielmehr hat diese neue, sehr unilaterale Form von politischer Ökonomie größere Ähnlichkeit mit einer kolonialen Eroberung. […] Mittlerweile ist klar, dass die Bemühungen zur Entwicklung autonomer Autos keine Reaktion auf eine Nachfrage der Konsumenten sind, sondern ein von oben diktiertes Projekt, das der Öffentlichkeit verkauft werden muss.“
Autonomes Fahren – der Begriff scheint schon seltsam gewählt, geht es doch darum, dass die Maschine autonom fahren soll. Der Insasse des Fahrzeugs soll oder darf seine Autonomie aufgeben – wahlweise für das Argument mehr Sicherheit oder mehr Zeit für sich.
Wollen wir wirklich das Auto entscheiden lassen?
Zum Punkt Sicherheit trägt Crawford ausführlich zusammen, wie viel Rechenleistung und Energie es bräuchte, um menschliche Sensorik nachzubauen. Er wirft die Frage auf, ob Algorithmen tatsächlich angemessenes Verhalten erzeugen können und kommt darüber zur spannenden Frage der Maschinenethik. Wollen wir wirklich das Auto entscheiden lassen, wenn ein Unfall droht?
Beispielszenario: Ein Kind rennt auf die Straße, Bremsen würde nicht mehr reichen, Ausweichen würde eine Gruppe Fußgänger auf dem Gehweg gefährden. Das Auto rechnet und weicht nicht aus. Schlimm genug, wenn Menschen eine solche Entscheidung im Bruchteil einer Sekunde fällen, wenn sie eigentlich nur reagieren und nicht entscheiden können. Aber wollen wir, dass Maschinen uns das abnehmen? Crawford stellt hier den Vergleich zum Drohneneinsatz beim Militär an, das Töten auf Distanz. Auch wenn der Vorgang eine ganz andere Qualität hat, der Verweis auf die Mittelbarkeit ist richtig.
„Die Abstraktion kappt die Beziehung zu unserem Handeln.“
Das hat zur Folge, dass wir einen anderen Platz in der Welt einnehmen. Wir werden dauerhaft zum passiven Passagier. Das Fahrzeug wird uns während der neu gewonnenen Freizeit Konsumvorschläge machen oder uns ermöglichen noch länger zu arbeiten. Crawford sieht die Wurzeln dieser Entwicklung, dass wir uns weniger beteiligen wollen, uns der Abstraktion hingeben, in der Ideologie des Utilitarismus. Darüber kann man streiten. Richtig ist der Hinweis, dass mit der fortschreitenden Automatisierung Menschliches aus menschlichem Verhalten entfernt wird.
„Je weiter die Maschinen in den Raum für intelligentes menschliches Handeln vordringen, desto stärker wird unsere Intelligenz ausgehöhlt, was wiederum Forderungen nach weiteren Automatisierungsschritten auslöst.“
Menschliches wird aus menschlichem Verhalten entfernt
Ähnlich argumentieren Kritiker des Überwachungskapitalismus, der es ermöglicht, Arbeiter in Logistikzentren oder Kurierfahrer Algorithmen zu unterwerfen und diese Menschen damit gewissermaßen zu automatisieren. Die Ähnlichkeit kommt nicht von ungefähr, denn all diese vermeintlichen Optimierungsideen kommen von großen Tech-Firmen. Zur Datengenerierung möchten sie all unsere Lebensbereiche erschließen und monetarisieren. Und Bewegungsprofile, die autonome Fahrzeuge speichern werden: Aufenthaltsdauer bei Ärzten, in Fitnesscentern oder Bars, das sind Daten, die man zum Beispiel auch der Versicherungsbranche weiterverkaufen könnte. Solche digitalen Fahrtenbücher gibt es übrigens schon. Sie könnten bald zur Fahrzeugausstattung gehören, ohne dass klar ist, wer auf diese Daten zugreifen darf.
Crawford zeichnet realistische Szenarien und weist immer wieder darauf hin, dass wir noch entscheiden können, ob wir uns auf diese Veränderung einlassen wollen. Eine Veränderung, die in letzter Konsequenz auch den öffentlichen Raum in die Hände von Großkonzernen legen würde. Denn sie würden im nächsten Schritt auch die technische Infrastruktur kontrollieren – z.B. die Frage, wer darf mit welchem Fahrzeug bevorzugt über die Kreuzung. Und auch die Vision der Smart Cities hängt am wachsenden Einfluss der Tech-Riesen auf unseren Lebensraum, auf eigentlich öffentliches Gut. Hier mögen die USA zwei Schritte weiter sein, aber erfahrungsgemäß erreichen uns solche Veränderungen mit etwas europäischer Verzögerung auch.
„Wir sind gut beraten, uns hin und wieder die grundlegende Erkenntnis der liberalen Tradition in Erinnerung zu rufen: Die Macht korrumpiert, vor allem, wenn sie in einer Black Box versteckt und dadurch der gesellschaftlichen Kontrolle entzogen ist.“
Eine sinnvolle Warnung, die Macht von Google und Co. nicht allzu groß werden zu lassen. Mit Googles Geschäftsmodell und Machtambitionen setzt sich Crawford ausführlich auseinander. Die Legitimität der Konzernmacht beruhe nicht auf Rationalität, auf Gründen, die hinterfragt und verteidigt werden könnten. Hier sei die Datenwissenschaft am Werk, der die menschliche Logik nicht mehr folgen könne.
Aber so fatalistisch, wie es hier anklingt, denkt der Mechaniker Crawford nicht. Vielmehr weckt diese Entwicklung seinen libertären Geist.
„Unsere Maschinen können nur optimal funktionieren, wenn wir uns ihnen unterordnen. Vielleicht bedarf es einer Anpassung des menschlichen Geistes, um ihn mit einer Welt in Einklang zu bringen, die von einer Maschinenbürokratie gelenkt werden soll. Oder sollten wir vielleicht eher die Zentrale dieser Bürokratie niederbrennen?“
Die Zukunft birgt mehr als Technik
Auch wenn diese Art von Widerstand rein rhetorisch gemeint ist, um Widerstand geht es Crawford. Die Zukunft ist für ihn nicht unweigerlich durchtechnisiert. Er liebt das analoge Fahrzeug. Auf vielen, vielen Seiten lernen wir, wie ein Schrauber tickt. In persönlichen Anekdoten erfahren wir Etliches übers Fahren, Basteln und über Pannen. Er präsentiert viele Details aus der Automobilgeschichte, feiert Erfinder und Motorenteile. Sogar Zeichnungen solcher Teile hat er eigens angefertigt.
An einigen Stellen schwelgt der Autor allzu sehr in Fahrnostalgie. Mit seiner Leidenschaft und seinem Detailwissen holt er die Leserinnen und Leser aber auch immer wieder ab. So spricht er jedem Autofahrer aus der Seele, wenn er über die wünschenswerte Gleichmäßigkeit des Fahrstils schreibt, die Verkehrsstaus dezimieren könnte. Ja, wenn doch an der Ampel nur alle gleichzeitig losfahren würden…
Probleme und Fehlentwicklungen aufzeigen, das ist Crawfords Absicht. Lösungen präsentieren ist es nicht. Was er will, ist die Möglichkeit für jede und jeden, sich nach den eigenen Vorlieben fortzubewegen, kein Diktat des vermeintlich Besseren, weil Fortschrittlicheren. Kein Ablaufdatum für die Fertigkeiten des Fahrens und die soziale Interaktion. Und anders als viele deutsche Bücher über Mobilität, die das Auto zu etwas nicht Zukunftsfähigem erklären, geht es Crawford darum, neben dem Nutzen des Autos auch die Freude am Fahren zu bewahren - bei aller Einsicht notwendiger Veränderungen.
Matthew B. Crawford: „Philosophie des Fahrens. Warum wir gern am Steuer sitzen und was das mit Freiheit zu tun hat“,
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Stephan Gebauer,
Ullstein Verlag, Berlin, 467 Seiten, 26,99 Euro.
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Stephan Gebauer,
Ullstein Verlag, Berlin, 467 Seiten, 26,99 Euro.








