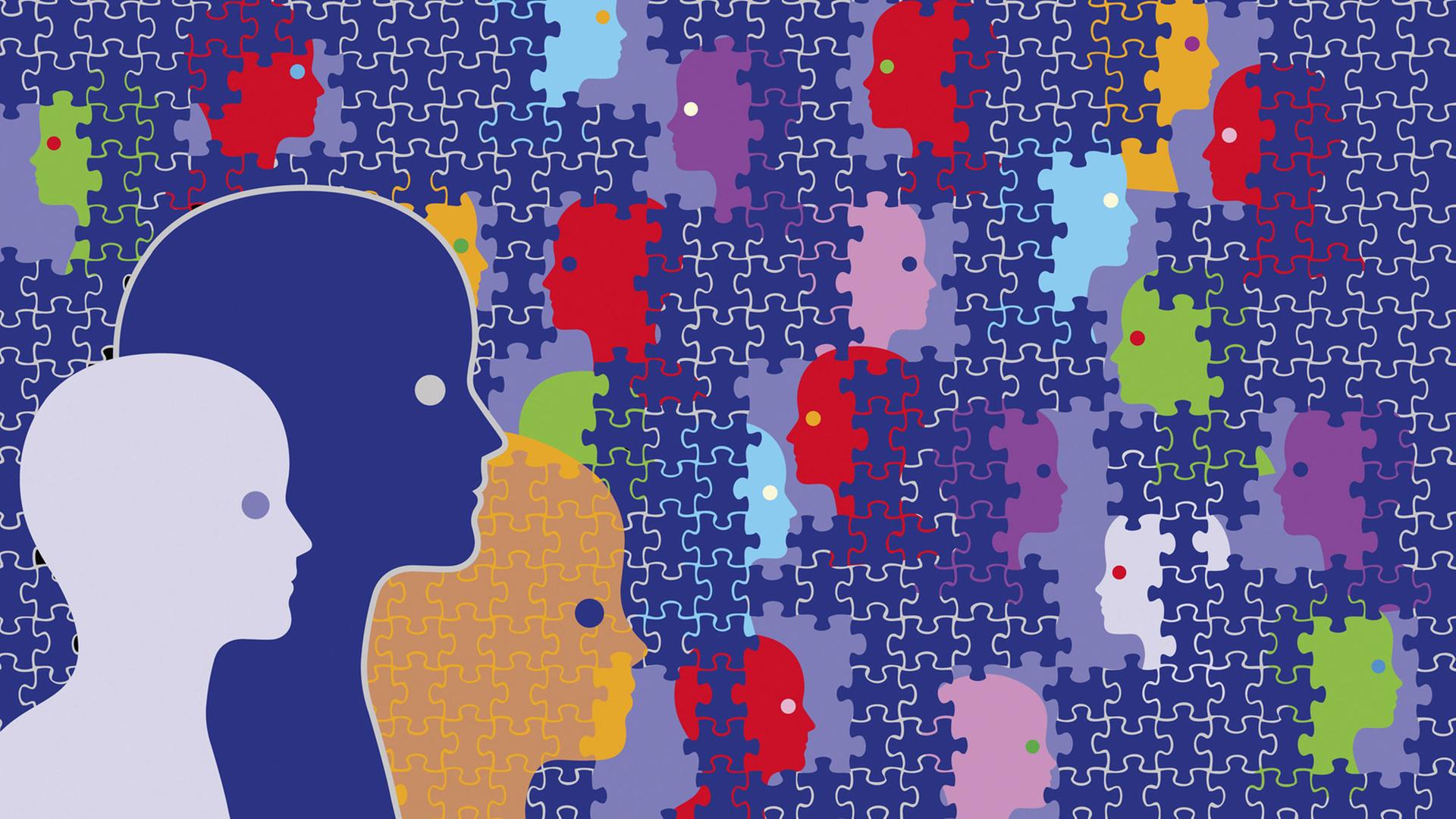„Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ ist ein Schlachtruf, der seit bald 30 Jahren durch die mediale Arena tönt. Mittlerweile gibt es drastischere Ausdrücke dafür, weil die Rhetorik in den letzten Jahren eskaliert ist. An dem Witz des Gejammers, Dinge angeblich nicht mehr sagen zu dürfen, hat sich derweil nichts geändert.
Denn wann immer jemand beklagt, etwas nicht mehr sagen zu dürfen, hat er das im gleichen Augenblick getan. Wann immer jemand „Stigmatisierung“ schäumte, ist seine scheinbar geächtete Äußerung in Artikeln rauf und runter diskutiert worden. Kurz: Über nichts kann man so oft und wiederholt reden und schreiben wie über die Sachen, über die man angeblich nicht mehr reden und schreiben darf.
Dabei gibt es Dinge, über die keiner reden will und über die auch kaum geredet wird. Rassismus zum Beispiel. Noch bis zum 25. März laufen die Internationalen Wochen gegen Rassismus – ein Anlass, der medial kaum Berichterstattung hervorruft. Warum auch, wir sind doch alle dagegen. So allgemein.
Rassismus gibt es vielleicht in den USA, aber nicht in deutschen Medien
Konkret sieht das anders aus: Ich habe neulich in einer Kritik zu einem „Tatort“ geschrieben, dass man an einer bestimmten Konstellation in diesem Krimi verstehen kann, wie Rassismus funktioniert. Was das Schlimme daran ist auch für die, von denen er ausgeht. Ich habe nicht geschrieben, der „Tatort“ sei rassistisch. Aber es meldeten sich sofort einige Kommentatoren zu Wort, die meinen „Rassismus-Vorwurf“, den ich keinem gemacht hatte, absurd fanden und abstreiten mussten.
Das beschreibt die Lage ganz gut. Oder fällt Ihnen ein Beispiel ein, wo jemand konkret auf Rassismen in unserer schönen deutschen Kultur hinweist und die öffentliche Meinung, die Theaterkritiker und Fußballkenner sagen: Ja, das stimmt?
Mir nicht. Rassismus gibt es vielleicht in den USA, aber nicht in deutschen Medien, nicht in der deutschen Wirtschaft, nicht im deutschen Alltag. Das ist schon Teil der Verdrängung, und die macht es so schwer, darüber zu reden. „Rassismus“ wird man eben nicht sagen dürfen, da sind die sogenannten Meinungskorridore ganz eng, da übertreibt man oder macht unhaltbare Vorwürfe.
Ich habe diese Ablehnung neulich in einem Frankfurter Kneipengespräch gespürt. Da habe ich getan, was dieser Tage für manchen Feuilletonisten das Allerwichtigste mit Blick nach rechts zu sein scheint: dass alle miteinander reden. Ich saß an einem Tisch mit zwei Männern, die CDU-Stadträte waren. Und habe mit denen geredet. Ich habe nicht gesagt, ihr seid Rassisten. Ich wollte keinen entlarven, ich wollte mich nicht besser fühlen, schon weil ich weiß, dass rassistisches Denken auch in mir steckt. Dass ich in einer rassistischen Struktur lebe, in der mir mein Weißsein Privilegien beschert.
Beim Thema Rassismus sind Plaudereien schnell zu Ende
Ich habe nur über Rassismus reden wollen. Als Thema. Ursprünglich aus einem historischen Interesse, weil einer der beiden Zeitzeuge eines kaum bekannten Falles von rassistischer Aufwallung hätte sein können. Wenn ich ihn gefragt hätte, wie er den Mauerfall erlebt hat, hätte er bestimmt freudig und ausführlich geantwortet. Bezogen auf den kaum bekannten historischen Fall wurde er aber schmallippig, davon hätte er nichts mitbekommen, was ja durchaus sein kann. Seine Begründung fand ich allerdings nicht überzeugend: Rassismus hätte es damals nicht gegeben. Nach etwas Nachfragen sagte er dann Dinge, denen rassistische Denkmuster zugrunde lagen. Hätte ich darauf hingewiesen, wäre unsere Plauderei vermutlich zu Ende gewesen.
Also haben wir das Thema gewechselt. Wir haben über Politik gesprochen und Frankfurt. Und sind irgendwann auf Volker Bouffier gekommen, den die beiden ziemlich toll fanden. Ich habe gesagt, dass ich mir das vorstellen kann, dass der Volker ein toller, bürgernaher Typ ist. Ich habe dann aber auch noch mal gefragt, wie die beiden sich erklären, dass Bouffier in Sachen NSU-Komplex so mauert; dass er nicht darüber redet, wie er als damaliger Innenminister den rassistischen Mord an Halit Yozgat erlebt hat – jenem jungen Mann, der 2006 in seinem Internetcafé in Kassel mit der NSU-Ceska erschossen wurde. Zu einer Zeit, als merkwürdigerweise ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes anwesend war. Einer Behörde, die in das Ressort des Innenministers gehört.
Da war die Stimmung wieder im Keller. Die Äußerungen meiner Gesprächspartner wurden karg, die eben noch so lebendige Schwärmerei über persönliche Treffen mit Bouffier wich vagen Fluchten ins Allgemeine. Überhaupt hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, permanent schlechte Laune zu verbreiten mit der Wahl des Gesprächsthemas. Dabei wollte ich das doch nur mal sagen dürfen.