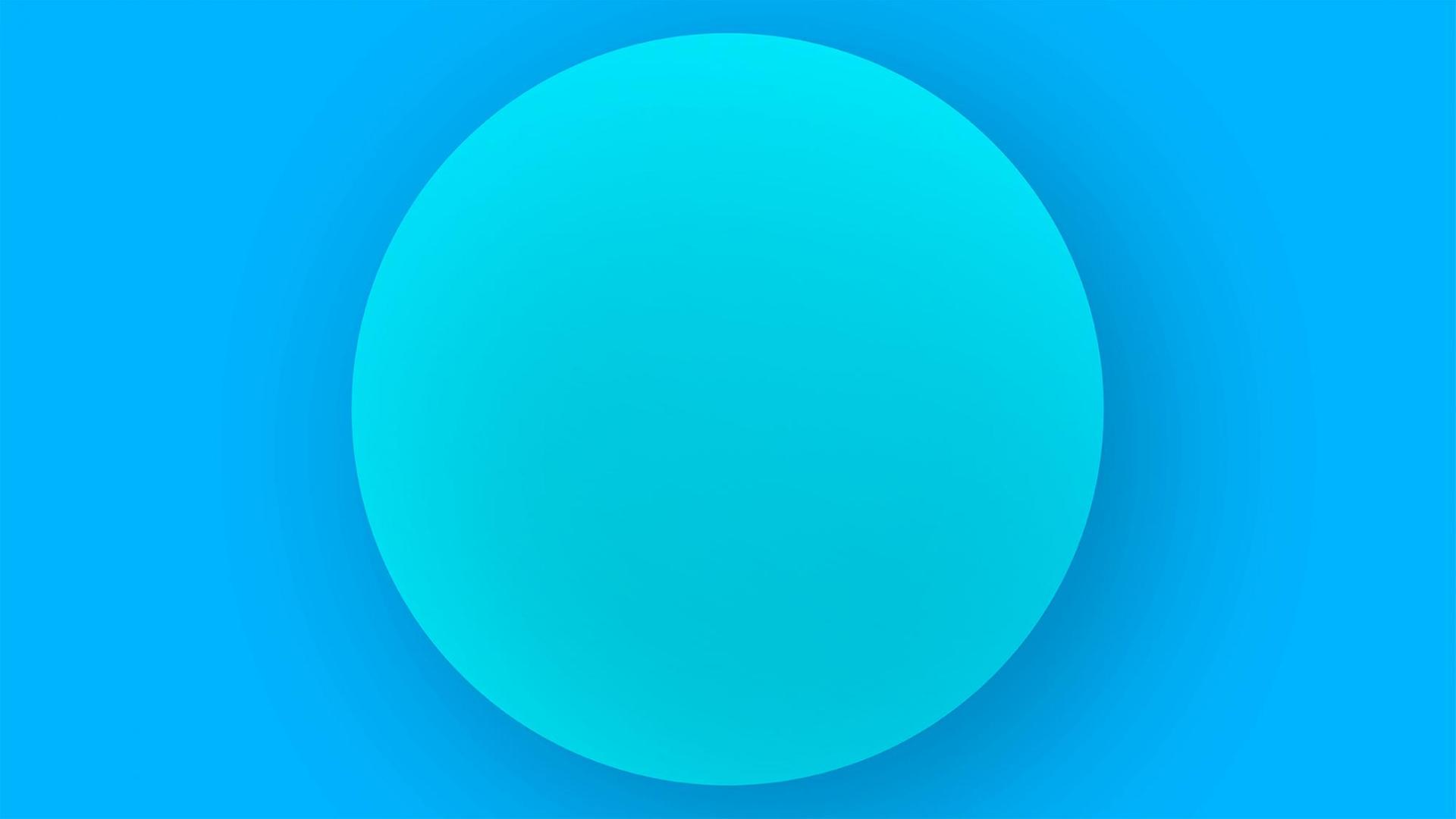War das ein politischer Dammbruch? Nach einer hitzigen Bundestagswoche mit einer historischen Abstimmung über eine Verschärfung der Migrationspolitik streiten die Parteien um die Deutungshoheit.
Am Mittwoch (29.01.2025) hatte ein Fünf-Punkte-Plan von CDU/CSU, der die Zurückweisung von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen fordert, eine Mehrheit im Bundestag erhalten – unter anderem mit den Stimmen der in Teilen rechtsextremen AfD. Ein Tabubruch, sagen Politiker von SPD und Grünen, und kritisieren den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz dafür scharf.
Der Kanzlerkandidat der Union hatte als Reaktion auf den tödlichen Messerangriff durch einen ausreisepflichtigen Asylbewerber in Aschaffenburg einen radikalen Kurswechsel in der Asyl- und Migrationspolitik angekündigt. Die Kritik an seinem Vorgehen weist Merz zurück. Auch wenn ein weiterer Antrag seiner Partei zur Verschärfung der Migrationspolitik, das „Zustrombegrenzungsgesetz“, zwei Tage später im Bundestag scheiterte, fühlt sich der CDU-Chef in seinem Kurs bestärkt.
Fest steht: Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl ist die Migrations- und Asylpolitik endgültig zum Wahlkampfthema Nummer eins geworden. Die Polarisierung der politischen Lager in der Debatte könnte stärker nicht sein. Und es stellt sich die Frage: Hat sich Merz mit seinem umstrittenen Vorgehen verzockt?
Inhalt
- Wie will Merz die Asyl- und Migrationspolitik verschärfen?
- Welche Reaktionen gab es auf die Abstimmung mit der AfD?
- Was stand im Entwurf zum "Zustrombegrenzungsgesetz"?
- Hat sich Merz verzockt?
- Was könnte der neue Merz-Kurs für die Koalitionsfrage nach der Wahl bedeuten?
- Wie ist die Merz-Initiative europarechtlich und aus Sicht der Polizei zu bewerten?
Wie will Merz die Asyl- und Migrationspolitik verschärfen?
Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz kündigte nach dem tödlichen Messerangriff von Aschaffenburg Konsequenzen für die Asyl- und Migrationspolitik an. Im Falle seiner Wahl zum Regierungschef werde er von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und am ersten Tag im Amt das Innenministerium anweisen, alle Grenzen dauerhaft zu kontrollieren und alle illegal Einreisenden zurückzuweisen. Das gelte auch für Menschen mit Schutzanspruch. „Es wird ein faktisches Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland für alle geben, die nicht über gültige Einreisedokumente verfügen oder die von der europäischen Freizügigkeit Gebrauch machen.“
„Es wird unter meiner Führung fundamentale Änderungen des Einreiserechts, des Asylrechts, des Aufenthaltsrechts in der Bundesrepublik Deutschland geben“, sagte Merz. „Wir werden diesen Zustand beenden.“ Der Kanzlerkandidat kündigte zudem eine Verschärfung von Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft an und will mehr Kompetenzen für die Bundespolizei. Die EU-Asylregeln seien dysfunktional. „Deutschland muss daher von seinem Recht auf Vorrang des nationalen Rechts Gebrauch machen."
Merz betonte, dass die von ihm geforderten Konsequenzen Bedingungen für eine Koalitionsregierung unter seiner Führung sein sollen. „Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht“, sagte Merz. „Ich sage nur: Ich gehe keinen anderen.“ Wer den Weg mit ihm gehen wolle, müsse sich nach diesen Punkten richten. „Kompromisse sind zu diesen Themen nicht mehr möglich.“
Fünf-Punkte-Plan zur Verschärfung der Migrationspolitik
Handlungswillen wollte Merz schon vor der Bundestagswahl beweisen: Am Mittwoch (29.01.2025) brachte die Union einen Fünf-Punkte-Plan zur Verschärfung der Migrationspolitik in den Bundestag ein. Gefordert wird darin unter anderem die Zurückweisung von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen. Der Antrag fand im Bundestag eine Mehrheit, allerdings nur, weil neben FDP und sechs Fraktionslosen auch die Abgeordneten der in Teilen rechtsextremen AfD zustimmten.
Ein Szenario, das absehbar war. Merz hatte daher vor der Abstimmung betont: „Wer diesen Anträgen zustimmen will, der soll zustimmen. Und wer sie ablehnt, der soll sie ablehnen. Ich gucke nicht rechts und nicht links. Ich gucke in diesen Fragen nur geradeaus.“ Ein zweiter Antrag der Unionsfraktion zu einer restriktiveren Migrationspolitik, bei dem es auch um erweiterte Befugnisse von Sicherheitsbehörden ging, fand keine Mehrheit.
Welche Reaktionen gab es auf die Abstimmung mit der AfD?
Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisierte CDU-Chef Merz in einem Statement deutlich. Sie erinnerte an dessen Äußerungen aus dem vergangenen November, vor der Bundestagswahl keine Abstimmungen herbeizuführen, die „zufällige oder tatsächlich herbeigeführte“ Mehrheiten mit der AfD erforderten. Sie halte es für falsch, sich nicht mehr an diesen Vorschlag gebunden zu fühlen und „und dadurch am 29. Januar 2025 sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD zu ermöglichen“, betonte Merkel.
Auch aktive CDU-Politiker äußerten öffentlich Kritik am Vorgehen von Merz. Im Deutschlandfunk warf der Oberbürgermeister von Rottenburg am Neckar, Stephan Neher, seinem Partei-Chef Wortbruch vor und stellte dessen Verlässlichkeit als Kanzlerkandidat infrage. Der Publizist Michel Friedman trat aus Protest aus der CDU aus.
Unionskanzlerkandidat Merz selber äußerte Bedauern, dass es eine Mehrheit für den Antrag der Union mithilfe der AfD gegeben hat. "Ich suche in diesem Deutschen Bundestag keine anderen Mehrheiten als die in der demokratischen Mitte des Parlaments. Wenn es hier heute eine solche Mehrheit gegeben hat, dann bedauere ich das", sagte er nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses.
SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich warf Merz nach der Abstimmung eine unverantwortliche Leichtfertigkeit vor. Dieser Tag werde sich ins Gedächtnis der Demokratie und wohl auch in die Geschichte des Landes eingraben. Auch die Grünen sprachen von einem schwarzen Tag für die Demokratie.
Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte: "Ich finde es enttäuschend, dass die demokratischen politischen Kräfte in unserem Land – auch in Zeiten des Wahlkampfs - nicht in der Lage waren, sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen und damit der AfD diese Bühne bereitet haben."
Auch Kirchen und Verbände äußerten sich kritisch: Das Versprechen, keine gemeinsame Sache mit der AfD zu machen, sei nicht nur gebrochen worden, sagte Delal Atmaca, Geschäftsführerin und Mitbegründerin des Dachverbandes der Migrantinnenorganisationen DaMigra. Eine Riesenschleuse sei geöffnet worden und habe die AfD salonfähig gemacht.
Die Kirchen hatten sich bereits im Vorfeld kritisch zum Antrag der Union geäußert. Die vorgeschlagenen Verschärfungen seien nicht zielführend. Außerdem könne die deutsche Demokratie massiven Schaden nehmen, wenn man die Zustimmung der AfD in Kauf nehme.
Protest regt sich auch in der Kunst- und Kulturszene. „Geschichte wiederholt sich und wir schauen dieses Mal nicht weg“, heißt es in einem „Offenen Brief zur Erhaltung der Brandmauer“. Darin fordern Schauspieler, Musikerinnen und weitere Kulturschaffende die Abgeordneten von Union, FDP und BSW auf, keine gemeinsame Sache mit der AfD zu machen.
Zwei Träger des Bundesverdienstkreuzes, einer davon ein Holocaust-Überlebender, kündigten an, ihre Auszeichnungen zurückzugeben. Zehntausende gingen seit Mittwoch auf die Straße, um gegen Merz und die Union zu demonstrieren, auch vor deren Parteizentralen.
AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel sprach dagegen nach dem ersten durch Zustimmung ihrer Fraktion beschlossenen Antrag im Bundestag von einem "historischen Tag für Deutschland". Es sei ein "Sieg für die Demokratie", schrieb Weidel auf dem Onlinedienst X.
Die AfD dagegen feierte nach dem ersten durch Zustimmung ihrer Fraktion beschlossenen Antrag im Bundestag: AfD-Abgeordnete posierten triumphierend im Plenarsaal für ein Selfie. AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel sprach von einem "historischen Tag für Deutschland". Es sei ein "Sieg für die Demokratie", schrieb Weidel auf dem Onlinedienst X. Ihr Parteikollege Bernd Baumann rief mit geschwellter Brust vom Rednerpult im Bundestag: "Jetzt und hier beginnt eine neue Epoche und das führen wir an!"
Was stand im Entwurf zum „Zustrombegrenzungsgesetz“?
Kern des Entwurfs für das sogenannten „Zustrombegrenzungsgesetz“ war die Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Das sind Personen, denen in der Heimat Schaden droht, zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen. Nach der aktuellen Regelung dürfen pro Monat bis zu 1.000 Angehörige der Kernfamilie von subsidiär Schutzberechtigten nach Deutschland nachziehen. Die Auswahl unter den Antragstellern erfolgt durch das Bundesverwaltungsamt.
Zudem sollten die Befugnisse der Bundespolizei erweitert werden. Diese sollte für ihren Zuständigkeitsbereich – also etwa in Bahnhöfen – die Befugnis erhalten, selbstständig Maßnahmen zur Abschiebung von Ausreisepflichtigen mit oder ohne Duldung durchführen zu können; zum Beispiel aufgegriffene Ausreisepflichtige zu inhaftieren.
Ausreisepflichtig sind aktuell rund 221.000 Menschen (Stichtag 31.12.2024). Dazu zählen Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, sowie Menschen, deren Visum abgelaufen ist. Rund 81 Prozent der Ausreisepflichtigen haben eine Duldung, das heißt, sie können aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht abgeschoben werden, etwa weil sie krank sind, eine Ausbildung machen oder keine Ausreisedokumente haben. Unmittelbar ausreisepflichtig waren Stand Dezember 2024 rund 42.300 Menschen.
Hitzige Debatte vor der Abstimmung
Die Debatte vor der Abstimmung über den Gesetzentwurf am Freitag (31.01.2025) war geprägt von Zwischenrufen und gegenseitigem Unverständnis. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erklärte, dass SPD und Grüne dem Gesetzesentwurf nicht zustimmen werden. Vor dem Hintergrund der umstrittenen Abstimmung über den Fünf-Punkte-Plan zwei Tage zuvor appellierte er an Merz, das "Tor zur Hölle" nach dem Sündenfall noch gemeinsam zu schließen. „Sie müssen die Brandmauer wieder hochziehen“, forderte er vom CDU-Chef.
Merz wiederum konterte: „Von meiner Partei aus reicht niemand der AfD die Hand.“ Es gäbe keine tieferen Gräben im Bundestag als die zwischen der Union und der AfD-Fraktion. Der Antrag auf Rücküberweisung des Gesetzentwurfs in den Innenausschuss, den SPD und Grünen anboten, wurde mit den Stimmen von CDU/CSU, FDP, BSW und AfD abgelehnt. Schon am Vormittag vor der Debatte war eine Kompromisssuche der Fraktionsspitzen von Union, SPD, Grünen und FDP gescheitert.
In der Abstimmung fiel das "Zustromsbegrenzungsgesetz" dann durch. 338 Abgeordnete stimmten für den Entwurf. 349 Abgeordnete dagegen. Fünf Abgeordnete enthielten sich der Stimme.
Hat sich Merz verzockt?
Ob sich Merz mit seinem selbst innerhalb der eigenen Partei umstrittenen Vorgehen verzockt hat, ist noch nicht absehbar. Klar ist: Dass er sein "Zustrombegrenzungsgesetz" nicht durch den Bundestag bekommen hat, ist eine Niederlage. In den eigenen Reihen fehlten Merz von 196 Abgeordneten 12 Stimmen, am Mittwoch waren es neun. Auch bei der FDP zogen einige nicht mit, am Mittwoch 10 der 90 Abgeordneten, am Freitag mit 23 mehr als doppelt so viele.
Merz selbst sieht sich auf dem richtigen Weg: "Jetzt sind die Positionen für jeden noch mal klar geworden. Grüne und SPD sind nicht bereit, in der Migrationspolitik den Weg mitzugehen, den die Menschen sich wünschen", sagte er im Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Tatsächlich wird die von Merz geforderte ausnahmslose Zurückweisung von Asylsuchenden ohne gültige Einreisedokumente von einer Mehrheit der Befragten (63 Prozent) unterstützt.
Gespalten zeigt sich die Bevölkerung jedoch in der Bewertung der Vorgänge im Bundestag: Dass die Union einen Antrag unter Inkaufnahme von Stimmen der AfD eingebracht hat, finden 47 Prozent im aktuellen ZDF-"Politbarometer" gut, 48 Prozent lehnen das ab. Die nächsten Umfragewerte nach dieser Bundestagswoche werden ein erstes Stimmungsbarometer dafür sein, ob Merz sich verzockt hat oder mit seinem harten Kurs punkten konnte.
Der Kanzlerkandidat der Grünen, Wirtschaftsminister Robert Habeck, sagte bei einer Veranstaltung der "Nordwest-Zeitung" in Oldenburg, er könne sich nicht vorstellen, dass die Ereignisse der vergangenen Woche "ohne Einfluss auf die Wahlentscheidung der Deutschen bleibt". Habeck sprach mit Blick auf Merz von einem "Wortbruch" und einer "Erpressungssituation".
Eines hat Merz mit seinem Vorstoß allerdings erreicht: Ein Thema, das wochenlang den Wahlkampf bestimmte, ist ganz verschwunden: Statt über US-Milliardär Elon Musk und seine Wahlempfehlungen für die AfD sprechen jetzt alle nur noch über den CDU-Kanzlerkandidaten.
Was könnte der neue Merz-Kurs für die Koalitionsfrage nach der Wahl bedeuten?
Beobachter gehen davon aus, dass das Vorgehen von Merz Konsequenzen für die mögliche Koalitionsbildung nach der Bundestagswahl haben könnten. Schwarz-Grün wird dadurch eher noch unwahrscheinlicher.
Ohnehin betont CSU-Chef Markus Söder seit Wochen öffentlich seine Ablehnung einer Zusammenarbeit mit den Grünen – unter anderem auch unter Verweis auf die Asyl- und Migrationspolitik. Eine Koalition mit der AfD schließt die Union weiter aus.
Aber auch die Bildung einer Großen Koalition aus CDU und SPD könnte schwieriger werden. Nach der Abstimmung vom Mittwoch sprachen sich einige SPD-Mitglieder gegen eine mögliche Koalition mit der Union unter Merz aus. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Jan Dieren bezeichnete den CDU-Chef im „Tagesspiegel“ als "unberechenbar".
Wie ist die Merz-Initiative europarechtlich und aus Sicht der Polizei zu bewerten?
EU-rechtlich sind die Pläne der Union höchst umstritten. Eigentlich darf Deutschland Asylsuchende nach den Dublin-Regeln nicht einfach abweisen, sondern muss den Asylantrag prüfen.
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält die Merz-Pläne zudem für nicht durchsetzbar. "Wir haben eine Länge von 3.800 Kilometern Binnengrenzen. Wir sind mit der Art und Weise der Grenzkontrollen, die wir jetzt schon betreiben, am Rande des Machbaren", sagte der GdP-Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei, Andreas Roßkopf, vor der Abstimmung im MDR-Radio.
Für die Pläne von Merz seien "nicht nur Hunderte, sondern Tausende Kollegen mehr" nötig.
Dass Merz alle Flüchtlinge ohne gültige Dokumente zurückzuweisen wolle, sei deshalb "nicht umsetzbar", sagte Roßkopf. Neue Beamtinnen und Beamte müssten auch erst ausgebildet werden, was zwischen zweieinhalb und drei Jahren dauere. Nötig seien aus seiner Sicht auch Investitionen in moderne Hilfsmittel wie Drohnen- und Kennzeichenerfassungstechnik.
tei, rey, ww