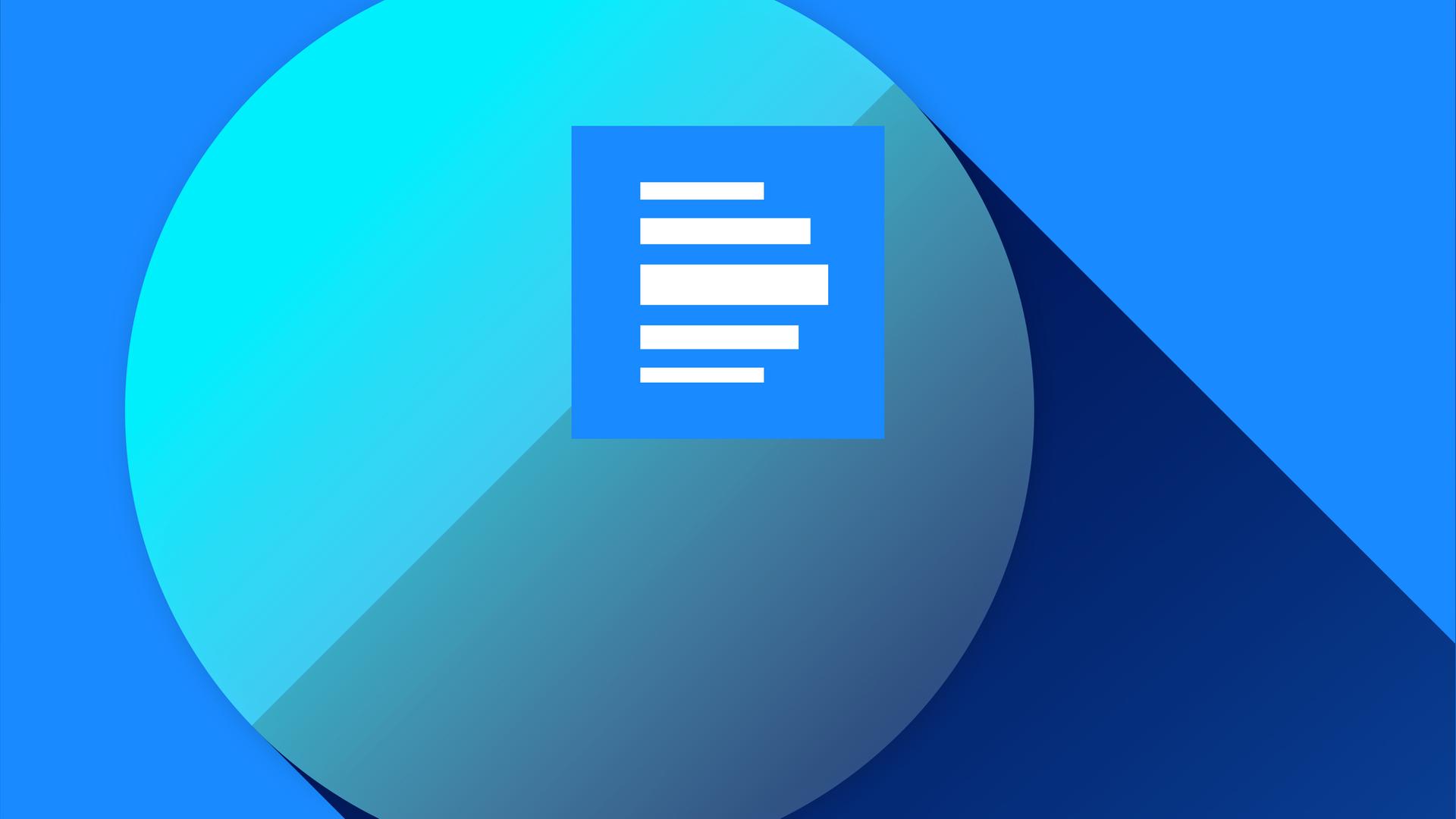Die Stimmung ist aufgeladen an diesem Mittag im Zentrum von Turbo. Auf dem kleinen Kirchplatz vor dem Eingangsportal der Iglesia Nuestra Señora del Carmen drängen sich etwa 50 kubanische Migranten um eine Palme herum.
Sie suchen Schutz vor der Hitze - aber auch vor den knapp 30 Polizeibeamten, die schon seit mehreren Stunden auf der anderen Straßenseite stehen.
Sie wolle lieber sterben beim Versuch, in die USA zu kommen, als in ihr Heimatland zurückzukehren, ruft eine kleine, dünne Frau mit Tuch über den kurzen braunen Haaren den Polizisten energisch entgegen. Sie werde auf keinen Fall wieder nach Kuba gehen.
Angst machen den Kubanern vor allem die zwei Lastwagen, mit denen die Beamten angerückt sind. Die Ladefläche ist mit grüner Plane abgedeckt. Die wollen uns deportieren, hört man aus der Gruppe der Migranten immer wieder. Sie locken uns in eine Falle, sagen, sie fahren uns zum Flughafen - und dann geht der Flieger in Wirklichkeit zurück nach Kuba - das glauben viele, die hier versammelt sind.
Die Situation wird jetzt wirklich kritisch, die Polizei bedroht uns, sagt Ignacio - ein Mann Ende 50 mit Schnauzbart, Brille und Hut. Zwei Mitglieder der Gruppe haben sie mitgenommen, wir wissen nicht, wohin. Wir haben keinen Anwalt, wir haben niemanden, der uns verteidigt, erzählt er weiter.
Im kolumbianischen Turbo
Nicht nur für die Kubaner wird das kolumbianische Turbo in diesen Tagen zum sprichwörtlichen Flaschenhals auf dem Weg in die USA. Auch Migranten aus Haiti, dem Senegal, dem Kongo und aus Ghana treffen hier ein - ebenso wie Migranten aus Nepal, Bangladesh oder Pakistan. Hinter ihnen liegen Odyssen im Flugzeug, per Schiff im Bus oder zu Fuß.
Die Frage ist: Wird für sie die stickige 170.000 Einwohner-Stadt an der Karibikküste mit den lauten und abgasgeschwängerten Straßen zur Durchgangsstation - oder zur Endstation? Denn Anfang Mai hat Panama die Grenze zu Kolumbien geschlossen.
"Everybody here need to fly to Panama. Because Panama helps everybody", sagt der 27-Jährige Justin aus Haiti, der mit einer Gruppe Landsleute vor dem Gebäude der örtlichen Migrationsbehörde ausharrt. Nach Panama fliegen, das ist die Idee. Doch dafür braucht es die nötigen Papiere - die viele der irregulären Migranten nicht haben.
Grenzen geschlossen
Panamas Grenzschließung ist die vorerst letzte Etappe einer Kettenreaktion. Auch Costa Rica und Nicaragua hatten in den letzten Monaten ihren Grenzen geschlossen - wegen der sogenannten illegalen Migranten.
Besonders stark angestiegen ist die Zahl Kubaner, die in die USA wollen. Was zunächst paradox klingen mag angesichts der Annäherung zwischen Washington und Havanna. Doch viele Kubaner glauben, dass die USA ihre seit rund 60 Jahren so großzügigen Einreisebedingungen für Bewohner des Inselstaats bald beenden werden - und wollen schnell davor noch in die USA.
Auch die krebskranke Mayi hat sich auf den Weg gemacht- jene Frau, die vorhin noch auf dem Kirchplatz den Polizisten ihre Wut entgegengebrüllt hatte. Sie wünscht sich vor allem eines:
"Ein freies Land, in dem man sagen kann was man will, ein demokratisches Land. Wo Meinungs- und Redefreiheit herrscht. Solange es mit dem Castro-Regime nicht vorbei ist, werden wir nicht zurückgehen."
Über den Landweg in die USA
Weil es immer noch keine direkten Flug- oder Fährverbindungen von Kuba in die USA gibt, müssen die Migranten einen langen Umweg zurücklegen. Viele fliegen nach Ecuador oder nach Guyana und versuchen sich dann, auf dem Landweg über Kolumbien und Mittelamerika in die USA durchzuschlagen - oft begeben sie sich dabei in die Hände von Schleppern, werden unterwegs ausgeraubt oder müssen Grenz- und Polizeibeamte schmieren.
Bereits zweimal sind in den letzten Monaten mehrere tausend Kubaner in Zentralamerika gestrandet, als Costa Rica und Nicaragua ihre Grenzen dicht gemacht hatten. In beiden Fällen wurden sie nach längerem Ausharren ausgeflogen in Richtung Norden, zum Teil bis nach Mexiko, um ihre Reise in die USA fortsetzen zu können. Auf eine derartige Lösung hoffen die Kubaner in Turbo nun wieder. Ob sie kommt, ist fraglich.
Während die Kubaner in Turbo bleiben, zieht es viele Migranten aus Haiti, Afrika und Asien weiter in den Norden Kolumbiens: in den idyllischen Touristenort Capurganá. Von hier sind es nur noch ein paar Kilometer nach Panama – am einfachsten zu erreichen über den Seeweg.
Umweg durch den Urwald
Doch der kommt für die irregulären Migranten nicht in Frage. Stattdessen begeben sich viele ab Capurganá in die Hände von Schleppern - den coyotes - und damit auf einen Umweg durch den Urwald, der mehrere Tage und Nächte dauert - und lebensgefährlich ist, wie eine Anwohnerin erzählt.
"Manche verlaufen sich in den Bergen und kommen nicht wieder raus. Andere nehmen den falschen Weg und kommen in anderen Dörfern raus. Es wurden Leute krank. Viele schaffen es nach Panama. Andere haben dieses Glück nicht. Vor Kurzem ist hier eine sehr elegante Frau gestorben. Sie starb hier in der Nähe des Dorfes an einem Herzinfarkt."
Wo genau der Weg in den Urwald beginnt, weiß sie nicht – irgendwo dahinten am Ende des Weges muss es sein, sagt die Mutter dreier Kinder. Für Touristen mag Capurganá wie ein Paradies erscheinen. Für viele Migranten ist es dagegen der Startpunkt zu einer gefährlichen Reise bei der sie vor allem eine Hoffnung haben: lebendig herauskommen. Und irgendwann die USA erreichen.