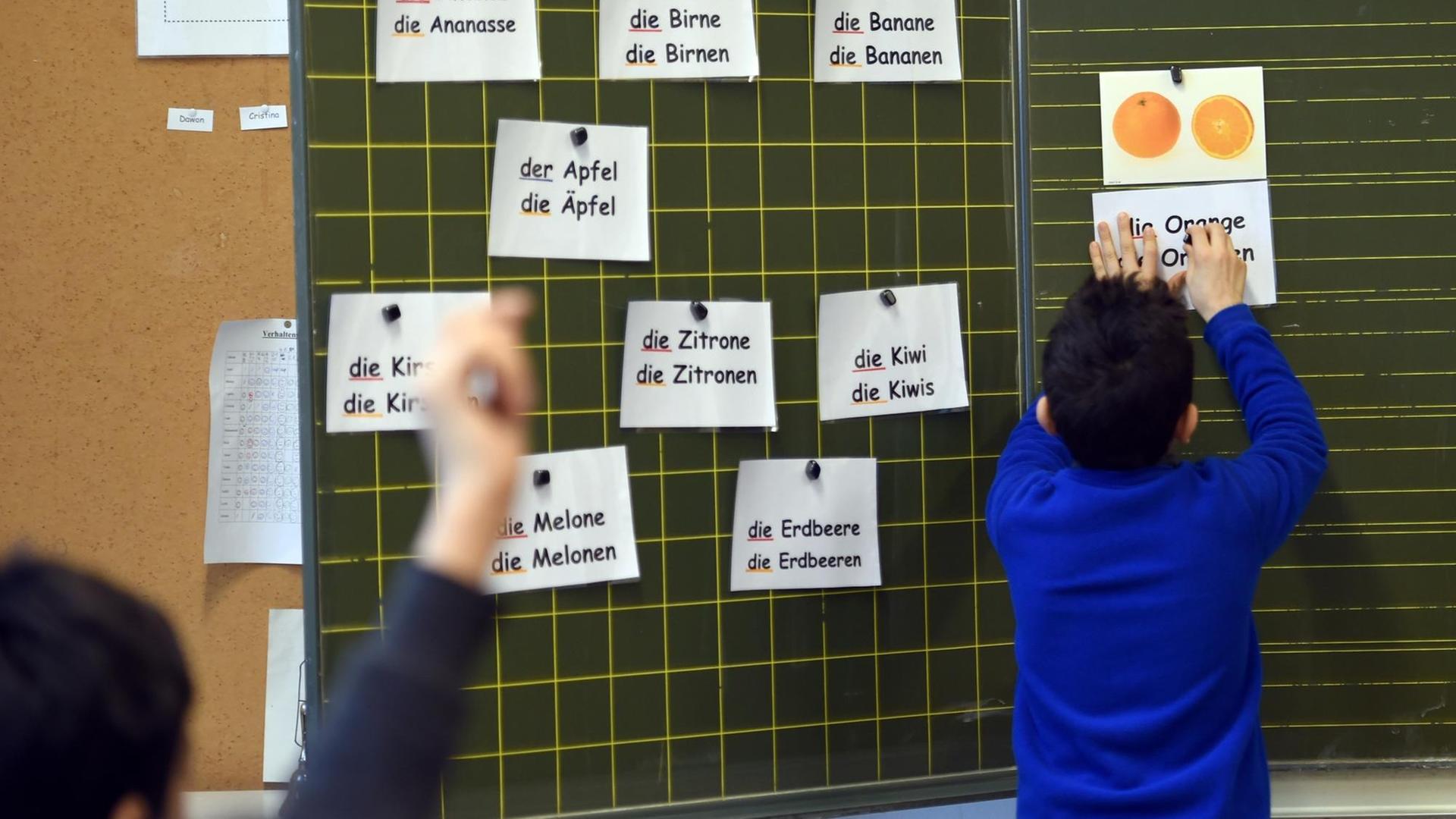Mit welchen Erfahrungen und Erwartungen leben beide Gruppen jetzt in den Wohngemeinschaften, in Hotels und Gemeinschaftsunterkünften? Die jungen Menschen brauchen einen möglichst normalen Alltag, so die Erkenntnis von Wissenschaftlern der Berliner Charité und des Deutschen Instituts für Urbanistik.
Das Manuskript in voller Länge:
"Wir leben alle in einer Welt. In einer Welt voller Zuneigung und Schönheit. Aber jetzt ist der Krieg in mein Leben eingezogen. Alle meine Träume sind zerstört worden. Wir mussten unsere Häuser verlassen, unsere Freunde, unsere Schulen."
Yuriy Zubenko ist 2014 aus der Ukraine geflohen. In einem Workshop des UN-Kinderhilfswerks Unicef hat er gemeinsam mit anderen Flüchtlingskindern einminütige Filme gedreht, kurze Selbstporträts.
"Ich will nie wieder dahin zurück. Der Krieg hat mir alles genommen."
So wie Yuriy Zubenko geht es auch anderen geflüchteten Kindern und Jugendlichen. In den vergangenen Monaten haben immer mehr von ihnen die Erste Hilfe an der Berliner Charité aufgesucht. Nicht nur die Flucht selbst, sondern auch die Zeit danach belastet sie stark.
"Am Anfang ist noch Überleben, dann wartet man erst mal: Was kommt auf uns zu? Wie kommen wir hier zurecht? Und je länger die Zeit aber dauert, wo nichts passiert, wo alles unklar ist, desto eher zeigen sich ja die Symptome auch."
Sibylle Winter leitet die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Charité. Zehn bis 20 Prozent der jungen Geflüchteten entwickeln eine posttraumatische Belastungsstörung, schätzt die Ärztin.
"Die geflüchteten Kinder und Jugendliche, die zu uns in die Erste Hilfe kommen, das sind schon meistens sehr akute Krisen im Sinne von eigen gefährdendem Verhalten, also Selbstverletzung oder Suizidversuche oder eben auch fremd aggressives Verhalten. Die, die in die Clearingstelle kommen, wir haben ja eine Clearingstelle für die Geflüchteten eingerichtet, da sind es sehr unterschiedliche Probleme. Das kann relativ harmlos sein, dass ein Kind einnässt, weil die Toilette weit draußen ist, bis hin dann schon auch zu Kindern und Jugendlichen, die Traumata erlebt haben und da schwerwiegende posttraumatische Belastungssymptome zeigen.
Schätzungsweise rund 70.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, im Fachjargon sogenannte UmF, leben derzeit in Deutschland. Etwa 90 Prozent von ihnen sind männlich, zwei Drittel zwischen 16 und 18 Jahre alt. Die meisten kommen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan, aus Somalia und Eritrea.
Das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz hat über die Versorgung dieser heterogenen Gruppe kürzlich eine Studie heraus gegeben und dafür sowohl junge Flüchtlinge als auch Mitarbeiter in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe befragt. Projektleiter Heinz Müller:
"Wenn man genauer danach fragt, welches Bildungsniveau, welche soziale Herkunft haben sie, dann finden wir alle Merkmale, die man weltweit bei Sozialstrukturuntersuchungen auch finden würde: gut Gebildete, die auch die Möglichkeit hatten, auf die Flucht zu gehen. Aber es gibt auch junge Menschen, die aus sehr ländlichen Gebieten Afghanistans kommen, über wenig Bildung oder gar keine Schulbildung verfügen, aber trotzdem den Weg nach Europa geschafft haben und hier dann Asyl beantragen."
Krieg und Verfolgung, Ausbeutung, Armut, die Angst vor Zwangsrekrutierung oder Beschneidung haben sie in die Flucht geschlagen. Nach Europa kommen sie teilweise alleine, oft aber auch im Verbund mit Gleichaltrigen aus dem Dorf, dem Stadtteil oder der Region.
Das Ziel ist in Sicherheit leben
Manche haben ihre Eltern verloren oder wurden im Chaos der Flucht von ihnen getrennt. Die meisten aber haben sich, von der Familie damit beauftragt, auf den Weg nach Europa gemacht. Sie sollen hier die Sprache lernen, sich ausbilden und einen Beruf ergreifen, kurz: Eine neue Lebensperspektive entwickeln, erzählt Heinz Müller. Hinter der Hoffnung, dass die Kinder Geld schicken und die Eltern nachkommen können, steckt das eigentliche Ziel: in Sicherheit leben.
"Sie werden oft von ihren Eltern im Verbund mit anderen losgeschickt, weil die Eltern keine Möglichkeiten haben, ihnen Schutz und Sicherheit an ihrem Lebensort zu gewähren. Also die Angst davor, zum Militär zu müssen, ermordet zu werden, verfolgt oder mit Gewalt bedroht zu werden. Das zwingt die Eltern, diese jungen Menschen alleine auf die Flucht zu schicken. Das sagen die jungen Menschen, auch wenn man sie danach fragt: Das machen die Eltern schweren Herzens."
An deutschen Grenzen, in Zügen, Häfen oder Flughäfen, greift die Polizei die jungen Flüchtlinge auf und bringt sie zu den Jugendämtern. Für die Minderjährigen suchen diese einen Vormund und eine geeignete Unterkunft – je nach Alter, Hilfebedarf und Grad der Selbständigkeit eine mehr oder weniger betreute Wohngruppe oder eine Einrichtung der Heimerziehung. Sibylle Winter:
"Die unbegleiteten Flüchtlinge haben ja hier eine relativ gute Versorgung über Vormund, Sozialarbeit, auch ehrenamtliche Vormünder und haben auch bessere Wohnverhältnisse, möchte ich sagen. Auf der anderen Seite werden sie ständig mit Nachrichten auch aus der Heimat konfrontiert, wo es vielleicht jemandem schlecht geht oder jemand ums Leben gekommen ist oder wo der Kontakt abgebrochen ist, was eine Riesenbelastung ist. Und natürlich haben sie auch einen Auftrag, irgendwas hier zu schaffen."
Bisher mussten die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen im vergangenen Jahr hauptsächlich die Grundversorgung leisten.
"Im letzten Jahr waren wir überwiegend damit beschäftigt: essen, trinken, Dach überm Kopf. Das muss man klar so sagen. Zumindest für die Unbegleiteten, die wir als Jugendamt unterbringen müssen. Und es war wenig Spielraum, um auch unseren Ansprüchen der Jugendhilfe gerecht zu werden. Und jetzt fangen wir an, in einer Phase, in der es etwas ruhiger geworden ist, wieder mehr auf Qualität zu gucken. Also wirklich zu schauen, was brauchen die Jugendlichen?
So die Kölner Jugendamtsleiterin Carolin Krause auf der Tagung des Deutschen Instituts für Urbanistik über Hilfen für Flüchtlingsfamilien.
Hinzu kommen besondere Fälle: Soll beispielsweise ein 19-Jähriger, der mit seiner zwölf Jahre alten Schwester in einer Dortmunder Gemeinschaftsunterkunft lebt, für sie die Vormundschaft übernehmen? Und was passiert mit den vielen Jugendlichen, die bald nach ihrer Ankunft in Deutschland volljährig werden? Die gesetzliche Regelung, jungen Volljährigen zwischen dem 18. und 21. Lebensjahr weiterhin sozialpädagogische Betreuung und eine altersgerechte Unterbringung zu gewähren, setzen viele Kommune nicht um. Eine rechtswidrige Praxis, kritisiert Andreas Dexheimer vom Diakonischen Werk Rosenheim.
"Der Staat, die Kommune investiert erheblich in die Inobhutnahme eines minderjährigen unbegleiteten Flüchtlings. Er wird dann in einer Heimeinrichtung untergebracht, dort betreut. Und mit dem 18. Lebensjahr wird die Hilfe eingestellt. Mit dem 18. Lebensjahr zieht der junge Mensch aus der Heimerziehung in die Gemeinschaftsunterkunft für Erwachsene und bekommt keine weitergehende Hilfe. Und es passiert gleichzeitig, dass junge Volljährige hier ankommen, die überhaupt keine weitergehende Unterstützung kriegen, die behandelt werden wie jeder 30-, 35- oder 40-Jährige."
Andere Bedingungen für begleitete Kinder und Jugendliche
Weit weniger als über die unbegleiteten jungen Flüchtlinge wissen die Experten bislang über die vielen Kinder und Jugendlichen, die mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen sind. Mehr als eine halbe Million waren es im Jahr 2015, schätzt Unicef. Sie hatten ganz andere Startbedingungen, sagt Sebastian Sedlmayr aus Köln. Der Leiter der Abteilung Kinderrechte und Bildung bei Unicef Deutschland verweist auf den sogenannten Königsteiner Schlüssel, nach dem die Familien verteilt werden:
"Es macht eben einen großen Unterschied für die Familien und entsprechend auch für die Kinder und Jugendlichen aus, wo in Deutschland sie landen. Ob sie an einem Ort ankommen, an dem es eine wunderbare Infrastruktur gibt, vielleicht ist die Unterkunft auch urban gelegen, alles ist fußläufig zu erreichen, es gibt Ehrenamtliche und ein Netzwerk um die Unterkunft herum, die sich kümmert und ausreichend Personal. Es kann aber auch sein, dass das alles nicht vorhanden ist."
"Als wir hier angekommen sind, hieß es, wir müssen hier eine Woche leben. Jetzt sind es schon fünf Monate – und es passiert nichts", wird ein junger Afghane in einer Studie zitiert.
Er lebt mit 100 anderen Flüchtlingen in einer Turnhalle, besucht weder eine Schule noch einen Deutschkurs. Er sorgt sich um seine kranke Mutter und kümmert sich um den jüngeren Bruder.
Nach der Flucht tauschen Kinder und Eltern oft die Rollen, beobachtet Sebastian Sedlmayr:
"Die Eltern fallen häufig als Erziehungsperson aus, entweder weil sie Traumatisierungen mit sich tragen oder aber – was ja in den meisten Fällen so ist – weil sie die Sprache, also deutsch, nicht beherrschen und weil sie keine Mittel haben, um für ihre Kinder in der Situation zu sorgen. Insofern beobachten wir, dass viele Kinder, die dann schnell deutsch lernen, als Übersetzer sogar auf Ämtern, aber auch innerhalb der Familie eingesetzt werden. Dass sie da über die Flucht, über die Fluchtgründe, über das Asylverfahren, über die derzeitige Situation viel hören, was eigentlich für Kinderohren nicht bestimmt ist."
Die Eltern überlassen die Kinder häufig sich selbst, beobachtet auch Ilda Kolenda. Sie leitet zwei Gemeinschaftsunterkünfte der Diakonie in Dortmund, eine davon mit mehr als 140 Plätzen in einer ehemaligen Polizeiwache.
"Sie müssen weite Wege gehen zu Spielplätzen. Und das fehlt ihnen, dass die Eltern das mit ihnen machen. Die Eltern haben ganz andere Sorgen, dieses In-den-Alltag-hinein, den Alltag überstehen. Und das merken die Kinder, dass sich vieles verändert hat, dass die Eltern nicht mehr da sind, das, was sie vorher mit ihnen gemacht haben, Spielplätze besuchen."
Noch gelten für die improvisierten Gemeinschaftsunterkünfte in Turnhallen, Schulen, Büro- und Gewerbegebäuden keine einheitlichen Standards. Kinder und Frauen haben zumeist keinen eigenen Bereich, die Duschräume lassen sich nicht abschließen, eine Beschwerdestelle fehlt. Wie häufig häusliche und sexuelle Gewalt vorkommen, können die Experten nicht beziffern.
Postmigrationsstress und posttraumatische Belastungsstörung
An die sogenannten begleiteten Kinder und Jugendlichen, die psychologische Hilfe brauchen, sei man bisher noch gar nicht richtig heran gekommen, erzählt Sibylle Winter von der Charité.
"Das geht jetzt erstmal ganz langsam. Und die haben die Schwierigkeit, dass die Familie insgesamt, dass es insgesamt nicht so gut geht und diese auch häufig in sehr großen Unterkünften sind im Sinne von vielen Menschen auf engem Raum und das eben sehr wenig familiengerecht ist und da keine Rückzugsorte und ungewisse Zukunft, was wir als Postmigrationsstress bezeichnen und was dann eben die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, auch deutlich erhöht – unabhängig davon, wie schwerwiegend das Trauma war."
Das Deutsche Jugendinstitut in München will mehr über die jungen Flüchtlinge erfahren. In einer Studie befragen die Wissenschaftler 100 Jugendliche, die allein oder mit Familie sowie anderen Bezugspersonen nach Deutschland gekommen sind.
Ziel ist es, herauszufinden, was ihre subjektiven Erfahrungen sind, wie sie ihre Ankunft in Deutschland erleben: in der Erstaufnahmeeinrichtung oder in der Clearingstelle des Jugendamtes, später in einer Gemeinschafts- oder Jugendhilfeeinrichtung. Die Soziologin Claudia Lechner möchte heraus finden.
"Wie geht es ihnen gesundheitlich? Vor allem auch das Leben in der Einrichtung: Wie sieht ihr aktueller Alltag aus? Was sind da Probleme? Wie ist die Freizeit gestaltet, und wie wichtig sind ihnen die sozialen Netzwerke und mit wem haben sie Kontakt? Es geht um die Erwartungen, die Wünsche, um die unmittelbaren Bedarfe der Jugendlichen."
Eine 16-jährige Syrerin etwa hat mit ihren Eltern und vier Geschwistern bald nach ihrer Ankunft gemeinsam mit anderen syrischen Familien eine Wohnung bezogen. Sie besucht die Übergangsklasse einer Berufsschule und trifft andere Jugendliche – vor allem aus Syrien. Der Kontakt zu gleichaltrigen Deutschen fehlt ihr.
"Sie beschreibt es so, dass sie das Gefühl hat, die deutschen Jugendlichen wollen mit ihnen keinen Kontakt haben, weil sie Flüchtlinge sind. Es sind natürlich sprachliche Hürden noch zu nehmen. Ich würde jetzt einfach beschreiben, dass es keine Räume gibt, oder zu wenig Räume, wo sich deutsche Jugendliche mit geflüchteten Jugendlichen treffen."
Die ersten Interviews mit den jungen Flüchtlingen zeigen, dass sie sich um ihre im Herkunftsland verbliebene Familie sorgen. Sie wünschen sich eine Bezugsperson, aber auch bessere Informationen etwa über das Asylverfahren. Schule und Ausbildung stehen für sie im Vordergrund. Claudia Lechner:
"Was auffällig ist, ist, dass die Jugendlichen uns schildern, dass kein Ankommen möglich ist, weil keine Beständigkeit gegeben ist. Sie haben wechselnde Betreuer und Lehrer, auch der Wechsel von Unterkünften führt dazu, dass kein Ankommen möglich ist."
Fehlen von Beständigkeit und die Wichtigkeit von Alltag
Über ihre Fluchtgründe reden die Kinder sehr selten, sagt Ilda Kolenda von der Diakonie in Dortmund.
"Wir sprechen sie auch absichtlich nicht an. Es gibt selten Momente, dass Kinder über das Erlebte mit uns sprechen wollen, auch wenn großes Vertrauen da ist. Sie versuchen, das zu vergessen, das ist unsere Wahrnehmung. Sie wollen nach vorne, sie gucken ganz weit nach vorne: Wo wollen sie hin? Was wollen sie werden?"
wurwerden. Also so richtig von Beruf Polizist. Ich komme aus einer guten Familie und ich gehe zur Schule. Mir geht es gut hier und ich habe viele Freunde. Ich glaube ich werde ein guter Polizist."
Für die jungen Flüchtlinge, darin sind sich die Experten einig, steht an oberster Stelle der Wunsch, sich wieder sicher zu fühlen. Dafür brauchen sie Klarheit darüber, dass sie in Deutschland bleiben, zur Schule gehen und arbeiten können.
Auch eine Therapie, begleitet durch einen geschulten Dolmetscher, macht erst Sinn, wenn der Alltag geregelt ist, sagt Sibylle Winter:
"Der allerwichtigste Punkt ist immer Alltag, Schulalltag, Kitaalltag und dann natürlich adäquate Angebote auch und Rückzugsräume – eben nicht in diesen Riesenunterkünften, sondern in einer Wohnung optimalerweise. Möglichst normaler Alltag. Weil erst dann können wir sehen, wie stabilisieren sich die Kinder und Jugendlichen und welche brauchen dann auch wirklich noch spezifische Psychotherapie oder womöglich eben auch spezifische Trauma-Psychotherapie. Wenn man das schafft, bilden sich auch sehr viele Symptome zurück – und umgekehrt: Wenn man das nicht schafft, dann verstärken sich die Symptome."