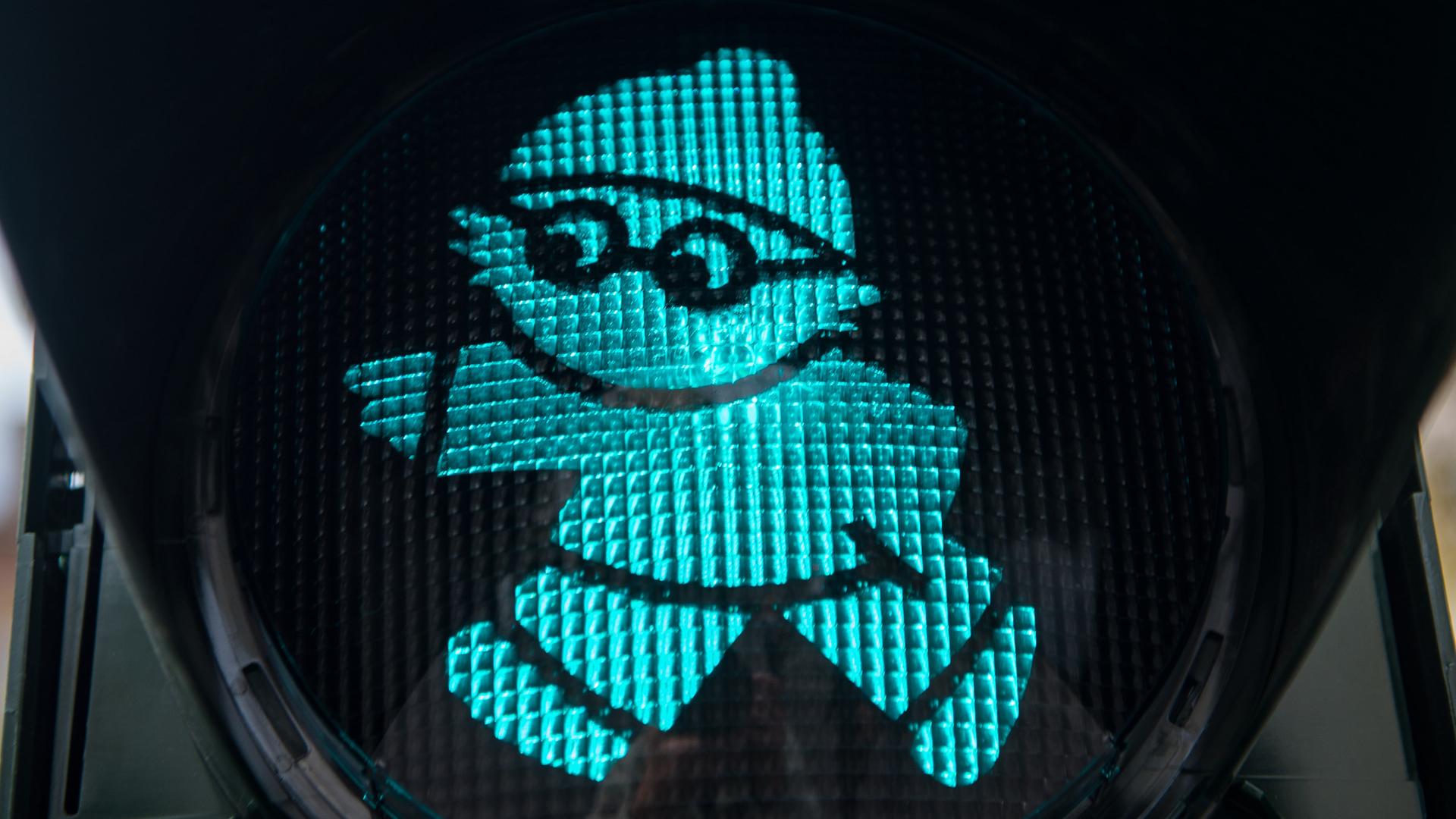Wer Geert Kloppenburg in Zandvoort besucht und mit ihm über Mobilität sprechen will - über Autos, Fahrräder, Züge - der muss ihn nicht lange bitten. Der Niederländer ist sofort leidenschaftlich bei der Sache. Kloppenburg berät Firmen, hält Vorträge und betreibt einen Podcast zum Thema.
Darin spricht er mit Experten weltweit über Verkehrslösungen, die das Leben in den Städten verbessern sollen. Helsinki, Berlin, Los Angeles - Kloppenburg interviewt Stadtplaner, Politiker und Wissenschaftler und sucht nach Ideen. Der Niederländer hat einen guten Überblick, wie Städte weltweit ihren Verkehr organisieren. Woran aber denken seine Gesprächspartner, wenn sie an die Niederlande denken?
„Das erste, woran sie denken, ist das Fahrrad. Steig auf dein Rad Hollie, steig auf dein Rad,“ sagt Kloppenburg. Ein Klischee, das nur halb stimme. Denn es sei nicht so, dass die Niederländer kein Auto fahren würden. Er erklärt: „Wenn man sich die Zahl der Autobahnen zwischen Den Haag und Rotterdam anschaut, wird klar, dass wir Niederländer längst nicht alles mit dem Rad machen. Es gibt auch hier riesige Staus. Wir haben rund 7,5 Millionen Autos allein in der Randstad, in der Region Amsterdam, Rotterdam, Den Haag - und 14 Millionen Parkplätze. Es ist also ein Märchen, das wir alles per Rad erledigen.“
Und doch sind die Niederlande eine Nation der Radfahrer. Vor allem die kurzen Wege - zur Schule, zum Sport, zum Einkaufen - werden mit dem Rad zurückgelegt. Die roten Radwege – oft räumlich getrennt von den Straßen - sind allgegenwärtig. Doch das sei früher anders gewesen.
„Platz für das Auto“
„Manche Leute glauben, das ist seit hunderten von Jahren so. Aber das ist der größte Unsinn! Es brauchte fast Straßenkämpfe in Amsterdam in den 70ern und 80ern, um das System zu ändern“, so Kloppenburg.
Doch wie und warum konnten sich die Niederlande zu einem Paradies für Radfahrerinnen und Radfahrer entwickeln? Eine US-Amerikanerin kann darüber Auskunft geben. Meredith Glaser leitet das Urban Cycling Institute an der Universität von Amsterdam: „In den 50ern und 60ern machten die Stadtplaner damals Platz für das Auto. Es war die Technologie der Zukunft. Die Vision war eine Mobilität, die auf dem Auto aufbaute.“
Aber bald gab es immer mehr Negativ-Schlagzeilen: schlechte Luft, verstopfte Straßen, Unfälle. „Die Zahl der Verkehrstoten stieg, unter den Toten waren auch viele Kinder. Das war ein wichtiger Faktor“, sagt Glaser: „Kinder waren es gewohnt, auf der Straße zu spielen. Aber mit den Autos wurde das immer gefährlicher. Dazu kamen Umweltbewegungen und andere Proteste. Und ein Öl-Embargo, das die Benzin-Preise nach oben trieb. All das passierte in den 70ern.“
Bürgerinnen und Bürger fanden Gehör. Es sollte aber noch einige Jahre dauern, bis Politik und Stadtplanung in den Niederlanden wirklich reagierten. Erst in den 80er- und 90er-Jahren wurde in eine neue Infrastruktur, ein Radwege-Netz, investiert. Und auch neue rechtliche Grundlagen wurden geschaffen.
„Man orientierte sich an drei grundlegenden Prinzipien: 1. Menschen machen Fehler. 2. Die Regierung ist für die Sicherheit der Menschen zuständig. Und 3.: Die Gestaltung der Straße sollte fehlerhaftes Verhalten von Menschen einkalkulieren und den daraus entstehenden Schaden so geringhalten wie möglich,“ so Glaser.
Diesen Leitgedanken folgend organisierten die Niederländer die Straßen in ihren Städten neu. Fußgänger und Radfahrer erhielten mehr Platz. Auf Straßen mit viel Verkehr wurden die verletzbaren Verkehrsteilnehmer räumlich von den Autos getrennt - ein Meilenstein in der niederländischen Radfahr-Geschichte. Und bei Unfällen mit Radfahrern waren ab sofort prinzipiell die Autofahrer Schuld.
„Als diese Neugestaltung des öffentlichen Raums abgeschlossen war, fuhren bald wieder mehr Menschen Rad als Auto. Und auch die Zahl der Toten und Verletzten sank drastisch.“
Der Siegeszug des Fahrrads in Städten wie Amsterdam habe aber noch einen weiteren Grund, sagt Meredith Glaser: „The urban design and land use encourages short trips.“ Die Distanzen seien kurz.
Helmpflicht lässt Fahrradnutzung zurückgehen
„Die meisten Wege sind einen Kilometer oder weniger lang. Stadtplanung und Flächennutzung spielen also eine große Rolle. Unsere Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Ärzte, Kinderbetreuung – all diese alltäglichen Einrichtungen sind mit dem Fahrrad leicht zu erreichen.“
Die Menschen fühlen sich dabei so sicher, dass kaum jemand Helm trägt – mit Ausnahme von Rennradfahrern. Wer es doch tut, outet sich schnell als Zugezogener.
„Die Forschung zeigt: Wenn es Gesetze gibt, die das Tragen von Helmen vorschreiben, dann geht die Fahrradnutzung zurück. Das hat sich auch in Kopenhagen gezeigt. Dort hat die Regierung eine gewisse Zeit lang für das Tragen von Helmen geworben. Und in diesem Zeitraum wurde weniger Fahrrad gefahren. Es gibt da einen psychologischen Effekt: Wenn man das Tragen eines Helms fördert, dann lässt das den Einzelnen denken, dass das eine gefährliche Aktivität ist.“
Eine Helmpflicht würde also nicht nur die Verantwortung für die eigene Sicherheit auf das Individuum abwälzen - statt Politiker, Autofahrer und Stadtplaner in die Pflicht zu nehmen … Eine Helmpflicht würde auch dazu führen, dass weniger Radfahrer auf den Straßen unterwegs wären. Und das wiederum habe dann tatsächlich Einfluss auf die Sicherheit der Radlerinnen und Radler, sagt die Forscherin.
„Es gibt sehr gute Untersuchungen, die zeigen: Je mehr Menschen Radfahren, umso sicherer ist es. Und das ist in den Niederlanden definitiv der Fall. Hier fahren viele alleine Fahrrad. Aber auch Familien, manchmal zwei, drei, vier Personen, fahren zusammen. Und wenn mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind, hat das auch größere Auswirkungen auf die Sicherheit. Dazu kommen Verkehrserziehung und Fahrradfahren von klein auf. Wir haben es hier also mit Menschen zu tun, die alle Experten sind und wissen, wie sie sich im städtischen Radverkehr bewegen.“
Mittlerweile gibt die Fahrradnation ihr Wissen auch weiter. Städte wie das spanische Sevilla haben mit niederländischer Hilfe ein Radwegenetz aufgebaut. Danach sei der Anteil der Radfahrerinnen und Radfahrer von fast null auf 10 Prozent der Verkehrsteilnehmer gestiegen, so Glaser. Und selbst die Fahrradstadt Kopenhagen könne noch von Amsterdam lernen. „Kopenhagen lässt sich von Amsterdam beraten – was Parkplätze für Fahrräder angeht. Amsterdam hat viel Geld und Personal investiert, um die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Stadtzentrum und an Verkehrsknotenpunkten zu verbessern. An Bahnhöfen zum Beispiel. Da gibt es diese riesigen Fahrradparkhäuser, die fünf-, zehn-, zwanzigtausend Fahrräder aufnehmen können. Die sind auf dem neuesten Stand der Technik, wunderschön gestaltet. Und sie sind mit dem Pass für den öffentlichen Nahverkehr nutzbar.“
Bei 17 Millionen Einwohnern gibt es heute rund 23 Millionen Fahrräder in den Niederlanden und über 3100 Radläden. Allein Amsterdam hat fast 770 Kilometer Radwege. Finanziert wurde das Anlegen des neuen Radwegenetzes unter anderem durch Parkgebühren.
Bis heute ist es teuer, in Amsterdam sein Auto abzustellen. In der Innenstadt kostet eine Stunde bis zu 7,50 Euro. Einnahmen, die weiter gebraucht würden, denn: „Eine fahrradfreundliche Stadt ist nie fertig. Die Niederlande wollen den Anteil der Radfahrer weiter erhöhen. Und die traditionellen Radwege sind heute in vielen Städten nicht mehr breit genug. Sie bieten nicht mehr genug Platz für die vielen Radfahrer in den Straßen der Niederlande.“
E-Bikes für Berufspendler
Das liegt auch daran, dass sich die herkömmlichen Radlerinnen und Radler die Wege mittlerweile mit einem neuen, schnelleren Konkurrenten teilen müssen: dem E-Bike.
„Wir haben gesehen, wie die Zahl der E-Bikes in den vergangenen Jahren explodiert ist“, sagt Mathijs de Haas. Der Verkehrswissenschaftler von der Universität Delft hat eine Studie zur E-Bike-Nutzung durchgeführt. Sie zeigte unter anderem, dass E-Bikes nicht nur unter älteren Menschen, sondern auch unter jüngeren Niederländern immer beliebter werden. Sie fahren damit zum Beispiel zur Schule oder zur Universität. Außerdem untersuchte De Haas, ob E-Bikes, wie von der Politik gewünscht, das Auto ersetzen.
„Unsere Forschung zeigt, dass nur Berufspendler das E-Bike als Auto-Ersatz nutzen. Die Mehrzahl der E-Bike-Nutzer ersetzt damit das herkömmliche Rad. Das ist ein wichtiger Hinweis für politische Entscheidungsträger: E-Bikes zu bewerben, führt nicht automatisch zu einer geringeren Autonutzung.“
Das E-Bike verdrängt derzeit also vor allem das umweltfreundliche, mit Muskelkraft betriebene Fahrrad. Das überraschte selbst den Verkehrswissenschaftler: „In den Niederlanden gibt es so viele Kurzfahrten mit dem Auto. Die könnte man mit dem E-Bike erledigen. Das erwartete ich eigentlich. Schließlich ist die E-Bike-Nutzung schon recht hoch in den Niederlanden.“
So hoch, dass sie sich auch in den Unfallstatistiken des Landes niederschlägt. Von den 207 Radlern, die 2021 bei Verkehrsunfällen in den Niederlanden ums Leben kamen, waren überproportional viele mit einem E-Bike unterwegs.
„Über die Sicherheit von E-Bikes ist noch wenig bekannt. Aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie die Zahl der tödlichen Fahrradunfälle in den Niederlanden gestiegen ist.“
Dennoch ist de Haas zuversichtlich. Denn die Gruppe der Berufspendler, die das Auto für das E-Bike stehen lässt, wird größer. Doch nicht nur Fahrräder werden in den Niederlanden zunehmend mit Strom betrieben. Wer hier unterwegs ist, dem fallen auch die vielen Elektro-Autos auf den Straßen auf. Noch liegt deren Anteil im einstelligen Prozentbereich. Doch er nimmt jedes Jahr zu. Damit werden die Niederlande auch in diesem Sektor immer mehr zum Vorreiter: „Ich denke Norwegen und die Niederlande führen weltweit das Feld an, wenn wir uns die Zahl der Elektro-Autos anschauen.“
Renee Heller ist Professorin für Energie und Innovation an der Fachhochschule Amsterdam. Sie zeigt auf eine Straßenecke vor der Hochschule. Dort steht, was erklärt, warum Elektroautos in den Niederlanden so verbreitet sind.
„Wir stehen hier neben einer Ladestation. Da können zwei E-Autos angeschlossen werden. In den Niederlanden müssen 60 Prozent der Leute ihre Autos im öffentlichen Raum parken. In großen Städten sind es eher 90 Prozent. Deswegen hat die Stadtverwaltung in diese öffentliche Infrastruktur, in Ladestationen, investiert. Das war wichtig für die Verbreitung von E-Autos. Die Leute konnten so sicher sein: Wenn sie nach Hause kommen, können sie ihr Auto laden.“
Steuervergünstigung für elektrische Firmenwagen
Es gibt Apps und Karten im Internet, die zeigen, wo sich die 90.000 Ladestationen im Land befinden. Das flächenmäßig weitaus größere Deutschland kommt bisher nur auf 60.000 Ladestationen. Wer dagegen in Amsterdam keine Ladesäule in seiner direkten Nachbarschaft hat, kann sogar eine bei der Stadt beantragen. Es gibt einen weiteren Grund, der die Menschen hier zum Kauf von E-Autos motiviert hat:
„Die Steuervergünstigung für elektrische Firmenwagen. Das war eine kluge Entscheidung. Damals gab es vor allem eher teure E-Autos. Und im Segment der Firmenwagen werden eher teure Autos gekauft. Das passte also gut.”
Der Anreiz funktionierte beim Kauf von Firmenwagen. Und er wirkte sich generell positiv aus: Gut 23 Prozent der PKW, die in diesem Jahr in den Niederlanden verkauft wurden, waren Elektro-Autos. Und für das Jahr 2030 gilt das Ziel: Alle Neuwagen sollen E-Autos sein.
Doch es gibt einen Wermutstropfen, und der schränkt die Umweltverträglichkeit der E-Autos stark ein: Nur 33 Prozent des Stroms in den Niederlanden kommen derzeit aus erneuerbaren Quellen. De facto werden also die Elektro-Autos von heute zum Großteil mit fossiler Energie angetrieben. Bis 2030, so der Plan, soll der Strom immerhin zu 70 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen.
Doch es gibt einen Wermutstropfen, und der schränkt die Umweltverträglichkeit der E-Autos stark ein: Nur 33 Prozent des Stroms in den Niederlanden kommen derzeit aus erneuerbaren Quellen. De facto werden also die Elektro-Autos von heute zum Großteil mit fossiler Energie angetrieben. Bis 2030, so der Plan, soll der Strom immerhin zu 70 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen.
Renee Heller sieht noch eine weitere Hürde: „Schließt man heute ein Auto an, wird es sofort geladen. Es kann aber sein, dass das für das Netz kein optimaler Zeitpunkt ist. Viele Leute laden ihr Auto, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen. In dieser Zeit steigt der Stromverbrauch auch durch die Nutzung anderer Elektrogeräte. Da treffen dann zwei Spitzen im Stromverbrauch aufeinander.“
Würden nach Feierabend künftig Millionen von Elektro-Autos gleichzeitig zum Laden angeschlossen werden, würde das Stromnetz das nicht verkraften. Man könnte also mehr Kabel verlegen und so für mehr Kapazität für die Stoßzeiten am Abend sorgen. Klüger aber wäre es, den Ladevorgang von E-Autos an sich zu überdenken, sagt Renee Heller: „Derzeit ist das ein relativ einfaches System. Du stöpselst dein Auto ein und bekommst Strom, auch zu Höchstlastzeiten. Aber mithilfe von Signalen könnte man das Laden zeitlich etwas verzögern. Oder man könnte die Ladeleistung während der Spitzenzeiten etwas drosseln und dann später wieder erhöhen. Oder man könnte in Intervallen laden. Es gibt da viele Möglichkeiten.“
Existierende Autos nicht alle durch E-Autos ersetzen
Die Energie-Expertin hat das sogenannte „smart charging“ im Rahmen eines Projekts erforscht. Sie glaubt, dass es das Netz enorm entlasten könnte, wenn Auto, Ladesäule und Stromnetz miteinander kommunizieren würden. Nur die niederländischen Auto-Besitzer müssten an einem solchen flexiblen Laden noch Gefallen finden. Im Zweifelsfall, so meint sie, durch finanzielle Anreize. Schließlich habe sich das auch beim Kauf von E-Autos schon bewährt.
Auch Geert Kloppenburg ist ein Fan von E-Autos. Doch der Mobilitätsexperte warnt nicht nur vor großen elektrischen SUVs, die extrem viel Platz und Energie in Anspruch nehmen. Er warnt auch davor, alle existierenden Autos in den Niederlanden durch E-Autos zu ersetzen: „Das Ziel kann nicht sein, dass wir nun alle 8,3 Millionen Fahrzeuge zu E-Autos machen. Nein, wir sollten ein, zwei oder drei Millionen Fahrzeuge elektrifizieren und dann diese Fahrzeuge teilen und gemeinsam nutzen.“
Ein Wunsch, der langsam Wirklichkeit zu werden scheint. 2021 waren bereits 13 Prozent aller Car-Sharing-Autos in den Niederlanden E-Autos. Bürgerproteste für Radwege, die sicher sind. E-Bikes für Berufspendler. Steuervergünstigungen für elektrische Firmenwagen. E-Autos, die von allen genutzt werden können. Gibt es Weiteres, was andere Länder wie Deutschland von den Niederlanden lernen könnten? Geert Kloppenburg glaubt, dass es darauf ankommt, die richtigen Fragen zu stellen. Und nicht die falschen. „Fragt man die Leute: Wie wünschst DU dir deine Mobilität? Dann kommen da Antworten wie: ‚Ich will mein Auto vor dem Haus parken.‘ Und so entstehen dann Berichte in denen steht: Wir haben Hundertausende Menschen gefragt, und alle wollen ihr Auto vor dem Haus parken.“
Wenn Kloppenburg für seinen Podcast unterwegs ist, fragt er stattdessen: „Wie soll deine Straße aussehen? Was soll da stattfinden? Dann lautet die Antwort: ‚Ich hätte gern eine ruhige Straße, in der ältere Menschen spazieren gehen und auf der Kinder spielen können. Ich hätte gern einen öffentlichen Raum, wo ich ein Buch lesen oder Grillen kann.‘ Die Menschen beantworten die Frage dann als Bürger, nicht als Konsument.“
Am liebsten wäre es dem Mobilitätsexperten jedoch, wenn Mobilität zweitrangig würde. Wir sollten mehr darüber nachdenken, wie wir leben und wohnen wollen, meint er. Und nicht darüber, wie wir von A nach B kommen. Geert Kloppenburg glaubt, dass Straßen dann wieder als öffentlicher Raum wahrgenommen würden - und nicht nur als Verkehrssystem.



















![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)