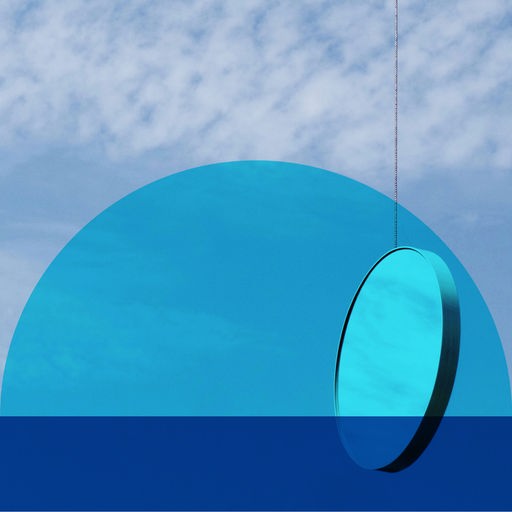2017 gewann der schwedische Film "The Square" die Goldene Palme in Cannes - eine Satire über den Direktor eines Museum für zeitgenössische Kunst. Im gleichen Jahr verloren, nach erbitterten Debatten, die Kuratorin Beatrix Ruf ihren Job als Direktorin am Stedeljik Museum Amsterdam ebenso wie Chris Dercon an der Volksbühne in Berlin.
2018 ging es munter weiter mit den Demissionen: Okwui Enwezor musste beim Haus der Kunst in München gehen, Ralf Beil beim Kunstmuseum Wolfsburg. Und jedesmal entstand der Eindruck, dass die Gefeuerten oder Gegangenen all die Sünden der Institution auf sich zu nehmen hatten. Aber warum sind Kuratoren nicht nur Sündenbock kriselnder Kunstinstitutionen, sondern auch oft Gegenstand von Hass und Häme in der Öffentlichkeit? Was verrät das über die gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklung?
Jörg Heiser, Jahrgang 1968, ist Direktor des Instituts für Kunst im Kontext, Universität der Künste, Berlin.
Kuratoren-Satire "The Square"
Im Mai 2017 gewann der schwedische Regisseur Ruben Östlund die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes. Sein Film "The Square" ist eine beißende Satire über den Direktor eines Museums für zeitgenössische Kunst. Als er in die Kinos kam, spaltete sich der Kulturbetrieb augenblicklich in zwei Lager: Auf der einen Seite jene, die den Film liebten, weil er vorführt, wie die musealen Institutionen um Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit werben - mittlerweile verzweifelt bis an den Rand der Lächerlichkeit.
Auf der anderen Seite die, die ihn hassten, weil Östlunds Satire dafür die Klischees prätentiöser Konzept- und Aktionskunst bemüht: hier eine Installation mit Staubhäufchen am Boden, die wie Kronjuwelen geschützt werden; oder dort der Performance-Künstler, der sich im Wortsinn wie ein Affe aufführt und beim Gala‑Dinner brutal wird.
Aber unabhängig von den Qualitäten oder Defiziten des Films: "The Square" schien vor allem den richtigen Riecher des Regisseurs zu beweisen. Denn kaum lief der Film über einen Museumsdirektor, der sich in heillose Widersprüche manövriert und dabei zum Sündenbock der medialen Öffentlichkeit wird, in den Kinos, ging es in der realen Welt munter so weiter.
Kuratorenrücktritte, real
Im Herbst 2017 kulminierte alles: In Amsterdam stritt man um Beatrix Ruf, die aufgrund angeblicher Interessenskonflikte ihren Job als Direktorin des berühmten Stedelijk-Museums räumen musste. In Kassel kam nach Ende der Documenta deren künstlerischer Leiter Adam Szymczyk unter Beschuss, weil man ihm und der Geschäftsführerin Annette Kulenkampff kriminelle Veruntreuung von Steuergeldern unterstellte. Und in Berlin kochte der Streit um Chris Dercon an der Volksbühne über, als eine Hausbesetzung mit Polizeipräsenz beendet wurde.
Nach dem Rücktritt Dercons vom Volksbühne-Job im April 2018 erwischte es im Juni auch Okwui Enwezor, seit 2011 Dercons Nachfolger am Haus der Kunst in München. In den USA gab es ebenfalls reihenweise skandalumwitterte Rücktritte, etwa am MOCA, dem Museum zeitgenössischer Kunst in Los Angeles, wo nach Chefkuratorin Helen Molesworth gleich auch noch derjenige gehen musste, der sie gerade erst gefeuert hatte: Museumsdirektor Philippe Vergne. In Deutschland war zuletzt Ralf Beil, dem Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg, der Stuhl vor die Tür gesetzt worden - von Dieselskandal-geplagten Volkswagen‑Vorständen, denen es vielleicht nicht schmeckte, dass Beil eine kritische Ausstellung zum Thema Erdöl plante.
Was ist los in der Kuratorenwelt?
Kuratorin oder Kurator zu werden war einmal für viele in der Kunst ein Traumziel, so viel steht fest. Aber in letzter Zeit sind diejenigen, die den Beruf an exponierter Stelle ausüben, zunehmend zur Zielscheibe von Hass und Häme geworden. Man könnte fast meinen, der Sessel eines Museumsdirektors wäre inzwischen - ähnlich wie bei Fußballtrainern - zum Schleudersitz geworden.
Bei Beatrix Ruf war es eine zu große Nähe zum Geld reicher Sammler; bei dem Documenta-Leiter Adam Szymczyk ein Millionendefizit oder bei Chris Dercon der angebliche Komplett-Ausverkauf einer Theater-Institution. Was auch immer die Genannten getan haben mögen, um Kritik oder Empörung auszulösen; ob sie nun tatsächlich ethische oder soziale Grenzen überschritten hatten, nicht integer waren oder verantwortungslos in Budgetfragen. Was auch immer sie also getan hatten, das ihre Demissionierung gerechtfertigt hätte - die Schärfe, das Giftige, die Art, wie die Debatten über ihre Arbeit in den Sozialen Medien und oft auch in der Presse geführt wurden, war schon erstaunlich geringschätzend.
Viele Fragen: Warum sind die Kunst-Kuratoren also zu Sündenböcken für die auf Krawall gebürsteten Sozialen Medien geworden, haben mit ihren Namen für das gepflegte Ressentiment gegen Kunst und ihre institutionellen Repräsentanten herhalten müssen?
Sind sie vielleicht Sündenböcke für die Fehler, die an ganz anderer Stelle gemacht werden, in der Politik und der Wirtschaft? Wie lässt sich berechtigte Kritik von ungerechtfertigter Diffamierung unterscheiden?
Erwartungsdruck und Managementkompetenzen
Dass aus dem Traumjob Kuratorin oder Kurator offenbar jene undankbare Aufgabe geworden ist, die einem schnell die Rolle des Sündenbocks einbringt, hat offensichtlich mehr als nur einen Grund. Es gibt die größeren gesellschaftlichen und politischen Spannungen, die sich mutmaßlich an dieser Stelle entladen: also auch das, was einen um die Demokratien bangen lässt - jene Logik der Polarisierung und Vereinfachung, die Populisten an die Macht bringt. Und genau die Logik, welche die Kunst in erster Linie als Verschwendung von Steuergeldern betrachtet.
Von vornherein lastet ein hoher Erwartungsdruck auf Kuratorinnen und Kuratoren. Man erwartet von ihnen, dass sie fachlich sowohl historisch als auch zeitgenössisch kompetent sind; dass sie ein großes Haus managen; dass sie mit Geld umgehen können und private Sponsoren einwerben; dass sie sich souverän auf dem medialen Parkett bewegen; dass sie Ausstellungs-Blockbuster produzieren und gleichzeitig intellektuelle und ästhetische Entdeckungen machen.
Und darüber hinaus: dass sie dabei stets integer bleiben und hohen moralischen Ansprüchen genügen. In der Tat haben sich Kuratorinnen und Kuratoren in den letzten Jahren verstärkt für eine größere Repräsentanz von Frauen und von globaler Kunst in den Museen eingesetzt. Viele von ihnen vertreten also grundsätzlich die damit verbundenen emanzipativen oder progressiven Werte; sie müssen zugleich aber Erfolge darlegen, die sich am besten in Geld und Besucherzahlen ausdrücken lassen. Angesichts so hoher, oft widersprüchlicher Anforderungen, sind die Kuratorinnen und Kuratoren also hin und her gerissen zwischen dem Druck, Vermarktbares und Publikumswirksames hervorzubringen - und dem Druck, gleichzeitig politische Kritikfähigkeit und ästhetische Risikobereitschaft zu demonstrieren.
Drei Phänomene des Kuratierens
Daraus ergeben sich bestimmte kunstimmanente Dynamiken, die nicht zuletzt dem Versuch geschuldet sind, mit dem Erwartungsdruck umzugehen:
- Erstens, die sogenannte Mega-Ausstellung der letzten Jahre, also riesenhaft dimensionierte Ausstellungen wie die letzte Documenta, die zeitgleich in Kassel und Athen stattfand.
- Zweitens, die zunehmende Instrumentalisierung von Kunst durch neoliberale Wirtschafts- und Politik-Konzepte, wie das seit Jahrzehnten beispielsweise in den USA vorgelebt wird.
- Und drittens, das Phänomen einer vor allem am Event und nicht an Werk und Ausstellung orientierten Art des Kuratierens.
- Zweitens, die zunehmende Instrumentalisierung von Kunst durch neoliberale Wirtschafts- und Politik-Konzepte, wie das seit Jahrzehnten beispielsweise in den USA vorgelebt wird.
- Und drittens, das Phänomen einer vor allem am Event und nicht an Werk und Ausstellung orientierten Art des Kuratierens.
Neben diesen drei Phänomenen - auf die wir noch ausführlicher zu sprechen kommen - gibt es aber auch hausgemachte Gründe dafür, dass Kuratorinnen und Kuratoren scheitern. Denn auch wenn man der These folgt, dass Kuratoren zu Unrecht zu Sündenböcken für alles Mögliche gemacht werden, heißt das nicht, dass der Fehler im Umkehrschluss bei allen zu suchen ist, nur nicht bei der Profession selbst. Es gibt sicher berechtigte Kritik am derzeitigen Berufsbild der Kuratorinnen und Kuratoren. Doch bleiben wir zunächst bei der Sündenbock-Dynamik, die es offenbar so leicht macht, dass alle Schuldzuweisungen in Krisen auf sie geschoben werden. Ein Beispiel:
Im Juni 2017, als Documenta 14 und Venedig-Biennale gerade eröffnet waren, begann der Kunstkritiker Stefan Heidenreich einen Artikel in der "Zeit" mit den Worten:
"Kuratieren ist undemokratisch, autoritär und korrupt." Kuratoren, hieß es weiter, seien "autokratische Herrscher".
Nehmen wir einmal an, Heidenreich habe nur zugespitzt formuliert, um einem berechtigen Anliegen Gehör zu verschaffen. Dann könnte man dies so verstehen: Nun ja, hin und wieder kann es Kuratoren tatsächlich passieren, dass Eitelkeit in Größenwahn umschlägt und die Kuratorentätigkeit einen autoritären Zug bekommt. Aber dann folgert Heidenreich ernsthaft, die Lösung des Kuratorenproblems seien Soziale Medien, in etwa: Dort könne per Mehrheitsentscheidung herausgefunden werden, was in den Museen gezeigt werden soll.
Mal abgesehen davon, das in den Sozialen Medien, wie wir es längst wissen, Bots und Trolle mitbestimmen - was ist das für eine unglaublich traurige Vorstellung von Demokratie, über künstlerische Inhalte per Online-Abstimmung entscheiden zu lassen?
So oder so zeigte der "Zeit"-Artikel von Stefan Heidenreich, dass längst bis weit in ein linkes, bürgerliches Lager hinein die Kuratorentätigkeit gern diskursiv verteufelt wurde. Der Fall Chris Dercon machte das besonders deutlich. Schon als im April 2016 der ehemalige Direktor vom Münchner Haus der Kunst und der Londoner Tate Modern als Nachfolger des Berliner Volksbühnen-Chefs Frank Castorf vorgestellt wurde, hagelte es Kritik.
In der Tat hatte der damalige Berliner Kulturstaatssekretär Tim Renner sich und seinem Kandidaten einen Bärendienst erwiesen: ein neuer Direktor, der von der Kunst und nicht aus dem Theater kommt - und das ohne Absprache mit der Volksbühne!
Der Fall Dercon
Ein Teil der künstlerischen und linken Bohème, der Castorf seit jeher bewunderte, schoss sich auf Dercon ein. Er wurde zum absoluten Lieblingsfeind: der Belgier, der fließend Englisch und Deutsch spricht, wie geschaffen als Repräsentant eines angeblich blasierten, kosmopolitischen Kunst-Jetsets, einer neo-liberalen Elite, die nichts lieber will, als die Volksbühne und ihren Kiez - jenes gallische Dorf ostdeutscher, bohemischer Renitenz - zu gentrifizieren und zu zerstören.
Genau besehen war Berlin-Mitte längst schon durchgentrifiziert, nicht zuletzt auch dank der kulturellen Attraktivität der Volksbühne in den 1990er-Jahren - alle Flagship-Stores internationaler Modemarken und Hipsterbars mit Mikro-Brauereien waren längst da. Vor diesem Hintergrund mögen die bunten Seidenschals, die Dercon zu tragen pflegt, sicher seine Gegner nur in ihrer Position bestärkt haben. Und auch manche seiner Äußerungen waren ungeschickt und hatten diesen unangenehmen Beigeschmack von Kuratoren-Sprech und Marketing‑Gesülze, ob es nun um mögliche Sponsoren oder die Vorzüge der Interdisziplinarität ging. Doch die Karikatur, die seine Feinde aus Dercon machten, war schlicht unfair, ja sie grenzte an eine Art öffentlich‑kollektiven Rufmord, der sich hauptsächlich in den sozialen Medien manifestierte. Eine Art Cyber-Mobbing im Großmaßstab.
Warum war Chris Dercon plötzlich der Anti-Christ? Vielleicht kann uns der eingangs erwähnte Film "The Square" ein paar Hinweise geben. Gleich zu Anfang sehen wir den dänischen Schauspieler Claes Bang, der den sehr beflissen und smart wirkenden Christian spielt, wie er auf einem Designersofa ein Nickerchen hält. Er wird für ein Interview mit einer TV‑Journalistin, gespielt von Elisabeth Moss, geweckt. Sie sitzen im perfekten White Cube, der klinisch-weißen Ausstellungshölle.
Mit gespielter Naivität fragt nun die Journalistin den Museumsdirektor nach einem unverständlichen Pressetext. Die Antwort ist eine peinliche Pause, bevor er das Thema wechselt. In der darauf folgenden Sequenz sehen wir, wie eine Reiterstatue des Schwedenkönigs Karl Johann vor dem Königspalast abmontiert wird und dabei zu Bruch geht - die Monarchie ist abgeschafft und in ebenjenem Palast ist nun das Kunstmuseum untergebracht. An die Stelle des Denkmals kommt ein vier mal vier Meter großes, mit weißen Streifen markiertes Quadrat - ein Kunstwerk namens "The Square", das zur aktiven Teilhabe des Publikums aufruft und das einen Medienskandal auslösen wird, der unserem Helden Christian viel mehr Ärger einbringen wird als ein unverständlicher Pressetext.
Wir sind gerade einmal fünf Minuten im Film drin, da sind schon alle Mythen und Klischees über zeitgenössische Kunst vor uns ausgebreitet: der aalglatte Kurator, der sich mitten am Tag auf dem Designersofa lümmelt; die doofen, nachgemacht wirkenden Kunstwerke; das kryptische, pseudointellektuelle Kunst-Sprech; die Unfähigkeit, offen und direkt Stellung zu beziehen; die selbstgerecht liberale Attitüde, die die sozialen und ökonomischen Wirklichkeiten verkennt; die brutale Abschaffung von Tradition, ersetzt durch falsche Versprechen.
Doch Östlunds Film hat Nuancen. Christian will ein guter Mensch sein und scheitert daran, weil seine Position im System ihn dazu verführt, sich opportunistisch zu verhalten, besonders, wenn er einem Dilemma gegenüber steht. Der Skandal, den ein Werbevideo für das Kunstwerk "The Square" auslöst, bringt ihn in eine ganz typische mediale Zwickmühle: Wenn er die Sache abbläst, heißt es, er betreibe Zensur; wenn er sie weiterlaufen lässt, beschuldigt man ihn, moralisch unverantwortlich zu handeln.
Wir werden diese Art der Lose-Lose-Situation immer wieder sehen bei den gefeuerten oder zum Rücktritt gezwungenen Kuratoren und Museumsdirektoren: Die öffentliche Figur steht vor dem Dilemma, wählen zu müssen zwischen etwas, was man besser nicht tun sollte und etwas, was man ebenfalls besser nicht tun sollte.
Chris Dercon hatte diese unmögliche Wahl. In dieses Dilemma wurde Dercon aber nicht zuletzt von seinen Vorgesetzten, dem Berliner Ersten Bürgermeister Michael Müller von der SPD und Kultursenator Klaus Lederer von der Linken gebracht. Er konnte entweder jene, die im Herbst 2018 die Volksbühne besetzten, weiter dulden und in Kauf nehmen, dass ihm de facto vorgehalten werden kann, er komme seinen vertraglichen Pflichten als Hausherr einer öffentlichen Institution nicht nach. Oder er hatte als ebensolcher Hausherr eine polizeiliche Räumung mitzutragen, die ihn erst recht zum Buhmann macht.
Am Dienstag nach der sonntäglichen Bundestagswahl im Oktober 2017, bei der die SPD empfindliche Verluste hinnehmen musste und die AfD erstmals in den Bundestag einzog, soll es zwischen Müller und Lederer bei der ersten Senatssitzung zu einem lautstarken Streit gekommen sein. Wiederum zwei Tage später erfolgte die polizeiliche Räumung, wenige Stunden vor der ersten Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses nach der Wahl. Es war abzusehen, dass die AfD den Senat angegriffen hätte dafür, dass er zulässt, dass ein mit Steuergeldern finanziertes Haus besetzt bleibt. Das Problem war gerade noch rechtzeitig vom Tisch.
Als Hausherr wurde Dercon offenbar von der Berliner Politik der Schwarze Peter zugeschoben. Man kann spekulieren, ob Dercon sich dem Druck hätte wiedersetzen müssen auf die Gefahr hin, wegen Verletzung seiner vertraglichen Pflichten gekündigt zu werden - aber das ist müßig. Jedenfalls wurde er von den Regierenden so elegant in die Sündenbock‑Position geschoben.
Und im April 2018 folgte Dercons Rücktritt.
Es ist ein Szenario, das so ähnlich auch in den Plot von "The Square" gepasst hätte.
Das Problem scheint nicht die subjektive Willkür von Kuratoren zu sein, wie Stefan Heidenreich behauptet hat, sondern das genaue Gegenteil: Die Direktoren und Chefkuratoren an den großen Häusern sind in kulturpolitische und wirtschaftliche Kalküle verstrickt. Sie folgen (immer häufiger) der sprunghaften Aufmerksamkeitslogik medialer Öffentlichkeit. Und so laufen die Kuratoren beinahe automatisch Gefahr, Sündenböcke für die moralischen Dilemmata der Gesellschaft im Umgang mit Kunst und Kultur zu werden.
Kunst, Moral und Aufmerksamkeit
Der Berufsstand der Kuratoren hat aber durch gewisse Eigendynamiken die krisenhafte Entwicklung begünstigt: Mit der Mega-Ausstellung, der zunehmenden Instrumentalisierung von Kunst durch neoliberale Wirtschafts- und Politik-Konzepte und der Orientierung am Event und nicht an Werk und Ausstellung sind die drei Phänomene nochmal benannt:
Was heißt "Orientierung am Event"? Die Aufmerksamkeitsökonomie der heutigen Medienlandschaft braucht konstant Futter. Man muss eine möglichst selten unterbrochene Kette von Ereignissen erzeugen, eine Art Flow, der die eigene Präsenz in den Medien aufrecht erhält. So werden genug Follower, Likes und Presse für Ausstellungen generiert, was wiederum der Institution mehr Besucher und Aufmerksamkeit bescheren soll, ein glanzvolleres Image.
Aber wie entsteht der Glanz? Wenn man der Kunst traut, dann durch Kunst. Wenn man ihr nicht recht traut, setzt man auf etablierte Rezepte und Namen, die Prominenz und Glamour bedeuten. Genau nach diesem Motto verfuhr jahrelang Klaus Biesenbach als Kurator am New Yorker Museum of Modern Art, dem MoMA. Früh in den Sozialen Medien unterwegs, kreierte er bereits 2010 einen regelrechten Mediensturm um die große MoMA-Einzelausstellung der Performance-Künstlerin Marina Abramović. Auf dem Instagram-Account von Biesenbach tummelten sich fortan Stars wie Lady Gaga, Patti Smith oder James Franco. Fünf Jahre später aber geriet eine Ausstellung mit Björk zum medialen Desaster. Es hagelte Kritik, denn die Ausstellung bot wenig Kunst, schien eine nur halbgare Sache, die sich hauptsächlich auf die Aura des isländischen Popstars und diverse Souvenirs aus ihrer Karriere verließ.
An der Kritik war durchaus etwas dran, aber sie schlug um in eine rückwärtsgewandte Sehnsucht nach den alten Tagen, als die alteingesessene New Yorker Bildungselite ihren Kunsttempel noch nicht mit Scharen von Touristen teilen musste. Was war passiert?
Es war wohl ein Versuch, innerhalb der Institution die eigene Macht zu stärken zu einem Zeitpunkt, als das MoMA bereits so etwas wie ein Immobilien-Investor geworden war. Man hatte auf dem eigenen Gelände einen Wolkenkratzer mit teuren Eigentumswohnungen errichtet und war an weiteren spekulativen Geschäften beteiligt.
Inzwischen ist Biesenbach als neuer Direktor ans MOCA in Los Angeles gewechselt - zum nächsten Schleudersitz.
Ein weiteres Phänomen ist die Instrumentalisierung durch neoliberale Politikstile. Öffentliche Förderungen für Kultur und Bildung werden gekürzt. Das begünstigt eine zunehmende Privatisierung von Kunstbereichen, die privaten Gönnern, Philanthropen und Sponsoren überlässt, den Museen einen Gutteil ihrer Programme zu finanzieren.
Die Interessenskonflikte, die sich dadurch ergeben, sind kaum zu vermeiden. Dabei hat doch gerade die Wirtschaft, unter politischem Druck, in den letzten Jahren Compliance-Regeln aufgestellt, die nun aber ironischerweise in den Kunsthäusern nicht wirklich etabliert scheinen.
Nehmen wir das Beispiel des Stedelijk-Museums in Amsterdam. 2012 wurde ein neu erbauter Flügel des Hauses eröffnet. 2010 war in den Niederlanden eine Mitte-Rechts-Regierung gewählt worden, die Wahl markierte auch den Aufstieg des Rechtspopulisten Geert Wilders. In diesem politischen Klima wurden im Kultursektor radikale Kürzungen von um die 25 Prozent beschlossen, ganz im Sinne rechtsgerichteter Ressentiments gegen die Kultur als Hort des Linksliberalismus, aber auch im Sinne eines neoliberalen Umbaus in Richtung Privatisierung. In den darauffolgenden Jahren wurden zwar viele dieser Kürzungen wieder abgeschwächt oder zurückgenommen, aber der Schock saß tief. Entsprechend mag auch der Aufsichtsrat des Stedelijk auf eine neue Museumspolitik gedrängt haben: nämlich, indem man stärker einem amerikanischen Modell mit privaten Mäzenen folgt, um sich für eine Entwicklung zu wappnen, in der erneut Streichungen der öffentlichen Hand zu erwarten sein würden.
Der Fall Ruf
Entsprechend suchte man also für den Direktorenposten jemand mit guten Verbindungen zu Sammlern und Privatgaleristen. Und man fand diese Person 2014 in der deutschen Kuratorin Beatrix Ruf, bis dahin Chefin der Kunsthalle Zürich. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, dass Ruf später ihren Posten aus ähnlichen Gründen räumen musste, die dazu geführt hatten, dass sie ihn drei Jahre zuvor bekam.
Ruf hatte zu ihren Zürcher Zeiten einen lukrativen Nebenjob als Beraterin des Schweizer Medienunternehmers und Kunstsammlers Michael Ringier, den sie vertragskonform mit Antritt des Postens in Amsterdam beendet hatte. Doch es gab noch eine erhebliche Bonuszahlung von einer Million Franken. Sie hatte dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden des Stedelijk von dieser Zahlung erzählt - und er hatte es abgesegnet.
Im Oktober 2017 änderte sich die Lage drastisch. Der Politiker Ferdinand Grapperhaus war inzwischen Vorsitzender des Aufsichtsrats vom Stedelijk Museum. Aber nun wurde verkündet, er werde der neue Justizminister der Niederlande werden. Auch die designierte Innenministerin Kajsa Ollongren hatte direkt mit Beatrix Ruf zu tun: Sie war bis dahin als Kultur-Stadträtin Amsterdams deren direkte Vorgesetzte.
Genau um die Zeit dieser politischen Auslobungen also erschienen Artikel in der holländischen Presse, die Rufs vermeintliche Interessenskonflikte mit Kunstsammlern offenlegen sollten. Am Wochenende, nachdem die neuen Ministerposten publik gemacht worden waren, trat sie - vermutlich unter Druck - zurück.
Beatrix Ruf war vielleicht das Bauernopfer in einem Schachspiel um politische Schadensvorbeugung. Der Justizminister und die Innenministerin wollten offenbar Klarschiff machen in ihrem bisherigen Zuständigkeitsbereich - zumindest kamen ihnen die Berichte, die über Rufs Interessenkonflikte schreiben, zupass. Doch im Juni 2018 erschien ein Gutachten. Auf 120 Seiten legen Justizexperten dar, dass Ruf nicht gegen geltende Gesetze und nicht gegen ihren Arbeitsvertrag verstoßen habe. Allenfalls eine moralische Inpflichtnahme enthält der Text:
"Ruf scheint nicht immer verstanden zu haben, dass sie ihre Funktion nicht nur im Einklang mit dem Wortlaut der Führungsregeln, sondern vor allem auch in deren Geiste ausführen muss."
Kein Zweifel: Stellte Beatrix Rufs geschäftliche Verbindung zum Schweizer Verleger Ringier zu Beginn ihrer Amtszeit als Direktorin eines öffentlichen Hauses ein Problem da, war dieses zum Zeitpunkt ihres Rücktritts jedoch längst bereinigt. Es wäre gute Kulturpolitik gewesen, neue Regeln für zukünftige Direktoren aufzustellen - aber Ruf aus dem Amt zu drängen, erfüllte eine Sündenbock-Funktion gegenüber einer kunstskeptischen Wählerklientel. So gesehen hatten die beiden genannten Politiker definitiv einen größeren Interessenskonflikt als Ruf.
Der Fall Documenta 14
Ein drittes hausgemachtes Phänomen des Kunstbetriebs, welches Kuratoren in den letzten Jahren zu Sündenböcken machte, ist die Mega‑Ausstellung. Adam Szymczyk, 2013 von einer hochkarätigen Jury zum Leiter der Documenta 14 berufen, konnte über seine fünf Mitbewerber triumphieren mit dem Vorschlag, die Schau zeitgleich in Kassel und Athen stattfinden zu lassen. In Zeiten der damals akuten griechischen Finanzkrise schien der Vorschlag kühn und vielversprechend. Er schmeichelte den Ambitionen der Documenta und ihrem Selbstverständnis als weltweit führender Großausstellung.
Die Entwicklung hatte spätestens mit Okwui Enwezor und dessen Documenta von 2002 begonnen: Von Mal zu Mal musste es mehr Orte, mehr Zuschauer, mehr Künstler, mehr moralische Autorität geben. Die symbolische Vormachtstellung gegenüber der globalen Konkurrenz großer Biennalen sollte bewahrt werden. 2012 hatte die künstlerische Leiterin Carolyn Christov-Bakargiev mit der Documenta unter anderem in Kabul, Kairo und den kanadischen Rocky Mountains Station gemacht. Und nun, 2017, bescherte Szymczyk den Documenta-Besuchern eine quasi verdoppelte Documenta mit dutzenden von Ausstellungsorten in zwei Städten. Wer alles gesehen haben wollte, war insgesamt mindestens zwei Wochen unterwegs.
Dabei spiegelte sich die kolonialismuskritische Thematik der Documenta auf unheimliche Weise in ihrem eigenen Auftreten als Institution wieder: Denn wer mit einem Budget von über 38 Millionen Euro in Athen aufschlägt, musste sich dort unweigerlich mit denen vergleichen lassen, die sich die Schiffs- und Flughäfen des hochverschuldeten Landes unter den Nagel gerissen hatten.
DIe Gigantomanie der Documenta schlug auf sie zurück. Die Kunst und die Kuratoren wurden zuerst Opfer ihres Erfolgs, dann ihres daraus sich ergebenden Misserfolgs. Denn es liefen am Ende Millionenverluste auf. Nun war der künstlerische Leiter der Buhmann. Aber auch die Institution Documenta selbst, in Gestalt ihrer Geschäftsführerin, wurde angegriffen.
Die kursierende Summe von fünf Millionen Euro Defizit wäre weniger als 15 Prozent des Gesamtbudgets.
Wenn man an die Kosten der Großbauprojekte der Politik der letzten Jahre denkt, von der Elbphilharmonie über den Stuttgarter Bahnhof bis zum Berliner Flughafen BER, so sind das vergleichsweise bescheidene Zahlen. Dennoch stürzte sich die Kasseler AfD genüsslich auf die Documenta und erstattete Anzeige wegen angeblicher Veruntreuung von Steuergeldern. Erst im August 2018, nach ihrer Entlassung aus dem Job, wurde Geschäftsführerin Annette Kulenkampff von all diesen Vorwürfen freigesprochen.
Aber dennoch: Die Documenta hatte über die Jahre auf struktureller Seite einen Hochmut entwickelt, der nun zum Fall führte und die politischen Gegner auf den Plan rief. So entwickelt sich ganz schnell ein rückwärtsgewandtes Denken, das mit den gefeuerten oder entlassenen Kuratoren und Direktoren zugleich deren Werte entsorgen will, etwa im Hinblick auf eine größere Repräsentanz von Frauen und globaler Kunst in den Museen.
Kuratoren als Sündenböcke
Auch der Rücktritt von Okwui Enwezor als Direktor des Haus der Kunst in München im Juni 2018 hatte einen politischen Beigeschmack. Zwar gab es unter seiner Ägide Fehlentwicklungen am Haus, an die Öffentlichkeit drangen Berichte von Scientology‑nahen Mitarbeitern und ein Haushaltsdefizit im Jahre 2017. Aber zugleich hatte er mit seinem in der internationalen Kunstwelt hoch angesehenen Programm auch dafür gesorgt, dass MoMA oder Tate Modern gemeinsam mit den Münchnern Ausstellungen auf die Beine stellen wollten. Zwei große Retrospektiven der amerikanischen Kunstpionierinnen Adrian Piper und Joan Jonas sind denn auch prompt nach Enwezors Weggang abgeblasen worden, während man den an Krebs erkrankten Enwezor munter zum Sündenbock der ganzen Krise machte. Inzwischen wurde ein Expertenrat eingesetzt, der seine Nachfolge regeln soll. Mit der Zeit wird deutlich, dass es nicht mehr so eindimensional möglich sein wird, alles Fehlverhalten dem geschassten Direktor in die Schuhe zu schieben.
Kuratoren als Sündenböcke sind gewissermaßen Kollateralschäden einer Entwicklung, die auch der Dynamik der Sozialen Medien geschuldet ist.
Natürlich sollte es politische Kontrolle und Compliance-Regeln geben, keine falsche Rücksicht bei Fehlverhalten. Aber die allzu bequeme Sündenbock-Politik, die Kuratoren stigmatisiert und Politiker aus der Verantwortung nimmt, muss ein Ende haben.
Was es braucht, sind nicht nur mutige Kuratorinnen und Kuratoren, die sich in den Gegenwind stellen, sondern auch ein allgemeines Bewusstsein dafür, dass die Errungenschaften der Zivilgesellschaft in Gefahr sind. Und zu diesen Errungenschaften gehören eben auch die Kunstinstitutionen und ihre kuratorischen Teams.