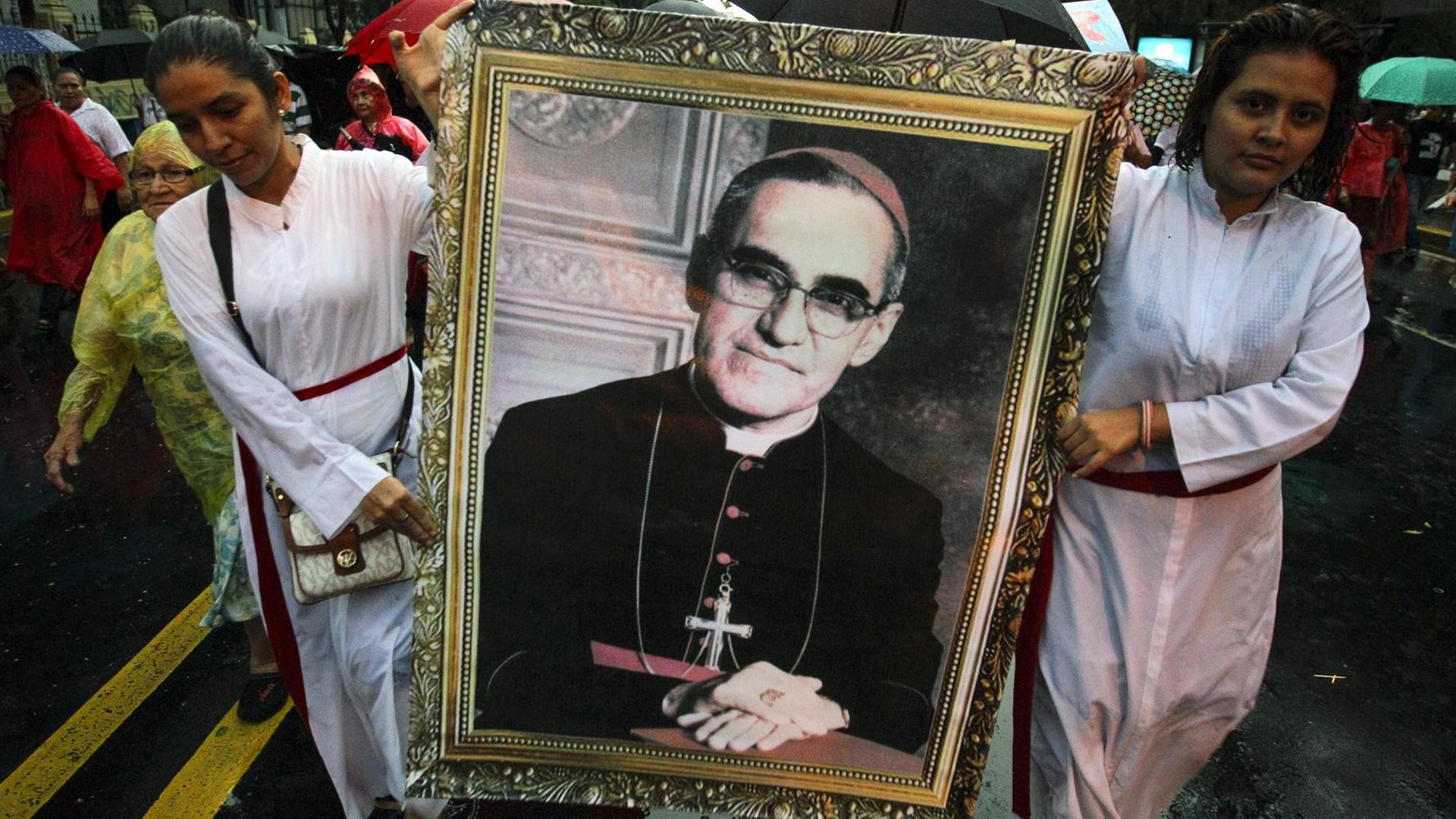Wer von ihm geprüft wurde im Diplom oder im Examen, musste sich warm anziehen. Johann Baptist Metz war berühmt für Sprüche wie „Ja, ich merke, Sie haben meine Bücher gelesen. Aber haben Sie die auch verstanden?“ Solche Geschichten kursieren unter Theologinnen und Theologen, wenn sie sich an persönliche Begegnungen mit Johann Baptist Metz erinnern. Von einem der ganz großen Theologen des 20. Jahrhunderts in die Schranken verwiesen geworden zu sein, ist am Ende des Tages dann doch ein Ritterschlag.
Frankfurter Schule und Politische Theologie
Johann Baptist Metz war deshalb einer der ganz großen katholischen Theologen, weil er seine Kirche zwar im Blick hatte, aber weit darüber hinaus gehört wurde und zuhörte. Er war im Gespräch mit Vertretern der Frankfurter Schule um die Philosophen Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Jürgen Habermas, mit dem er befreundet war. Er entwickelte eine «Neue Politische Theologie» und beeinflusste so die lateinamerikanische Befreiungstheologie, die ihn ihrerseits prägte.
Johann Baptist Metz, geboren am 5. August 1928, wächst auf in Auerbach in der bayerischen Oberpfalz, einer katholisch geprägten Kleinstadt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wird er beinahe verheizt – wie so viele seiner Generation:
„Ich war ein Junge, der geradezu widerwillig aus der Gymnasialzeit heraus gerissen worden ist gegen Ende des Kriegs und dann ins letzte Feuer geworfen wurde, gewissermaßen. Allerdings an der Westfront – in den ersten Monaten 1945, als ich 16 Jahre alt war. Mit einer Kompanie lauter junger Leute eben an eine Front kam, in der die Amerikaner schon weit – also über den Rhein – hereingerückt waren. Eines Abends wurde ich zum Bataillonsgefechtsstand mit einer Meldung geschickt; ich hab‘ das gemacht, bin also quer durch die Büsche und die Wälder da gelaufen und bin tatsächlich auch dahin gekommen, wo ich hin wollte. Und dann zurück auf dem Weg über brennende Gehöfte wieder an unsere Stellung herangekommen und als ich da ankam – da waren die jetzt alle tot. Tote Antlitze derer, mit denen ich noch ein paar Stunden vorher – sozusagen – mein Jungenlachen geteilt hab‘, denn junge Leute – das wissen Sie ja auch – lachen auch im Krieg.“
Nicht ohne, nur mit den Juden
Diese Erlebnisse haben seine Theologie massiv beeinflusst. Es war diese Erfahrung, die Metz bewegte und ihn nach Gott fragen ließ – nach Gerechtigkeit für die unschuldigen Opfer.
Metz hat die Menschheitskatastrophe von Auschwitz an sich herangelassen. Er fragte: Ist nach der Shoah das Reden von Gott überhaupt noch möglich? Als Professor für Fundamentaltheologie entwickelte er in Münster eine katholische „Theologie nach Auschwitz“.
Wegen unseres christlichen Verhältnisses zu dieser Katastrophe. Wegen der Tatsache, dass die ecclesia – die Kirche – durchaus auch von der Synagoge zu lernen hätte.
Und um es mit den Worten des Wiener Theologen Jan-Heiner Tück zu formulieren: „Metz war der erste, der das Erschrecken über die Shoah in die katholische Theologie einschrieb. In einer viel beachteten Rede auf dem Katholikentag von 1978 ging er auf die Frage ein, wie man nach Auschwitz noch beten könne. Man könne nur beten, weil auch in Auschwitz gebetet worden sei. Nicht ohne, nur mit den Juden könnten Christen über die Zäsur hinauskommen.“
Seine eigene Gotteserfahrung beschrieb Metz als „Erfahrung des Leidens an Gott“. Diese Erfahrung verdichtete sich, so Metz, nicht zuletzt im Schrei Jesu am Kreuz – „der Schrei jenes Gottverlassenen, der seinerseits seinen Gott nie verlassen hatte“. An der Theodizee, der Frage nach dem Leid in der Geschichte und warum Gott das zulasse, geht bei Metz kein Weg vorbei. Er wollte die „memoria passionis“ bewahren, die „Autorität der Leidenden“ in die Theologie neu einführen. Daraus folgt für Johann Baptist Metz: eine Mystik „der schmerzlich geöffneten Augen“, die auch „die fremden Anderen“ in den Blick nehmen müsse, nicht nur nahe Nächste.
Jenseits der bürgerlichen Religion
Metz‘ Lehrer war Karl Rahner, der wohl wichtigste katholische Theologe des 20. Jahrhunderts. Und wie Rahner wird auch Metz katholischer Priester. Seine Kirche gestaltet er mit. Er ist von 1971 bis 1975 Berater der Würzburger Synode der Deutschen Bistümer und Hauptverfasser des Synodendokuments „Unsere Hoffnung“ – ein Dokument, das bis heute engagierte Katholiken bewegt, weil es für die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils in Deutschland zentral war.
Mit Büchern wie „Jenseits bürgerlicher Religion“ oder „Glaube in Geschichte und Gesellschaft“ hat Metz mehrere Generationen von Theologinnen und Theologen geprägt – aber auch Zeitgenossen, die sich für ein Nachdenken über Gott interessieren. Metz mied alles Formelhafte, wenn er – wie hier in der Sendung Zwischentöne im Deutschlandfunk 1995 so über Gott sprach:
„Wissen Sie, er soll nicht so schwach sein, wie ich. Er soll mich retten können. Er ist für mich ein Widerstand – wenn Sie so wollen – und sein Name ein Widerstands-Wort gegen die hereinbrechenden Sinnlosigkeiten im eigenen Leben und natürlich im Leben um mich herum: zuweilen ein allerletztes Widerstandswort, zuweilen eines, das man nicht einmal mehr aussprechen kann. Dass das Schweigen oder auch – nicht selten – der Schrei, eine der elementarsten Ausdrucksformen dessen ist, was ich Gebet nennen würde.“
Gesundheitsbedingt war es in den vergangenen Jahren ruhiger geworden um Johann Baptist Metz. Aber es war ihm vergönnt, an den neun Bänden seiner „Gesammelten Schriften " zu arbeiten. Jetzt ist er am Montag in Münster im Alter von 91 Jahren gestorben.
Die Gesammelten Schriften (9 Bände) von Johann Baptist Metz sind im Herder-Verlag erschienen.