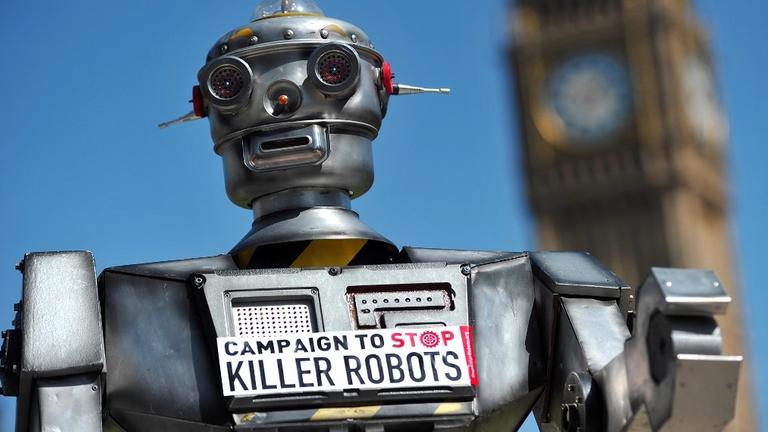Der Skipper drosselt den Motor des Schlauchbootes. Das Ziel ist erreicht. Das portugiesische Schiff "Don Carlos", das einige hundert Meter vor der Küstenstadt Sesimbra den Anker ausgeworfen hat und für hydrografische Untersuchungen eingesetzt wird.
An Bord: belgische, polnische, portugiesisch, italienische, türkische und US-amerikanische Übungsteams. Sie wollen herausfinden, wie unbemannte Technik die Suche nach Seeminen erleichtern kann und wie zuverlässig sie ist.
Fregattenkapitän Jochen Beyer arbeitet im NATO-Zentrum für Seeminenabwehr in Ostende in Belgien. Er zeigt auf den Boden, wo ein etwa zwei Meter langes, längliches Gerät liegt.
"Es sieht aus wie eine Art Mini-U-Boot, länglich mit einem Propeller und einer Steuerung hinten dran, einem kleinen Türmchen für Kommunikation und seitlich und unterhalb der Drohne sind die Sensoren angebracht, das Sonar, mit dem der Seeboden abgesucht wird."
Drohnen stellen neue Evolutionsstufe dar
Die Soldaten programmieren an Land oder auf dem Schiff einen Auftrag für den Roboter, welches Feld und auf welche Weise es abgesucht werden soll. 100 Seemeilen können die Drohnen schon mal abscannen, das sind umgerechnet 180 Kilometer. Dann bringen die Teams die Drohne an den Startpunkt, lassen sie ins Wasser, wo sie dann abtaucht und sich auf den Weg macht. Über Akustiksignale meldet sie immer wieder mal ihren Standort, und ob mit ihr alles in Ordnung ist. Grundsätzlich gilt: Je größer die Drohne, desto stärker die Batterie und desto länger die Laufzeit. Wenn sie wieder nach Hause zurückkehrt, wie hier auf das Schiff Don Carlos, holen sie die Teams aus dem Wasser, laden die Bilder herunter und prüfen dann, was die Drohne gesehen hat. Diese Technik hievt die bisherige Minenabwehr auf eine neue Evolutionsstufe.

"Der klassische Weg der Minenabwehr war früher das Minenräumen. Die nächste Entwicklung war die Minenjagd mittels Sonar, wo man im Vorausbereich des Schiffes den Seeboden und die Wassersäule abtastet und bei Auffinden eines Objektes kurz stehen blieb und das dann näher untersuchte, entweder durch kabelgebundene, kleine Fahrzeuge oder klassisch durch Minentaucher." Was die kleinen Roboter ebenso können. Sie gelangen in Gewässer, wo der Mensch an seine Grenzen stößt, erklärt Lieutenant Garrison Grant von der US-Navy:
"Diese Unterwasser-Vehikel können mehrere Stunden lang im Wasser sein, während es Taucher abhängig von der Tiefe nur zehn bis 40 Minuten lang am Boden aushalten. Die Roboter können unter Eiskappen arbeiten und in extrem heißem Wasser, so wie im Arabischen Golf und danach lädt man einfach alle Daten runter und kann sie am Bildschirm objektiver analysieren. So muss man nicht mehr darauf vertrauen, was der Taucher glaubt, gesehen zu haben."
Schwarmintelligenz - wichtiger als menschliche Kreativität
Der Mensch soll in Zukunft also eine immer geringere Rolle in der Minenabwehr spielen. Ganz lässt sich aber nicht auf ihn verzichten. Und er ist auch der limitierende Faktor: Seine Kreativität setzt der Technik Grenzen. In Zukunft – so die Hoffnung – sollen die Wasser-Drohnen ihre Erkenntnisse austauschen. Als Schwarm eingesetzt könnten die Drohnen gegenseitig von ihrer Schwarmintelligenz profitieren.
"Jetzt geht das noch nicht, aber das kommt sicher bald. Die Geräte können noch nicht miteinander kommunizieren, aber das Interesse, das hinzubekommen, wie man sogenannte smarte Technologie anwendet, ist groß."
Die Stimmung auf dem Schiff ist entspannt, es riecht nach Kabeljau aus der Bootsküche, die Sonne scheint den Soldaten auf die Stirn und die Tests laufen ohne Hektik ab.
Gut zwei Wochen lang haben die Teams ihr Equipment ausprobiert, sich ausgetauscht, die Ergebnisse verglichen. Die Übung vor Sesimbra soll zeigen, was jetzt schon möglich ist, aber auch schon ein Gefühl dafür vermitteln, was in Zukunft alles noch möglich sein wird.
Unterwasser-Wlan namens Janus
Ein Aspekt, der immer wichtiger wird: Unterwasserkommunikation interoperabel zu gestalten, so, dass die NATO-Partner und ihre jeweiligen Systeme miteinander arbeiten können. Das ist das Betätigungsfeld von Joao Alves, der im NATO-Zentrum für Seeforschung in La Spezia, Italien, arbeitet:
"Janus haben wir in Italien entwickelt, in Zusammenarbeit mit vielen Ländern, darunter auch Deutschland. Es geht darum, unter Wasser Interoperabilität herzustellen. Wenn Sie an unser tägliches Leben denken, dann gehen Sie ins Café, wählen sich ins Wlan-Netz ein und müssen nicht daran denken, wer Ihr Handy hergestellt hat, die Dinge funktionieren einfach miteinander, weil sie interoperabel sind."
Janus soll also eine Art WLAN des Meeres sein, was so leicht nicht umzusetzen ist. Denn dafür müssen Akustiksignale in Bits verwandelt werden. Je nach Salzgehalt, Tiefe, Wassertemperatur und Bodenbeschaffenheit können die Signale verzerrt werden, zum Beispiel durch Echos auf felsigen Böden. Und dann gibt es noch eine andere Herausforderung: Wie lässt sich die Unterwasserkommunikation vor dem Feind schützen, damit der die eigenen Drohnen nicht umprogrammiert?
"Janus ist ein offenes Netzwerk, das heißt aber nicht, dass es nicht sicher gemacht kann, denn genauso wie Sie im Internet mit dem TCP-Protokoll verschlüsselte Daten verschicken können, geht das auch unter Wasser. Janus bietet die Struktur, auf der Daten verschlüsselt werden können, um die Privatsphäre zu schützen."
Wie Interoperabilität in der Praxis funktioniert, haben die Nato-Verbündeten auch im Rahmen der Übung getestet. Vor der Militärbasis auf der Halbinsel Troia haben die Teams einen feindlichen Angriff simuliert, bei dem die verschiedenen Systeme kompatibel gemacht werden sollten. Andrea Bell-Miller ist zuständig für das Programm zur Entwicklung unbemannter Systeme in der US-Marine und hat den Test beobachtet:
"Wir hatten ein Szenario, bei dem die Portugiesen einen nächtlichen Überfall auf den Strand simuliert haben. Wir, die US-Navy, haben Unterwasserdrohnen beigesteuert, deren Daten wurden dann in das Maple-System des Vereinigten Königreichs geladen und von da wieder den Portugiesen zur Verfügung gestellt, damit sie sich auf dieser Grundlage ein taktisches Bild machen und in Echtzeit Entscheidungen treffen konnten."
Game Changer - das Stichwort in aller Munde
Auf der Militärbasis in Troia ist immer wieder ein Wort zu hören: Game-Changer. Auch wenn alles noch ein wenig wie Science Fiction aussieht: Andrea Bell-Miller jedenfalls glaubt fest daran, dass sich die Art, wie wir Militäreinsätze sehen, radikal verändern wird:
"Ich glaube, dass es in zwanzig Jahren keine einzige militärische Operation geben wird, bei der nicht auf irgendeine Weise unbemannte Technik eingesetzt wird. Wir wissen, dass unsere Feinde dasselbe machen, das heißt, wir müssen uns auch darauf vorbereiten, Angriffe unbemannter System abzuwehren. Es ist ein Game-Changer. Die Art, wie wir Kriege in Zukunft führen werden, wird anders sein."