
Berlin, Stresemannstraße. Hier steht eine Ruine des Anhalter Bahnhofs. Der war während der NS-Zeit ein Ort der Judendeportation. Eine Straße weiter: die Topographie des Terrors, wo sich einst die Zentralen von Gestapo und SS befanden. Heute ist das eine vielbesuchte Gedenkstätte in der Hauptstadt. Nur wenige Gehminuten entfernt: das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas. In diesem Quartier erinnern viele Orte an Nationalsozialismus, Holocaust und Weltkrieg.
"Also insofern sind wir umgeben von Geschichte und wir setzen uns auch in Bezug dazu." Das sagt die Frau, die in dieser Nachbarschaft nun die Türen zu einem weiteren Erinnerungsort öffnen wird. Gundula Bavendamm ist Direktorin der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung.
Im Deutschlandhaus am Anhalter Bahnhof hat sie mit ihrem Team ein Dokumentationszentrum mit Dauerausstellung eingerichtet: Hier geht es um Flucht, Vertreibung, Zwangsmigration, wobei das Schicksal der 12 bis 14 Millionen Deutschen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat verlassen mussten, einen Schwerpunkt darstellt.
Am 21.06.2021 kommt die Bundeskanzlerin zum Festakt, ab Mittwoch wird das Haus für die Öffentlichkeit zugänglich sein, der Eintritt ist frei. "Und damit schließen wir eine Erinnerungslücke, denn bisher hat es ein solches Dokumentationszentrum zu diesem Thema Flucht und Vertreibung nicht gegeben."

Streitbares Projekt von Anfang an
Gundula Bavendamm steht im Foyer des Dokumentationszentrums. Das Deutschlandhaus aus den 1930er-Jahren wurde von den österreichischen Architekten "MarteMarte" durch einen Neubau ergänzt: Sichtbeton, Terrazzo-Böden, Lichtfugen. Sanierung und Umbau haben gut 60 Millionen Euro gekostet.
Auf 5.000 Quadratmetern gibt es nun eine Bibliothek mit Angeboten zur Familienforschung, ein Zeitzeugenarchiv, einen Raum der Stille, außerdem Platz für Veranstaltungen und Sonderausstellungen. Herzstück des Dokumentationszentrums ist aber die Dauerausstellung.
"Unsere große Aufgabe war ja qua Stiftungsgesetz, aber auch aus der Stiftungskonzeption, dieses Thema Flucht und Vertreibung der Deutschen am Ende des Zweiten Weltkriegs einzubetten in die Kontexte, zum einen der Kontext der nationalsozialistischen Politik und zum anderen ein weiterer Kontext, nämlich der einer europäischen Geschichte der Zwangsmigration."
Die Gewichtung der historischen Kontexte führte in der Vergangenheit zu vielen Konflikten. Von Anfang an wurde über das Projekt gestritten. Das hatte auch mit der Urheberin der Idee zu tun: Erika Steinbach, eine kampfeslustige Politikerin, bis 2017 in der CDU, heute leitet sie die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung. Als Bundestagsabgeordnete und damals Präsidentin des Bundes der Vertriebenen (BdV) formulierte sie 1999 erstmals ihre Forderung nach einem "Zentrum gegen Vertreibungen", und sie machte daraus schnell eine überparteiliche Initiative, denn sie hatte den mittlerweile verstorbenen Sozialdemokraten Peter Glotz für ihre Idee gewonnen; er war Sudetendeutscher.
In einem Interview mit dem Deutschlandfunk erklärte sie einmal, worum es ihr ging: "Es soll eine Einrichtung sein, in der auf der einen Seite die Vertreibung der Deutschen sichtbar wird, auf der anderen auch gezeigt wird, dass das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert der Vertreibungen gewesen ist, von dem Genozid und der Vertreibung des armenischen Volkes zu Beginn des Jahrhunderts bis hin zu der Vertreibung der Kosovo-Albaner und heute umgekehrt das, was die Kosovo-Albaner den Serben in ihrem Land antun. Zu zeigen, dass Vertreibung kein Mittel von Politik sein darf."

Kritiker witterten Geschichtsrevisionismus
Ein Zentrum gegen Vertreibungen, mitten in Berlin: Kritiker, vor allem in Polen und Tschechien, sahen darin einen revisionistischen Versuch das Leid der deutschen Heimatvertriebenen in den Mittelpunkt zu rücken und die deutsche Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust abzuschwächen. Obendrein war Erika Steinbach besonders in Polen eine verhasste Feindfigur, seit sie 1991 als CDU-Abgeordnete gegen die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze gestimmt hatte. Das sei ein wunder Punkt für die Polen gewesen, sagt Krysztof Ruchniewicz, Professor für Geschichte an der Universität Breslau.
"Für uns Historiker ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Geschichte im Schema Ursache-Wirkung dargestellt wird."
Doch bei den anfänglichen Planungen zu dem Projekt habe er, was dieses Verhältnis von Ursache und Wirkung betrifft, seine Zweifel gehabt:
"Vor allem entstand der Eindruck, dass die Vertreibung der Deutschen im Vordergrund steht, dagegen andere Vertreibungen, die davor stattgefunden haben und auch das Schema Ursache-Wirkung, der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und die Vertreibungen als Folge des vom NS-Deutschland verursachten Krieges, dass das nicht entsprechend dargestellt wird."
Die damalige Große Koalition übernahm die Konzeption für das "Zentrum gegen Vertreibungen" dann auch nicht, entschied aber 2005, in Berlin ein so genanntes "sichtbares Zeichen" zu setzen; und drei Jahre später beschloss der Bundestag die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Das sei eine kluge Entscheidung gewesen, meint der Historiker Matthias Stickler, Professor an der Universität Würzburg. Zu seinen Forschungsgebieten gehört die Geschichte der deutschen Heimatvertriebenen:
"Die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung war ja auch ein politischer Kompromiss, als der Bund gesagt hat, er nimmt das in die Hand. Und es wird eben nicht das Zentrum gegen Vertreibungen verstaatlicht, sondern das passiert in Eigenregie des Bundes gemacht worden."
Als überparteiliches Projekt gedacht
Das Dokumentationszentrum sollte eben kein BdV-Museum werden, keine übergroße Heimatstube. Der Vertriebenenverband sollte nicht allein oder federführend für diesen umstrittenen Teil deutscher Erinnerungskultur zuständig sein.
"Das ist jetzt kein Projekt, das ein bestimmter Verband anschiebt und das der Bund einfach finanziert. Sondern das ist ein Projekt der Bundesrepublik Deutschland unter der Beteiligung unterschiedlicher Gruppen."
Tatsächlich war heftig darüber gestritten worden, wie mächtig der BdV, der Bund der Vertriebenen, innerhalb der Stiftung wird. Bei der Gründung ging es um die Frage, ob Erika Steinbach, die in Polen als untragbar galt, einen Sitz im Stiftungsrat bekommt. Sie bekam ihn nicht. Allerdings wurden dem BdV sechs von 21 Sitzen zugesprochen: neben Vertretern aus Bundestag und Kabinett, den beiden großen Kirchen und dem Zentralrat der Juden.

Fakt ist: Ohne den Bund der Vertriebenen und Erika Steinbach gäbe es diese Stiftung und die heutige Ausstellung vermutlich nicht. Steinbachs Nachfolger an der Spitze des BdV ist Bernd Fabritius, CSU-Bundestagsabgeordneter und Siebenbürger Sachse, der als Spätaussiedler nach Deutschland kam.
Das Dokumentationszentrum mit der Dauerausstellung über Flucht und Vertreibung ist auch aus seiner Sicht ein bisher fehlendes Element in der deutschen Erinnerungskultur: "Hier geht es eben in dieser Ausstellung um Menschen, die nach dem Kriegsende Rache erlebt haben, die ein Unrecht erlebt haben, das nach heutigen Wertmaßstäben ganz eindeutig Verbrechen darstellt. Und ich denke, dass es deshalb selbstverständlich legitim ist, wenn ein Land, gerade wenn es so mustergültig mit den eigenen Schattenseiten umgeht, auch die eigenen Opfer empathisch in Erinnerung halten darf."
Zwangsmigration in der Moderne
Im Deutschlandhaus herrscht wenige Tage vor der Eröffnung des Dokumentationszentrums eine geschäftige Stimmung letzter Vorbereitungen. Mitarbeiter testen den Audioguide, es werden Schaukästen festgeschraubt, Objekte ausgerichtet.
"Jetzt sind wir in der ersten Etage angekommen und sind am Beginn der ständigen Ausstellung." Stiftungsdirektorin Gundula Bavendamm zeigt den ersten Teil der Dauerausstellung: Hier geht es um Zwangsmigration im europäischen und auch internationalen Kontext, erzählt und dargestellt nicht chronologisch, sondern anhand unterschiedlicher Themeninseln und Diskurse, wie etwa: "Krieg und Gewalt" oder "Erinnerung und Kontroverse".
So erfährt man hier etwas über die Teilung von Britisch-Indien 1947 in Pakistan und Indien und die anschließende Deportation von Millionen Menschen: Muslimen nach Pakistan, Hindus nach Indien. Auch der griechisch-türkische Bevölkerungsaustausch 1923 wird aufgegriffen.
Es gehe darum, Zwangsmigration als modernes Phänomen vor allem des 20. Jahrhunderts zu zeigen, erklärt Gundula Bavendamm: "Insbesondere mit dem Konzept des ethnisch homogenen Nationalstaats, also dieser Idee, dass es wichtig sein könnte, dass auf einem Staatsgebiet ein kulturell möglichst einheitliches Staatsvolk lebt. Und alle Menschen, die dieses Bild stören, insbesondere Minderheiten, werden häufig diskriminiert oder verfolgt über Jahre oder Jahrzehnte, und dann sind es in der Regel Kriege und bewaffnete Konflikte, die die Gelegenheiten schaffen, solche Nationalitäten und Bevölkerungsgruppen eben zu vertreiben."
Ein Mantel von 1945, das Smartphone eines Syrers
In diesem Kontext steht auch das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen, das hier etwa anhand eines Mantels erzählt wird: "Wir sehen einen Fellmantel, in den ein kleiner Junge namens Eitel Kuschorrek im Winter 1945 von seinen Eltern eingehüllt wurde, um die wochenlange Flucht über die Ostsee zu überstehen. Er hat diese Flucht überlebt, seine Mutter nicht. Er hat diesen Mantel dann aufbewahrt, wie seinen Augapfel gehütet und hat sich vor einigen Jahren eben entschlossen, ihn in unsere Sammlung zu geben."
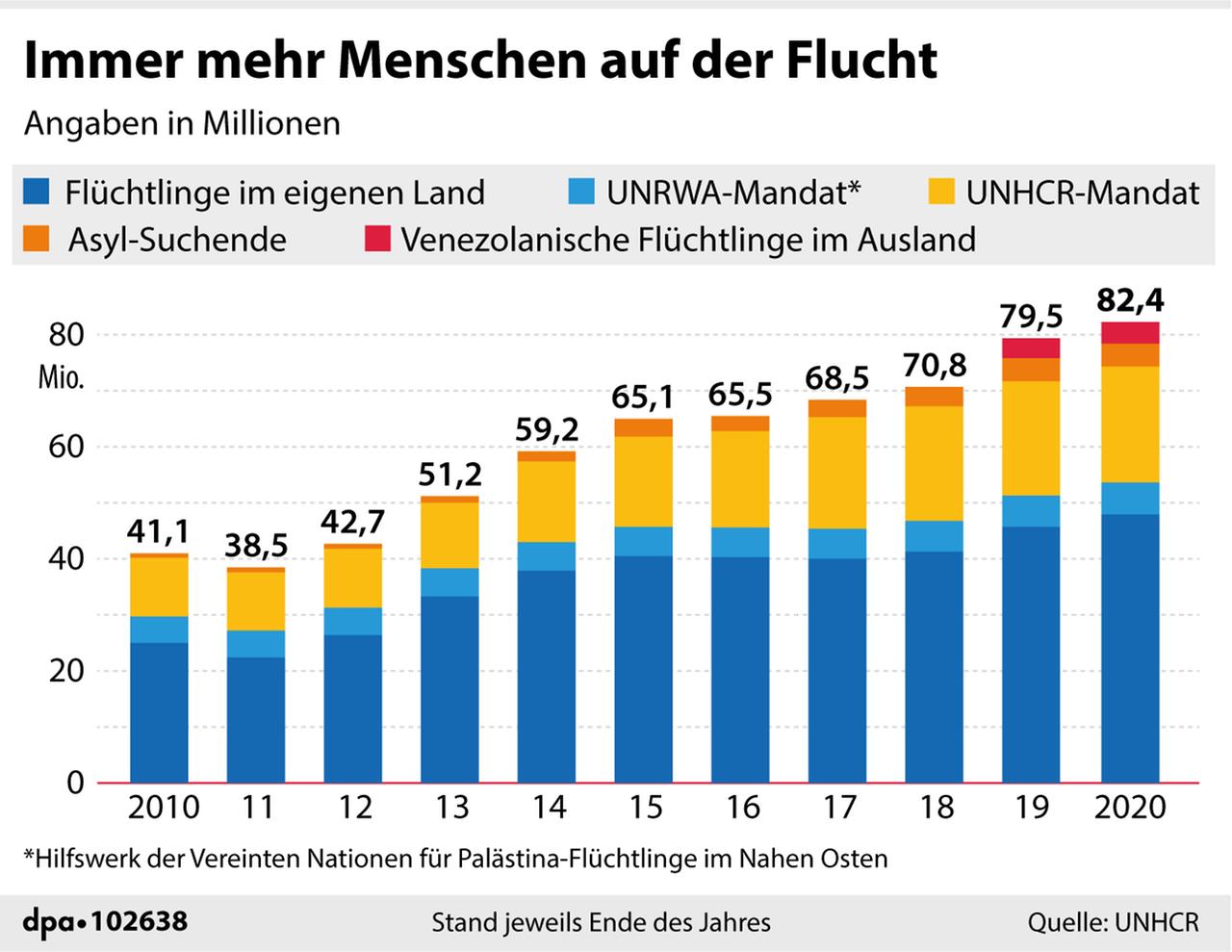
Hinter den nackten Zahlen von Vertriebenen steckten eben Einzelschicksale, sagt die Direktorin: "Das ist ein Hauptanliegen dieser ständigen Ausstellung, möglichst viele konkrete Menschen zu porträtieren, ihre Wege zu porträtieren, ihre Verlusterfahrungen deutlich zu machen, ihr Leid zu benennen, und damit meinen wir wirklich alle. Das ist nicht reserviert für die Deutschen."
Es wäre unglaubwürdig gewesen, betont die Historikerin, ein solches Haus zu eröffnen, ohne über die Kriegsflucht aus Syrien zu sprechen. Deshalb findet man hier etwa eine Schwimmweste aus Lampedusa und aus Müll gebastelte Spielzeuge syrischer Flüchtlingskinder. Ein aus Damaskus geflohener Mann hat der Stiftung sein Smartphone überlassen: Anhand der Bilder, die er auf der Flucht gemacht hat, lässt sich sein Weg an einer Medienstation rekonstruieren.
Am NS-Teil der Ausstellung führt kein Weg vorbei
Über eine imposante Wendeltreppe geht es zum zweiten Teil der Ausstellung. Hier wird Flucht und Vertreibung im Kontext nationalsozialistischer Politik gezeigt. Und es wird gleich klar: Wer sich mit dem Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen beschäftigen will, der kommt in diesem Haus um Vernichtungspolitik und Nazi-Herrschaft nicht herum.
"Während man unten frei wählen kann, welche Themeninsel interessiert mich am meisten, wird man hier durch die Ausstellungsarchitektur gelenkt und geht erst in die nationalsozialistische Zeit, befasst sich mit der Verfolgung, Diskriminierung und Vertreibung der deutschen Juden, wir gehen ein auf den Zweiten Weltkrieg, den Deutschland begonnen hat, auf die verbrecherische Besatzungsherrschaft Deutschlands in Europa, auch auf den Holocaust, um dann überzuleiten zur Planung der Alliierten für die Vertreibung der Deutschen. Und dann kommen wir in die klassischen Kapitel wie Flucht, die großen Vertreibungswellen und auch noch die Integrationsgeschichte."
Ein Leiterwagen von Banater Schwaben, ein abgewetzter Teddybär, eine hastig abgebrochene Stick-Arbeit, weil jemand seine Heimat überstürzt verlassen musste - mit solchen Exponaten werden konkrete Biografien nachgezeichnet und in den politischen Zusammenhang gestellt.
Es geht auch um Begriffe: dass die Flucht vor der heranrückenden Front etwas anderes war als erzwungene Vertreibungen. Auf der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 sprachen die Alliierten von der "ordnungsgemäßen Überführung deutscher Bevölkerungsteile" aus den früheren Ostgebieten. In der DDR bezeichnete man die Vertriebenen später als Umsiedler: "Das ist ein beschönigender Begriff für Vertreibung. Und die Menschen hatten sich einfach einzugliedern in die sozialistische Gesellschaft."

Ringen um "ausgewogene, differenzierte Darstellung"
Gundula Bavendamm hat die Leitung der Stiftung vor fünf Jahren übernommen - und damit Deutschlands wohl schwierigsten geschichtspolitischen Posten. Damals war die Stiftung von Skandalen erschüttert worden: der Gründungsdirektor geschasst, ein anderer zurückgetreten, bevor er überhaupt angefangen hatte. Ein wissenschaftlicher Beraterkreis, der sich von der Politik gegängelt fühlte, weshalb viele Mitglieder das Gremium verließen.
Bavendamm hat das Dokumentationszentrum nun weitgehend geräuschlos und fast ohne negative Schlagzeilen aufgebaut. Das Ausstellungskonzept wurde einstimmig vom Stiftungsrat verabschiedet. Vor einem Debattensturm fürchte sie sich nicht, sagt die Historikerin.
"Ich habe keine nennenswerten Signale bekommen in diesen letzten Jahren, dass nun das große Gewitter über uns hereinbricht. Ich kann es mir auch schwer vorstellen, denn wir haben so sehr gerungen, um eine ausgewogene, differenzierte Darstellung, dass ich überzeugt bin, dass wir einen wirklich überzeugenden Kurs der Mitte anbieten, in dem sich sehr viele wiederfinden können."
Die Vertreibung von 12 bis 14 Millionen Deutschen am Ende des Zweiten Weltkriegs und der Verlust der Ostgebiete markieren eine tiefe Zäsur in der deutschen Geschichte. Dass den Schicksalen der Heimatvertriebenen ein fester Platz in der öffentlichen Erinnerungskultur zusteht, gilt mittlerweile als unumstritten.
"Deswegen glaube ich, tut die deutsche Gesellschaft sich einen Gefallen, wenn sie das thematisiert. Und zwar nicht im Wege nationaler Nabelschau, sondern in einer Offenheit, also vor dem Hintergrund der Gesamtgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts, Stichwort: Jahrhundert der Vertreibung. Aber auch mit Blick auf heutige Konflikte, um Flucht und Vertreibung, das Thema ist ja nach wie vor da", sagt der Geschichtsprofessor Matthias Stickler, der anfangs auch im wissenschaftlichen Beraterkreis der Stiftung mitwirkte.

Aufmerksam beobachtet in Osteuropa
Besondere Aufmerksamkeit dürfte die Ausstellung im osteuropäischen Ausland erhalten. Verbunden mit der ewigen Sorge, die Deutschen könnten hiermit ihre Verantwortung relativieren wollen.
"Ich denke, dass diese Angst zumindest zum großen Teil innenpolitisch instrumentalisiert und motiviert ist", sagt BdV-Chef Bernd Fabritius. "Wenn in den Nachbarländern diese Angst einer Geschichtsumschreibung plakativ instrumentalisiert wird, dann steckt darin vielleicht auch ein Stückchen eigene Verweigerung, die dunklen Seiten in der eigenen Geschichte ebenfalls so ehrlich anzunehmen, wie Deutschland das getan hat."
Krysztof Ruchniewicz, der Historiker und Deutschlandforscher aus dem polnischen Wroclaw, der den wissenschaftlichen Beraterkreis der Stiftung 2015 aus Protest verließ, gibt allerdings zu bedenken, dass bis heute in der deutschen Öffentlichkeit zu wenig über das Schicksal der Polen bekannt sei, über ihre Vertreibung und Umsiedlung und die Verschiebung der polnischen Grenzen im Zuge des Zweiten Weltkriegs.
"Das ist auch meine Beobachtung, und es ist in der Tat schwierig, mit einem Durchschnittsdeutschen darüber zu diskutieren. Praktisch hat er keine Ahnung davon. Das drückt sich auch in dem Begriff Vertreibung aus, weil damit dann nur die Deutschen gemeint sind und nicht andere Vorgänge. Es ist wichtig für uns, an alle diese Vertreibungen zu erinnern und diese Vertreibungen im historischen Kontext zu sehen."
Die Ausstellung in Berlin werde er sich jedenfalls anschauen, sagt Ruchniewicz. Er sei gespannt, wie das Konzept umgesetzt wird.

Ausstellung für Publikum mit wenig Vorwissen
Wer sonst soll sich diese Ausstellung ansehen?
"Für diese Frage danke ich Ihnen ganz besonders. Die Ausstellung richtet sich nicht an die deutschen Heimatvertriebenen, auch nicht an die Aussiedler und Spätaussiedler. Die kennen ihr Schicksal. Wir müssen den deutschen Heimatvertriebenen nicht berichten, was sie erlebt haben. Die Ausstellung richtet sich an die gesamte bundesdeutsche Gesellschaft, sie richtet sich eigentlich an ein Weltpublikum, das in dieser Ausstellung erfahren soll, was ein Kreislauf von Verbrechen, von Rache und Gewalt und Unrecht mit sich bringt, und das ist wirklich eine der Hauptforderungen des Bundes der Vertriebenen der heutigen Zeit, nämlich die Anerkennung eines Heimatrechtes als Menschenrecht und eine weltweite Ahndung von ethnischen Säuberungen, ein Verbot von Vertreibungen als Mittel der Politik."
"Wir wünschen uns sein möglichst diverses, breites Publikum. Wir sind darauf eingestellt, dass viele Menschen kommen, die sehr wenig Vorwissen haben", sagt Gundula Bavendamm, die Stiftungs-Direktorin. Sie hofft, dass auch die Skeptiker kommen – und sich ein eigenes Bild machen. Im nächsten Jahr übrigens wird es die erste Sonderausstellung geben: Eine Schau aus dem Jüdischen Museum in Frankfurt am Main, über jüdische Erfahrungen von Flucht und Vertreibung in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Gundula Bavendamm weiß: Ohne Kontext geht in diesem Haus nichts.







