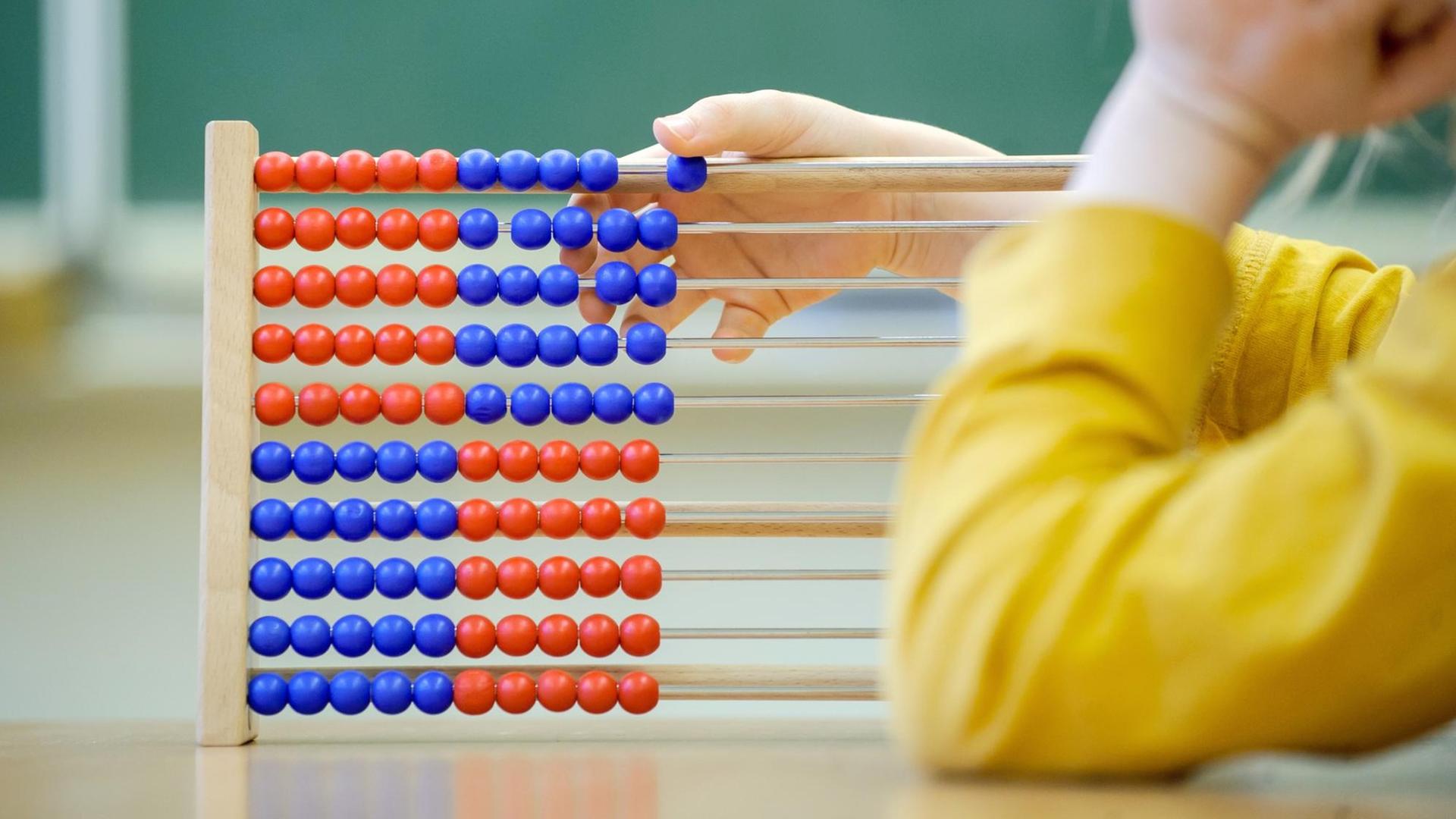Wer herausfinden will, was es Kindern bringt, wenn sie früh lernen, ein Musikinstrument zu spielen, müsste zufällig eine Reihe von ihnen auswählen: Die einen bekommen jahrelang Unterricht, die anderen nicht. Doch das ist nicht praktikabel. Stattdessen vergleicht man Kinder, die schon ein Instrument lernen, mit anderen, die keinen Musikunterricht haben. Und das beweist eigentlich gar nichts, sagt Glenn Schellenberg.
"Man findet all diese Zusammenhänge zwischen Musikunterricht und nichtmusikalischen Fähigkeiten. Aber das bedeutet nicht, dass die Übung einen klüger macht, die Sprachfähigkeiten oder das Gedächtnis fördert. Es wäre zwar möglich. Ich glaube allerdings, dass Kinder mit hohem IQ, die auch in einer ganzen Reihe anderer Tests besser abschneiden, einfach eher Musikstunden nehmen als andere."
Interpretationsfehler in 144 Studien seit 2000
Wissenschaftlich gesprochen: Man findet eine Korrelation, aber daraus darf man nicht auf Kausalität schließen. Der kanadische Psychologe wollte wissen, wie häufig Musikforscher diesen Fehler machen. Er fand 144 seit dem im Jahr 2000 erschienenen Studien von Psychologen und Neurowissenschaftlern, die einen Zusammenhang zwischen Musikunterricht und einer außermusikalischen Fähigkeit fanden.
Das interessante Ergebnis: Während die Psychologen bei der Hälfte der Arbeiten behaupteten, das musikalische Training sei die Ursache dafür, waren es bei den Neurowissenschaftlern sogar drei von vier. Gerade die Hirnforscher, die sich immer so empirisch und objektiv geben und ihre Ergebnisse mit bunten Scan-Bildern dokumentieren, zogen also besonders häufig diesen logischen Fehlschluss.
Keine Beweise für Transfer von Fähigkeiten
Die Hirnforschung erklärt uns immer häufiger, dass jeder sein Gehirn durch Übung verändern kann, so wie sich ein Muskel durch Gewichtstraining verändert. Tatsächlich wächst zum Beispiel bei Geigern die Hirnregion, die für die Feinmotorik der linken Hand zuständig ist, mit der sie die Töne auf dem Instrument greifen. Problematisch ist die Behauptung eines Transfers – also dass die Übung Auswirkungen auf Fähigkeiten hat, die mit Musik nichts zu tun haben.
"Wir alle finden diesen Transfer von Fähigkeiten irgendwie plausibel. Aber wenn man ihn wirklich im Labor studieren will, dann funktioniert er nur mit Fähigkeiten, die sehr, sehr ähnlich sind. Dieser weite Transfer, etwa von Musikunterricht auf räumliches Vorstellungsvermögen - dafür gibt es einfach keine Beweise, das ist praktisch unmöglich."
Neurowissenschaftler behandeln Gehirn als leeren Speicher
Neurowissenschaftler, so lautet Schellenbergs Vorwurf, behandelten das Gehirn als eine tabula rasa, einen leeren Speicher, den man beliebig mit Fähigkeiten füllen könne. Begriffe wie Talent, Veranlagung, Charakter seien ihnen fremd – dabei fänden neuere Studien immer mehr Anzeichen für erblich angelegte Voraussetzungen zum Lernen. Könnte es nicht sein, dass die Gehirne von Kindern, die ein Instrument lernen wollen, sich schon vorher von denen unterscheiden, die das nicht interessiert?
"Ich habe schon mehrfach in psychologischen Studien nachgewiesen, dass Musiker und Nichtmusiker sich auf mehreren Ebenen unterschieden. Und diese Unterschiede waren schon da, bevor sie mit dem Üben angefangen haben. Es geht um unterschiedliche Persönlichkeiten. Und die müssen ja auch irgendwo im Gehirn verankert sein. Neurowissenschaftler sagen gerne: Persönlichkeit, das geht mich nichts an. Aber die steckt doch nicht im Knie!"
Die meisten Musikforscher sind selber Musiker – und glauben fest, dass Musik auf vielen Ebenen förderlich ist. Aber diese Voreingenommenheit darf ihre Forschung nicht beeinflussen, davon ist Glenn Schellenberg überzeugt. Sonst wäre das keine Wissenschaft, sondern eine Art Religion.
Die meisten Musikforscher sind selber Musiker – und glauben fest, dass Musik auf vielen Ebenen förderlich ist. Aber diese Voreingenommenheit darf ihre Forschung nicht beeinflussen, davon ist Glenn Schellenberg überzeugt. Sonst wäre das keine Wissenschaft, sondern eine Art Religion.