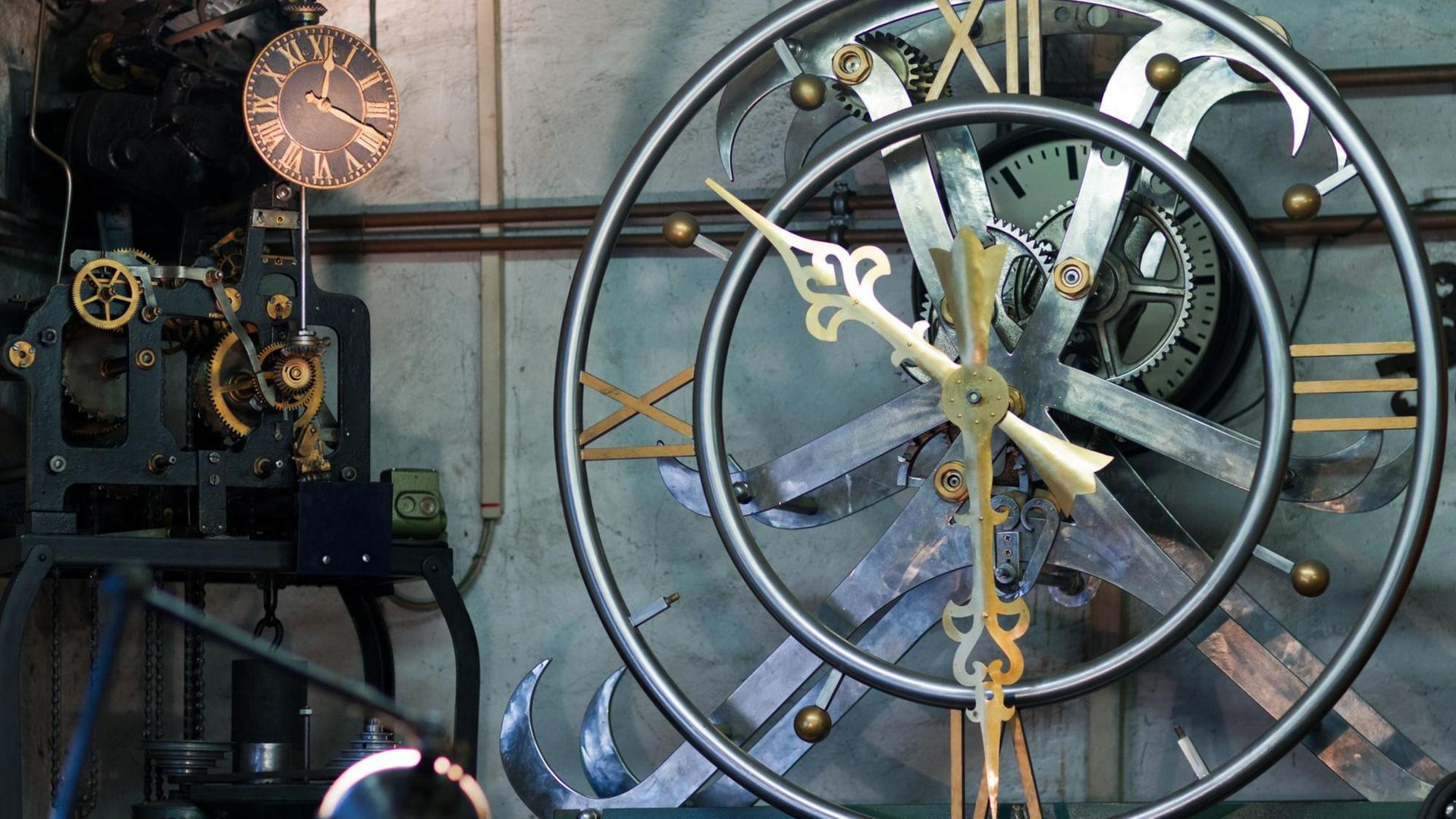Die Invercauld zerschellte am 11. Mai 1864 in einer felsigen Bucht im Nordwesten von Auckland Island. 19 der 25 Besatzungsmitglieder überlebten den Schiffbruch – doch nur drei konnten ein Jahr später von einem portugiesischen Schiff gerettet werden. Ganz anders das Schicksal der Besatzung der Grafton. Sie hatten vier Monate vor der Invercauld Schiffbruch erlitten, im Süden der Insel, und sie mussten sich zur gleichen Zeit durchschlagen. Von ihren fünf Besatzungsmitgliedern, die jeder aus einem anderen Land stammten, überlebten alle. Zwar hatte die Besatzung der Grafton noch Zeit gehabt, wertvolle Ausrüstungsgegenstände von Bord zu holen und mehr Nahrungsmittel. Doch der eigentliche Unterschied zwischen den beiden Gruppen sei ihre soziale Einstellung gewesen, schreibt Christakis: "Unter den Männern der Invercauld herrschte von Anfang an die Einstellung, dass jeder nur für sich kämpfte, während die Männer der Grafton zusammenarbeiteten." Während die Männern der Invercauld die ihrem Schicksal überließen, die zu schwach waren oder krank und es in einem Fall sogar zu Kannibalismus kam, hielten die der Grafton zusammen: Ihre Führung war uneigennützig, der Gemeinschaftsgeist hoch und man beschäftigte sich, in dem man sich gegenseitig die Sprachen beibrachte und Mathematik.
Wie entstehen stabile Gemeinschaften?
Für den Soziologen Nicholas Christakis, der das Human Nature Lab der Yale University leitet, ist das Schicksal solcher Zufallsgemeinschaften, wie sie durch Schiffbruch entstehen, ein Ausgangspunkt für die Forschung, wie stabile Gemeinschaften entstehen. Welche kulturunabhängigen Faktoren gibt es dabei? Seine Überzeugung: Die Evolution hat uns über die Fähigkeit zu Liebe, Freundschaft, Engagement, Zusammenarbeit und Lernen mit einem Satz sozialer Verhaltensweisen und Neigungen ausgestattet, die uns in Richtung "gut" tendieren lassen. Die Fähigkeit und der Wunsch, Gruppen beizutreten ist sozusagen in den Genen festgeschrieben – und zwar so weitgehend, dass wir unsere eigene Individualität aufgeben und für diese Gruppe Dinge tun, die unseren persönlichen Interessen zuwiderlaufen. Unsere eigenen Gene, schreibt er, und die Gene unserer Freunde, sie scheinen zusammenzuarbeiten, um eine sicherere Welt zu erschaffen.
Das menschliche Genom beeinflusst die Produktion sozialer Systeme
Christakis schlägt in seiner Argumentation einen weiten Bogen: Er führt Freundschaften und enge soziale Beziehungen im Tierreich aus, beschäftigt sich mit komplexen Wechselwirkungen zwischen Genen und Kultur, erzählt eine Naturgeschichte der Liebe und der Paarbindung bis hin zu den Präriewühlmäusen. Der Autor schlägt vor, dass das menschliche Genom die Produktion sozialer Systeme beeinflusst. Sein Fazit: "Wir alle tragen eine evolutionäre Blaupause für die Schaffung einer guten Gesellschaft in uns."
Optimismus im Weltuntergang
Der Autor argumentiert leidenschaftlich – und ebenso subjektiv wie er es der "Gegenseite" vorwirft, die im Menschen den sprichwörtlichen Wolf des anderen Menschen sieht. Er ist ein ungeheuer optimistischer Mensch, der sicherlich – ganz in der Tradition Martin Luthers - trotz des Wissens, dass die Welt morgen untergeht, heute ein Apfelbäumchen pflanzen würde. "Blueprint" ist ein durchaus interessantes Buch, das einen gut zu lesenden und tiefen Einblick in die Sozialwissenschaften bietet. Ob man angesichts der real existierenden Welt und dem Muster von Gewalt, Ungleichheit und Instabilität in der vieltausendjährigen Geschichte der Menschheit seinen Optimismus zu teilen vermag, ist eine andere Frage. Und manchmal kann man sich als Leser des Eindrucks nicht erwehren, dass selbst der Autor sich hin und wieder verzweifelt bemühen muss, an seinem Optimismus festzuhalten.
Nicholas Alexander Christakis: "Blueprint – Wie unsere Gene das gesellschaftliche Zusammenleben prägen"
Aus dem Englischen übersetzt von Jürgen Neubauer
S. Fischer Verlag, 600 Seiten, 26 Euro
Aus dem Englischen übersetzt von Jürgen Neubauer
S. Fischer Verlag, 600 Seiten, 26 Euro