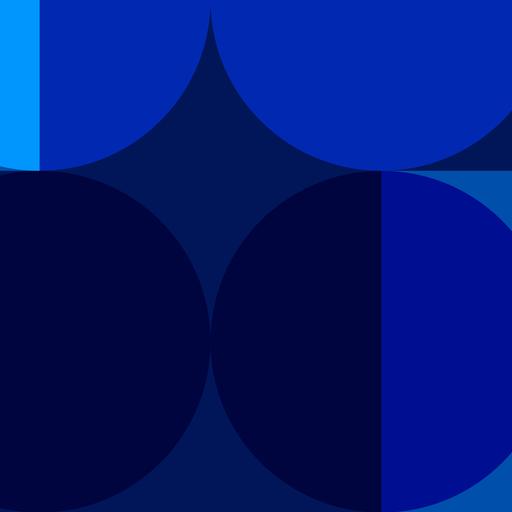In der Nacht hat es geschneit, etwa 20 Zentimeter sind aus dicken Wolken auf Berge und Täler herabgeschwebt. Jetzt, am Morgen, steigt die Sonne in einen prachtblauen Himmel über dem trapezförmigen Felsmassiv der Madrisa. Deren langer, auf beinahe gleicher Höhe verlaufender gezackter Gipfelgrat steigt bis 2.770 Meter an. Weiter unten funkeln die Schneekristalle auf bepuderten Tannen und mollig bedeckten Hängen. Gute Voraussetzungen also für einen schönen Skitouren-Tag, den wir von Gargellen aus, rund 1.400 Meter hoch gelegen, in einer Umlaufgondel der Schafbergbahn beginnen. Mir gegenüber sitzt Wolfgang, verwegenes gebräuntes Gesicht, langes silbergraues Haar und Vollbart, dazu eine weiß geränderte Sonnenbrille - Bergführer. Wolfgang verspricht einen gemütlichen Tag:
"Wir haben wenig Aufstieg, viel Abfahrt und vor allem grenzüberschreitend in das romantische St. Antönien auf der schweizer Seite, mit einem Einkehrschwung im Alpenhotel Rätia, einer wunderschönen alten Bauernstube. Dann führt uns ein Taxi zurück Richtung Klosters, zur Madrisa-Bahn. Dann genießen wir wieder einen sehr rasanten Aufstieg mit der Bahn. Eine wunderschöne Abfahrt, Richtung Schlappiner Joch, wieder einen dreiviertelstündigen leichten Aufstieg zum Joch. Und dann erwartet uns wieder eine sensationelle Tiefschneeabfahrt ins Vergaldatal Richtung Gargellen."
Ein traumhaftes Erlebnis, fügt er hinzu, mit 300 Metern Eigen-Aufstieg und 1.800 Metern Abfahrt – sehr interessant gerade für diejenigen, die mal eine Skitour ausprobieren wollten. Dazu die Bergkulisse: Rund 25 der schönsten Vorarlberger Gipfel stellt Wolfgang in Aussicht: Die Rätschenfluh mit der breitesten Wandflucht des Rätikon-Gebirges, die markanten Drei Türme der Drusenfluh oder der berühmte Piz Buin.
Nach der Gondel nehmen wir noch einen Sessellift und erreichen so ein breites, gefällig ansteigendes Hochtal, rund 700 Meter über Gargellen. Hier ziehen wir die Felle auf die Laufflächen der Skier und machen uns in einer kleinen Gruppe an den halbstündigen Anstieg zum St. Antönier Joch. Eine geschichtsträchtige Route, erzählt Wolfgang:
"Früher wurde über dieses Joch mit dem Graubünden, sprich den Einwohnern aus der Talschaft, reger Handel betrieben. Kaffee, Zucker, unter anderem auch Veltliner Rotwein gegen Hafer, Gerste. Also wir verwenden eigentlich schon einen uralten Übergang, den schon unsere Vorfahren seit dem 14. Jahrhundert verwendet haben."
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als die Grenzen militärisch befestigt wurden und Zollwachen den Handel erschwerten, kam das auf, was der Madrisa-Rundtour heute das abenteuerliche Flair verleiht: Das Schmuggler- bzw. Schwärzerwesen. Was auf schweizer Seite günstiger oder überhaupt zu bekommen war, vor allem Zigarren, Tabak, Salz, Zucker, Kaffee oder Fleisch, das wechselte versteckt, sozusagen bei Nacht und Nebel, die Ländergrenze - im Tausch zum Beispiel gegen Butter, wasserfeste Lodenhüte, Hosenträger oder Gummiband am Meter, erzählt der Gargellner Heimatforscher Friedrich Juen:
"Als Hütibub, als Hirte, ist man natürlich im Rätikon immer automatisch an der Grenze, und da hat man sich irgendwo auf dem Joch getroffen. Also der schweizer Hirte kommt, und dann hat der was mit’bracht, was der andere bestellt hat, und oben haben sie einfach den Rucksack getauscht und keiner von den Zöllnern hat vermutet, dass die Hirtenbuben da im kleinen Stil schmuggeln."
Daraus konnte auch ein Schmugglerring werden, bei dem es manch eine Familie durchaus zu ein bisschen Wohlstand brachte. Aber es gab auch andere Motive, fügt Juen hinzu:
"Es hat auch solche gegeben, die haben am Markt eine Kuh verkauft. Sind sie nachher ins Gasthaus und haben da fest getrunken und Karten g’spielt, und dann war der ganze Erlös von der Kuh weg. Und dann traut er sich eigentlich nicht mehr nach Hause und hat dann zwei drei Nächte schmuggeln müssen und hat es wieder verdient dabei."
Ganz ungefährlich war das Schwärzerwesen nicht. Bereits 1803 verfügte eine kaiserlich-königliche, kurz k.k., Hofkriegsräthliche Verordnung, dass in bestimmten Fällen die Wachen, so wörtlich, "einen Schwärzer auf der Stelle niedermachen können."
Als wir das schmale, rund 2.360 Meter hohe St. Antönier Joch erreichen, finden wir nur eine Tafel mit dem Hinweis auf die schweizer Grenze, aber weder ein Zollhäuschen, geschweige denn einen Grenzbeamten. Der letzte verabschiedete sich 2002 in den Ruhestand.
Ein Blick in das sonnenbeschienene Tal, das sich Richtung St. Antönien, etwa 900 Höhenmeter tiefer, erstreckt, löst reine Vorfreude aus. Ungespurter, lockerer Pulverschnee wartet auf uns.
Wir tauchen mit den Skiern in den weichen Schneeteppich, schwingen mal über breite Hangflächen, mal durch eine besonders schneereiche, komfortable Rinne. Dann folgen wir einem etwa 80 Meter breiten Rücken, der sich in der Talmitte hinunterzieht. Das ist sicherer, erläutert der alte Bergführer Horst und zeigt auf Schneeabgänge an den Talflanken:
"Du siehst da sehr deutlich links, an der Südseite, die stark ausgeprägten Nassschneerutsche schon, und auf der rechten Seite die eher staubartigen Lawinen. Die sind aufgrund der Schneemenge jetzt natürlich geringer, aber die können, da wenn wir’s jetzt in der weiteren Lage da oben beobachten, da reicht der Rücken sehr nahe dem Mittelrücken, da kommt es schon vor, dass die Staublawine drüber geht. Aber wichtig ist immer, in der Mitte bleiben, da ist die Sicherheit relativ sehr groß."
- Und die Lawinenstufe sollte nicht über drei liegen. Das gilt vor allem, wenn man sich im Aufstieg befindet, also ungleich langsamer im Gelände unterwegs ist.
An einer alten urigen Maisäss-Hütte auf etwa 1.800 Metern machen wir einen Trink-Halt. Im Mai, daher der regionale Begriff, treiben die Bauern ihr Milchvieh für den Sommer hier herauf. Die Maisäss-Hütte muss bereits gestanden haben, als die Hochzeit des Schmugglerwesens begann. Das war im Ersten Weltkrieg, erläutert der Leiter der Montafoner Museen, Michael Kasper:
"Und dann, eben in dieser ganzen Zwischenkriegszeit, zwischen 1918 und 1938, mit hoher Arbeitslosigkeit, da ist es dann wirklich überlebenswichtig für viele, dass sie eben diese Einnahmen aus dem Schmuggel für die Familie lukrieren können."
Aufs Lukrieren, also das Beschaffen, verstand sich am besten Meinrad Juen, der König der
Schwärzer, Großonkel von Friedrich Juen:
"Meinrad isch natürlich ein ganz ein außergewöhnlicher Mensch g’wesen, der sehr schwierig zum Einschätzen war. Also, der hat eigentlich immer das g’macht, was man net von ihm vermutet hat. Ich will jetzt net sagen, eine Ikone, aber jeder im Montafon kann irgendwas vom Meinrad erzählen."
Meinrad hat sehr gute Netzwerke gehabt und sogar ein großes, natürlich illegales Warenlager, sagt die Kulturwissenschaftlerin Edith Hessenberger, die in ihrem Buch "Grenzüberschreitungen" die Montafoner Vergangenheit mit Legenden und Tatsachen sorgfältig und interessant erzählt:
"Von Unterhosen über Stoffballen, über Fernstecher, ich glaub‘ sogar über Waffen, hat man alles Mögliche bei ihm bekommen. Er hat auch Dienste angeboten, die sonst sich andere nicht getraut haben, wie zum Beispiel dieses Schwarzmetzgern."
Gerade mit diesem illegalen Schlachten hat Meinrad es verstanden, sich und die Familie selbst in den besonders kargen Kriegsjahren gut zu versorgen. Mehr noch, er hat damit in der NS-Zeit auch die deutschen Offiziere bestochen.
Diese Beziehung zu den NS-Vertretern zahlte sich für ihn als eine Art Lebensversicherung aus, als zunehmend Menschen kamen, die der Naziherrschaft in die Schweiz zu entkommen suchten - über das naturgemäß schwierig zu bewachende Gebirge. Sie brauchten dafür ortskundige Fluchthelfer. Laut einem Gendarmen-Bericht hat Meinrad neben einigen Deserteuren allein 42 Juden im Schutz der Nacht in die Freiheit geholfen. Gelegentlich bat er seinen gewieften Bruder Wilhelm mitzugehen, früher Wilderer, dann Jagdaufseher, der Großvater von Friedrich Juen:
"Ja, da gibt’s die Geschicht‘, dass einem so ein Stein weg ist, und mein Großvater dann in die Hosentasch‘ g‘riffen hat, kleine Ziegenglocke g’läutet hat. Und da ha‘m die Zöllner g’meint, ja, da sind irgendwo Schafe oder Ziegen entlaufen. Einige Meter weiter ist wieder ein Stein runter, da hat er in die andere Hosentasche g’riffen und hat ein anderes Glöckchen raus, mit einem höheren Ton und hat nochmal g’läutet. Und dann haben die Zöllner schon wieder die Ohren g’spitzt und ‘denkt: Ja, ja, da sind halt mehrere Schafe entlaufen."
Meinrad soll eine üppige Bezahlung eingestrichen haben. Dafür war er ehrlich und zuverlässig. In der Kirche von Sankt Gallenkirch, wenige Kilometer unterhalb von Gargellen, erinnert eine Gedenktafel an einen jungen Deserteur, der von seinem Schlepper heimtückisch verraten und erschossen wurde.
Eines Tages passierte es doch: Meinrad wurde verhaftet. Bei einer jüdischen Familie in Wien hatte man seinen Namen gefunden. Auf Fluchthilfe stand die Todesstrafe. Meinrad bat den Gendarmen, sich noch von der Schwester Ludwina verabschieden zu dürfen - und entkam bei der durchs Klofenster. So die offizielle Darstellung. Tatsächlich dürfte Meinrad seine geschäftlichen Verbandelungen genutzt und die Flucht mit dem Gendarmen abgesprochen haben.
Zurück in die Gegenwart. Wir steigen wieder auf die Skier und setzen die Abfahrt über etliche Wiesen und eine zugeschneite Straße nach St. Antönien fort. Es zeigt sich, dass weiter unten die Neuschneelage doch geringer ausgefallen ist. Beim Schwingen schaben die Kanten über den verharschten Altschnee, lässt sich seine feste Decke spüren.
Eine halbe Stunde später stehen wir vor dem schönen kleinen Kirchturm des typischen Walserdorfs aus dem 15. Jahrhundert. Daneben passend ein Gasthaus mit alter Bauernstube, der wir aber doch die Terrasse im Sonnenschein vorziehen.
Mit einem Taxi wechseln wir ins 15 Kilometer entfernte Klosters. Von dort steigen wir wieder mit Umlaufgondel, Sessel- und Schlepplift bis auf über 2.600 Meter auf, fast bis an den Felsfuß des rund 200 Meter höheren Madrisa-Horns, auch Schweizer Madrisa genannt.
Wie queren mit wunderbaren Pulverschnee-Schwüngen durch sanft gewelltes Gelände, gelegentlich vorbei an wuchtigen Felsbrocken, 500 Höhenmeter abwärts ins Schlappin Tal hinein. Dann fellen wir wieder auf und ziehen vor dem winterlichen Panorama von Davoser Jakobshorn bis Silvretta-Gruppe in einer halben Stunde hoch zum breiten Schlappiner Joch.
Vor rund einhundert Jahren wären wir hier oben vielleicht dem Klusthöny begegnet, einem der wenigen schweizer Schmuggler. Während des Ersten Weltkriegs soll er sogar das österreichische Heer mit Autoreifen versorgt haben. Einmal ist er bei einem Gang nach Schruns in Gargellen von zwei Zöllnern erwischt worden. Da hat er die beiden überredet, wenigstens noch mal im Hotel Madrisa gemeinsam gut essen zu gehen, bevor sie ihn einsperrten, erzählt Friedrich Juen:
"Dann hat er g’sagt: ‘Ja, ich zahl das auch‘. Und dann sind die Zöllner da mit’gangen. Und denn hat er g’sagt, ja, er muss noch aufs Klo. Und sie haben ihn dann nur noch irgendwo im Wald gesehen verschwinden, Richtung Schweiz. Sind auch in den Wald rein g’sprungen Richtung Schlappiner oder St. Antönier Joch und haben ihn da g’sucht. Und der Thöny hat si‘ im Wald a Weil lang versteckt, isch dann zurück in die Madrisa, hat fertig gegessen und isch dann seelenruhig nach Schruns g’laufen."
Es sind übrigens auch Frauen mit Schmuggelgut unterwegs gewesen. Und gewitzt waren sie nicht weniger als die Männer. Dass sie in der Chronik gerne übersehen werden, liege am Selbstverständnis, erklärt Edith Hessenberger:
"Männer haben da eher das Verständnis dafür, was an ihrer Geschichte interessant sein könnte, während Frauen gerade in dieser Generation, also Anfang des 20. Jahrhunderts geboren, sehr leicht ihr Licht unter den Scheffel stellen und in Bescheidenheit zurücktreten und sagen, sie hätten eigentlich nichts Besonderes zu erzählen. Dazu kommt einfach auch noch, dass viele Geschichtsschreiber männlich waren, und der Fokus dann auch auf den männlichen Erzählungen liegt, die natürlich auch viel, viel spektakulärer inszeniert werden."
Unsere Abfahrt vom Schlappiner Joch zurück ins 800 Meter tiefer gelegene Gargellen bietet noch einmal jede Menge Genuß-Schwünge. Unten angekommen sind sich Daniela und Luzia ganz einig:
"Super toll war’s!" – "Ein Traum, Wahnsinn!"
In wenigen Stunden haben wir die Madrisa umrundet. Von der Grenze haben wir überhaupt nichts mitbekommen. Sie scheint heute keine Bedeutung mehr zu haben. Edith Hessenberger widerspricht:
"Es ist ganz interessant, dass in der Wahrnehmung der Menschen die Grenze aus der Zeit des Nationalsozialismus, die eine lebensrettende Grenze war für viele Menschen, dass die so wenig in den Erzählungen oder in der öffentlichen Wahrnehmung in Bezug gesetzt wird zu den Grenzen, die heute so eine große Rolle spielen. Also diese Diskussion, erscheint mir persönlich, wird sehr weit weg geschoben, weil einfach die Menschen durch die Situation, durch die globalen Migrationsbewegungen, durch die Fluchtbewegungen sicher überfordert sind."
Vor fünf Jahren ist in Gargellen das interaktive Wander-Theater "Auf der Flucht" inszeniert worden. Die Schauspieler flohen mit den Zuschauern durch den Wald der rettenden Grenze zu und ließen sie dabei die Situation am eigenen Leib erfahren. Als einmaliges Ereignis geplant, wird es im kommenden Sommer bereits in der fünften Saison aufgeführt. Auch Friedrich Juen nimmt als Erzähler daran teil:
"Bei uns wird aber keiner zurückgelassen. Alle haben das Recht auf die Flucht. Und dann gibt’s natürlich viele Szenen, die tief unter die Haut gehen, da fließen auch Tränen… "
Edith Hessenberger beendet ihr Buch "Grenzüberschreitungen" mit einem Zitat des österreichischen Schriftstellers Karl-Markus Gauß:
"An die Stelle der vielen, die ausreisen wollten, es aber nicht durften, sind jene getreten, die einreisen möchten, es aber nicht schaffen."