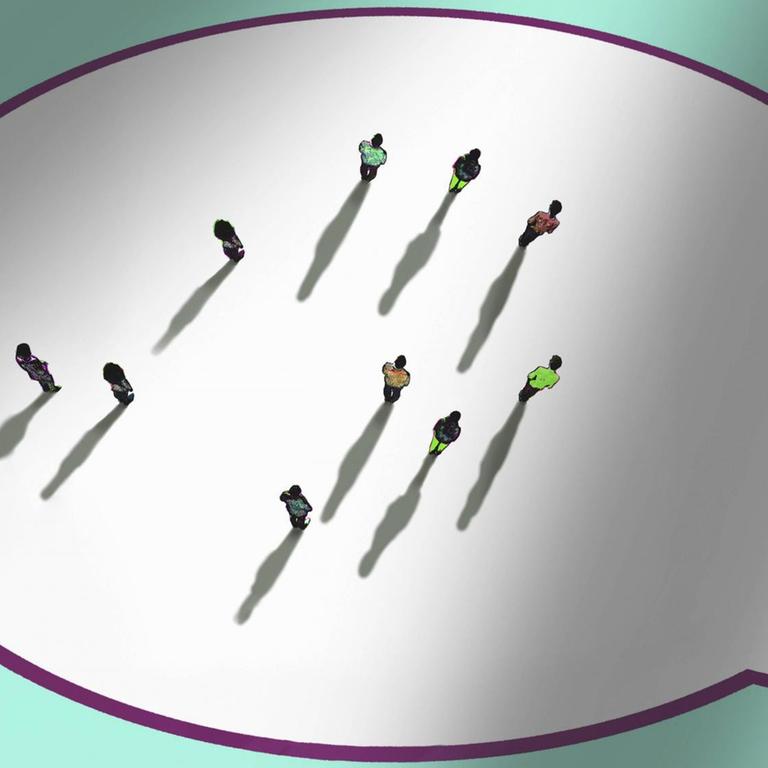"Ich bin mir sicher, auch jenseits von Politik, wird auch für die Gesellschaft, selbst für Virologen und Wissenschaftler, eine Phase kommen, wo wir alle feststellen werden im Nachhinein, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle falsch gelegen hat." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ahnte schon am Ende der ersten Welle, dass über die Corona-Politik noch einmal heftig zu streiten sein würde.
Der weitgehende Konsens, der an ihrem Anfang stand, konnte nicht von Dauer sein, bemerkt auch Stefan Gosepath, der sich als Philosophie-Professor an der FU Berlin mit Fragen von Gerechtigkeit beschäftigt: "Der erste Aufruf von Angela Merkel, die inzwischen vielleicht schon berühmte Ansprache, in der sie uns zur Solidarität aufgefordert hat und wo sie ja genau den richtigen Ton getroffen hat, ich glaube, da haben große Teile der Bevölkerung hinter der offiziellen Politik gestanden."
In dieser frühen Phase war eine breite Öffentlichkeit bereit, die Argumentation der Kanzlerin unmittelbar nachzuvollziehen: es gelte die Kurve der Infektionszahlen abzuflachen, damit die Intensivstationen in den Krankenhäusern nicht überlastet würden. Sogar Grundrechte einzuschränken, wie Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit oder Freizügigkeit, schien vertretbar, weil es um die Rettung von Menschenleben in großer Zahl ging.
Die Stimmung in der Bevölkerung schwankt
"Die Frage ist ja doch so existenziell, dass vielleicht am Anfang viele doch so zurückhaltend waren, was Kritik angeht." Der Potsdamer Historiker René Schlott war einer der ersten, die publizistisch protestierten, als etwa das Demonstrationsrecht zeitweilig außer Kraft gesetzt und Gottesdienste oder Reisen untersagt wurden. "Da würde ich aber sagen, es gab nicht einen Konsens, sondern es gab eher eine große Zurückhaltung."
Die Stimmung in der Bevölkerung misst regelmäßig das Covid-19-Snapshot-Monitoring COSMO; ein Forschungsverbund, an dem Behörden wie das Robert-Koch-Institut ebenso beteiligt sind wie wissenschaftliche Einrichtungen, etwa die Uni Erfurt. Nach den COSMO-Daten akzeptierten am Beginn der Pandemie im März 2020 über 80 Prozent der Bevölkerung die Maßnahmen. Ein Jahr später – also in diesem Frühjahr - war die Gesellschaft quasi dreigeteilt. Nur noch etwa ein Drittel war generell mit der Corona-Politik einverstanden, ein anderes gutes Drittel hielt sie für übertrieben, während gleichzeitig ein knappes Drittel fand, sie gehe nicht weit genug. Mittlerweile signalisiert wieder eine Mehrheit Zustimmung.
Langfristig betrachtet deuten die Zahlen auf merklich schwankende Stimmungen hin, die auch René Schlott wahrnimmt: "Ich habe einen Kipppunkt ausgemacht mit der Pressekonferenz Mitte April 2020, als der Lockdown zu Ende ging und die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin so erste Öffnungsschritte beschlossen haben. Dass Autohäuser geöffnet werden sollen, dass Küchenstudios geöffnet werden sollen, es ging aber nicht um Schulen, nicht um Kindergärten. Und da hat doch bei vielen Leuten ein Nachdenkprozess eingesetzt und ein Augenblick der Enttäuschung."

Gefühl der Gleichheit von Beginn an trügerisch
Spätestens jetzt wurde offensichtlich, was in einer pluralistischen Gesellschaft eigentlich selbstverständlich ist: dass es vielfältige Interessensgegensätze gibt. Die mochten zeitweilig verdeckt sein durch den Umstand, dass das Virus alle Menschen gleichermaßen bedroht. Doch dieses Gefühl der Gleichheit war von Anfang an trügerisch.
"Jede Pandemie hat großes Potenzial, gesellschaftlich zerrüttend zu wirken", sagt Marie-Luisa Frick, Philosophin an der Universität Innsbruck, die durch Bücher wie "Mutig denken" oder "Zivilisiert streiten" bekannt geworden ist. "Die Herausforderung ist hier besonders groß, weil diese Pandemie jeden betrifft und eben jeden nicht gleich."
Das kann dazu führen, dass Gefühle großer Gemeinsamkeit schnell mit Momenten heftiger Meinungsverschiedenheiten abwechseln. "Wenn eine Mehrheit sich ganz strenge Maßnahmen wünscht mit Shutdowns, dann ist das für die Wirtschaftstreibenden eine existenzielle Bedrohung, für Touristiker, für Nachtclubbesitzer, für junge Menschen, die hier um Jugenderfahrungen gebracht werden. Und umgekehrt ist es für diejenigen, die hier tatsächlich gefährdet sind, und das sind mehr, als wir glauben - ist es eine existenzielle Bedrohung, wenn Menschen auf die geringsten Einschränkungen quasi pfeifen und nicht mal Masken tragen möchten, um andere zu schützen. Das ist für viele ein Affront. Und in dieser Spirale bewegen wir uns."
Die politische Debatte kam spät - zu spät?
Angesichts dessen hält es der Berliner Philosoph Stefan Gosepath für unmöglich, einen stabilen Konsens zu erreichen. Aber er glaubt auch gar nicht, dass die Gesellschaft in der Pandemie einen solchen Konsens bräuchte. "Ich glaube, nicht mehr, als für jede andere Politik auch. Wenn wir stabile Mehrheiten haben, reicht das in der Demokratie." Doch solche Mehrheiten sollten idealerweise im Diskurs ermittelt und abgebildet werden. Die Demokratie stellt dafür eine Bühne bereit. Aber auf der blieb es lange still.
"Wir können das Parlament nicht außer Kraft setzen." Es war Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der im April 2020 den Bundestag mahnte, endlich eine Debatte zu beginnen. Bis dahin schienen die Fraktionen paralysiert durch das Infektionsschutzgesetz, das sie Jahre vorher selbst verabschiedet hatten. Und das der Regierung weitgehende Handlungsvollmachten einräumte, seit der Bundestag im März 2020 eine "epidemische Lage nationaler Tragweite" festgestellt hat, die bis heute andauert. Schäuble damals: "Damit die Entscheidung des Für und Wider für die Menschen nachvollziehbar ist, braucht es eben die streitige Debatte."
Als der Bundestag nach der Sommerpause die Debatte aufnahm, war sie auf der Straße längst im Gange. Nach einer Langzeitbeobachtung des Wissenschaftszentrums Berlin dominierten anfangs eher links-liberale Initiativen den Protest gegen Einschränkungen. Doch schnell schoben sich selbsternannte "Querdenker" in den Vordergrund, die sich weniger mit konkreten politischen Alternativen beschäftigten als mit Verschwörungsmythen und die deshalb heute vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Diese Entwicklung, meint Stefan Gosepath, wäre vielleicht vermeidbar gewesen, wenn Politik und Medien, aber auch große Teile der Gesellschaft, nicht zu lange an der Hoffnung auf einen Konsens festgehalten hätten.
"Wenn wir im schon im Frühjahr oder im Sommer vor einem Jahr eine nationale Debatte gehabt hätten, und alle wenigstens gesagt hätten, ja, meine Meinung kommt vor, die wird geäußert, die sehe ich im Fernsehen oder die höre ich im Rundfunk und dann unterliegt sie meinetwegen, aber sie ist wenigstens klar geäußert worden, dann hat man ein anderes Gefühl des Repräsentiertseins. Wenn man aber eine andere Meinung hat und hört ein halbes Jahr nicht, dass die überhaupt vorkommt, weil eher in einem Schein-Konsens von der Politik behauptet wird, das sei jetzt nötig und es gebe keine Alternative und deshalb müsse man das so machen, dann sind Bürgerinnen und Bürger mit Recht frustriert."
Auch Wissenschaft nicht immer einig
Zu den wichtigsten Begründungen für die Corona-Politik gehörte immer der Verweis auf die Wissenschaft, insbesondere auf Virologen. Anfangs ging es darum, den R-Wert klein zu halten, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Dann stand die Inzidenz im Mittelpunkt, also die Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Aktuell gibt es eine Diskussion über einen Hospitalisierungsindikator, der die Auslastung der Intensivstationen spiegeln soll. Immer mehr Leute reagieren verunsichert, beobachtet Marie-Luisa Frick.
"Ich vermute, der Grund liegt darin, dass wir keine Erfahrung haben mit einer solchen umfassenden Krise des Zusammenlebens. Das überfordert uns. Das überfordert sichtbar auch die Fachleute, es überfordert gestandene politische Verantwortungsträger, es überfordert unterschiedliche Regime in verschiedenen Ländern, nicht nur in Demokratien. Das heißt, wir sehen, dass wir eigentlich schwimmen, und das macht vielen Menschen Angst."
Wenn selbst Experten uneinig sind, wird ein Konsens in der Gesamtbevölkerung immer unwahrscheinlicher. Stefan Gosepath sieht einen Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Lockdown: "Während beim ersten Lockdown klar war, dass er ziemlich nötig war, genau in dem Moment, in dem er gekommen ist, und er durch gute Befolgung relativ schnell eine Wirkung gezeigt hat, und man sah, die Zahlen gehen runter und man ist auf dem richtigen Weg. Aber beim zweiten war das ja lange gar nicht absehbar und dann wurde die Frustration immer größer. Und natürlich, wie alle Entbehrungen, je länger die dauern, umso schwerer kommen die einem vor."
Justitias Mühlen mahlen langsam
Entsprechend versuchten immer mehr Leute, sich den Zumutungen zu entziehen, auch auf juristischem Wege. So kippten Gerichte in einigen Fällen die Isolation von Älteren in Senioreneinrichtungen. Anderswo wurden Demonstrationsverbote aufgehoben. Aber wichtige Grundsatzentscheidungen stehen nach wie vor aus, moniert René Schlott, der sich als Historiker intensiv mit der Geschichte des Grundgesetzes beschäftigt hat:
"Es gibt bis heute kein Urteil des Verfassungsgerichts zum Beispiel zur Rechtmäßigkeit der Ausgangssperren. Das ist noch immer nicht geklärt, obwohl die Ausgangssperren längst Geschichte sind. Man muss sich erinnern, Ausgangssperren sind eigentlich ein klassisches Mittel von Autokratien und Diktaturen, das in unserem Land zur Anwendung gekommen ist. Zwar demokratisch legitimiert durch einen Parlamentsbeschluss, aber dennoch muss man doch in Frage stellen, ist das mit unserer Verfassung vereinbar?"
Voraussichtlich im Herbst will das Bundesverfassungsgericht das entscheiden. Auf das oberste deutsche Gericht könnte es demnächst auch in der Frage einer Impfpflicht ankommen. Ein vergleichbares Verfahren ist dort schon anhängig. Da geht es darum, ob in Kitas für Kinder und Personal eine Impfung gegen Masern vorgeschrieben werden darf. Sollte die vierte Welle schnell weiter steigen, dürften Forderungen nach einer Corona-Impfplicht lauter werden und damit die relative Entspannung in der Debatte um die Pandemie bald wieder vorbei sein, fürchtet Marie-Luisa Frick:
"Ich glaube, bis zum Herbst werden wir schon wieder andere Stimmungen gesellschaftlich erleben. Es wird schon heftig werden. Ich glaube ganz persönlich schon, diese Kluft zwischen Geimpften und Nichtgeimpften hat großes Konfliktpotenzial, das wird man leider auch bald sehen."

Nächster Streitpunkt Impfpflicht?
So hält etwa das Robert-Koch-Institut bei den Zwölf- bis 59-Jährigen eine Impfquote von 85 Prozent für nötig, bei Älteren einen noch höheren Wert. Ob dies durch Aufklärung und weitere niederschwellige Angebote bis zum Herbst erreichbar ist, bleibt aber zweifelhaft. Deswegen eine Impfflicht einzuführen, würde die Gräben zwischen Politik und Gesellschaft nach Ansicht von Stefan Gosepath aber eher vertiefen. Mit der Minderheit, die sich partout nicht impfen lassen wolle, umzugehen, könne der Staat unter Umständen den gesellschaftlichen Akteuren selbst überlassen. Kinos wie Restaurants oder etwa auch Reiseveranstalter könne man doch freistellen, wie sie mit Kunden umgehen wollten:
"Dass man sagt, wenn man in Theater gehen will, was ja keiner muss, da kann man sagen, man kann eine Impfpflicht einführen, dass da nur Leute reinkönnen, die doppelt geimpft sind. Damit sind die, die sich nicht impfen lassen wollen, noch nicht vom öffentlichen Leben ausgeschlossen."
Aber sie wären eingeschränkt in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe. Stefan Gosepath bezeichnet das als sanften Druck. Der könnte auch manche, die vom Sinn einer Impfung nicht überzeugt sind, zur Kooperation motivieren. Und Kooperation, nicht unbedingt Konsens, ist das, was eine Gesellschaft zum Zusammenhalt braucht.
Das bekräftigt auch die Innsbrucker Philosophin Marie-Luisa Frick. Das gelte nicht nur für die Phase der Pandemie selbst, sondern ebenso für die Zeit danach, wenn es darum gehe, wieder zusammen zu finden. "Das wird sich wahrscheinlich über einige Jahre ziehen. Und auch die Nachwirkungen, bis der Tourismus sich erholt, bis die globale Mobilität wieder auf dem Stand vor der Pandemie sein wird, das wird sehr lange dauern. Und es werden sich sozial einige neue Konflikte auftun zwischen den Menschen, die eine relativ gute Absicherung haben, weil sie ihr Gehalt vom Staat beziehen und denen, die sich im freien Markt bewähren müssen. Ich glaube, dass das nachhaltig zu vielen Problemen führen wird und vieles ist noch nicht absehbar."
Brauchen wir eine Versöhnungskommission?
Die Bewältigung der sozialen Folgen könnte sich als konfliktreicher erweisen als die eigentliche Pandemie-Bekämpfung, meint auch Stefan Gosepath, der sich an der FU Berlin vor allem mit Fragen der Praktischen Philosophie beschäftigt: "Insgesamt, glaube ich, haben wir am Anfang der Pandemie in Deutschland eine große Welle von Solidarität gehabt und das war auch eine sehr positive Erfahrung für viele von uns, dass wir gesehen haben, das ist noch möglich in einer Gesellschaft der Individualisierung, wie es heißt, dass wir doch noch zusammenhalten können."
Der Historiker René Schlott gibt allerdings zu bedenken, dass das gesellschaftliche Klima doch arg vergiftet sei, weil sachliche Kontroversen allzu sehr moralisch aufgeladen und immer wieder Sündenböcke gesucht worden seien, die Konsens oder Solidarität gestört hätten. So seien etwa erst diejenigen angeprangert worden, die sich angeblich beim Impfen vorgedrängelt hätten, und jetzt diejenigen, die sich verweigern.
"Das werden Sie auch so schnell nicht rausbekommen. Dafür bräuchte es nicht nur eine Untersuchungskommission, wie gut haben die Maßnahmen gewirkt oder wie schlecht, sondern eine Kommission, die auch auf Versöhnung aus ist. Was mir spontan einfällt ist vielleicht ein Gremium ehemaliger Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter, die nicht aktiv an Urteilen zu dieser Zeit mitgewirkt haben, die möglicherweise so eine Wahrheitskommission oder Versöhnungskommission auf eine gute Basis stellen könnten."
Nachträglich einen Konsens herzustellen, würde die auch kaum schaffen. Aber vielleicht eine Gesprächsgrundlage, um über Meinungsverschiedenheiten hinweg eine Debatte zu führen, die gemeinsame Lösungen sucht. Und die jene Fehler-Diskussion anstößt, die nicht nur Jens Spahn für unvermeidlich hält. "Ich bin mir sicher, auch jenseits von Politik, wird auch für die Gesellschaft, selbst für Virologen und Wissenschaftler, eine Phase kommen, wo wir alle feststellen werden im Nachhinein, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle falsch gelegen hat."