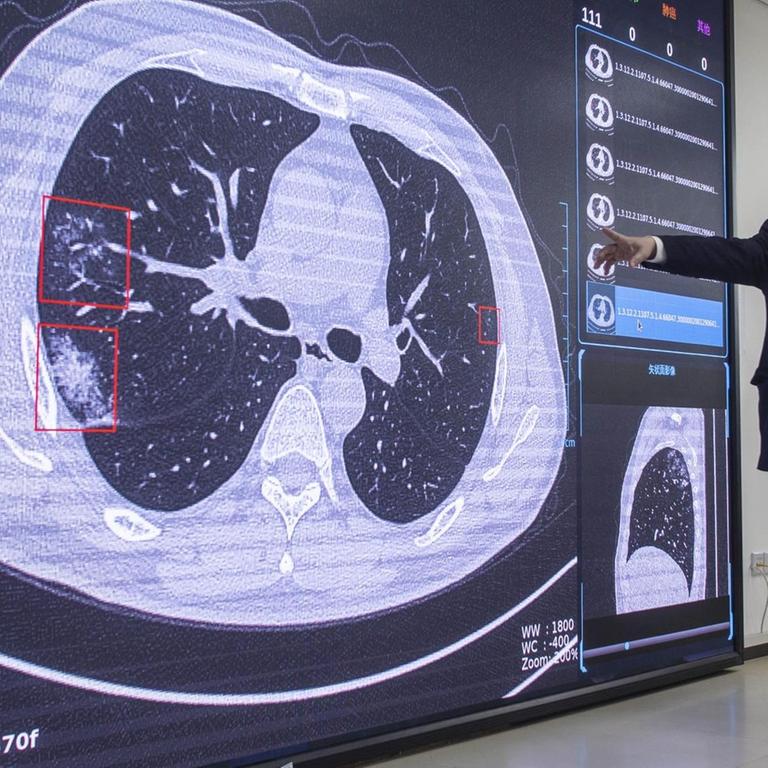1848. Der berühmte Arzt Rudolf Virchow steht auf den Barrikaden von Berlin auf Seiten der Republikaner. Wenig später schreibt er einige Sätze nieder, die wie ein Manifest einer neuen Idee von Gesundheit und Politik erscheinen:
"Die Geschichte hat es mehr als einmal gezeigt, wie die Geschicke der größten Reiche durch den Gesundheitszustand der Völker oder der Heere bestimmt wurden, und es ist nicht mehr zweifelhaft, dass die Geschichte der Volkskrankheiten einen untrennbaren Teil der Kulturgeschichte der Menschheit bilden muss. Epidemien gleichen großen Warnungstafeln, an denen der Staatsmann von großem Stil lesen kann, dass in dem Entwicklungsgange seines Volkes eine Störung eingetreten ist, welche selbst eine sorglose Politik nicht mehr übersehen darf."
Man kann diese Aussage natürlich auch umkehren – dann klingt sie, vom Volk, von den Bürgerinnen und Bürgern aus gesehen etwa so:
Die Geschichte hat es mehr als einmal gezeigt, wie die größten Reiche den Gesundheitszustand der Völker ignorieren, und es ist nicht mehr zweifelhaft, dass Volkskrankheiten einen untrennbaren Teil der politischen Geschichte bilden. Epidemien gleichen großen Warnungstafeln, in denen Bürgerinnen und Bürger lesen können, dass in dem Entwicklungsgange ihrer Regierungen eine Störung eingetreten ist, welche selbst eine sorglose Bevölkerung nicht mehr übersehen kann.
Persönliches Leid, Hilfe, Zuwendung und Gleichgültigkeit
Krankheiten und wie mit ihnen umgegangen wird, das bedeutet viel persönliches Leid, auch Erfahrung von Hilfe und Zuwendung, vielleicht von Gleichgültigkeit. Es ist aber auch ein Symptom für das Verhältnis zwischen Politik und Gesellschaft, zwischen Regierung und Bürgerinnen und Bürgern. Zu übersehen ist das beim besten Willen nicht: Was zwischen Politik und Krankheit geschieht, deutet auf Fehler und Versäumnisse, auf Missverständnisse und falsche Entwicklungen hin. Man nennt das wohl Krise.
Gesundheitspolitik in einer Gesellschaft, die durch Marktwirtschaft und Demokratie bestimmt ist, vollzieht sich in einem fragilen Dreieck.
Da ist zum einen die Verpflichtung des Staates gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern, Schaden und eben auch gesundheitlichen Schaden von ihnen abzuwenden. Da ist zum zweiten der marktwirtschaftliche Druck, auch die Behandlung von Krankheiten und die Pflege der Gesundheit in die privatwirtschaftlichen Kreisläufe von Kapital und Rendite zu übertragen.
Und da ist zum dritten die subjektive Freiheit und Selbstverantwortung der Menschen für ihre Gesundheit.
Die Freiheit von Risiko und Solidaritätsverweigerung
Zur Freiheit des Menschen gehört dann eben auch, sich gesundheitlich riskant zu verhalten oder sich einem allgemeinen Gebot der Solidarität zu verweigern. Sollen wir etwa zahlen für Menschen, die sich bewusst gesundheitlichen Risiken aussetzen, die vielleicht rauchen, Drogen nehmen, gefährliche Sportarten betreiben oder einfach nicht auf ärztlichen Rat hören? Soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen, ist überall schwierig, im Gesundheitssystem aber ganz besonders. Aber dieses Empfinden sozialer Gerechtigkeit und allgemeiner Fürsorge ist eben Grundlage für Gesundheit. In einem Bericht der WHO-Expertenkommission "Social Determinants of Health" hieß es dazu im Jahr 2006:
"Die Entwicklung einer Gesellschaft kann an der Gesundheit ihrer Bevölkerung gemessen werden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, wie gerecht die Gesundheitschancen verteilt sind und welche Vorkehrungen zum Schutz vor Nachteilen, die aus einem schlechten Gesundheitszustand resultieren, getroffen werden."
Gesundheitssystem als Gradmesser für den Entwicklungsstand
Der Zustand des Gesundheitssystems einer Gesellschaft beziehungsweise eines Landes wird also auch im Weltmaßstab als Gradmesser für den Entwicklungsstand verwendet. Das eine Land ist stolz auf sein funktionierendes Gesundheitssystem, das andere kaschiert die eigenen Mängel mit dem Hinweis auf Länder, in denen es wirklich katastrophal zugeht. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, die Grundelemente jeder Demokratie, kommen sich auch hier in die Quere. Für die Balance dieser drei Impulse oder für das Fehlen davon kann nichts anderes verantwortlich gemacht werden als:
Die Politik.
Politik lässt sich mit Aristoteles positiv definieren als Bestreben, eine größtmögliche Zahl von Menschen glücklich zu machen, eher negativ aber auch als eine spezielle Beziehung zur Macht, wie sie Niccoló Machiavelli formulierte:
"Politik ist die Summe der Mittel, die nötig sind, um zur Macht zu kommen und sich an der Macht zu halten und um von der Macht den nützlichsten Gebrauch zu machen."
Das betrifft auch die Beziehung zwischen Politik und Krankheit. Ist Politik das Mittel – wie es übrigens im Amtseid für deutsche Politiker heißt –, um nach bestem Wissen Schaden von den Bürgerinnen und Bürgern abzuwenden, also auch eine Beeinträchtigung der Gesundheit? Oder sind Krankheit und Gesundheit individuelle und kollektive Empfindungen, mit denen man auch Macht generieren kann?
Die Rolle von Politik für die Gesundheit der Menschen
Politik macht den Menschen krank, wo sie krankmachende Faktoren im Alltag zulässt. Dazu gehören physikalische und chemische Gefährdungen durch Umweltbelastungen, durch Lärm, durch mangelnde Kontrolle von Nahrungsmitteln und so weiter. Dazu gehören aber auch psychische Belastungen. Es ist nun wirklich keine neue medizinische Erkenntnis, dass Angst, Stress, Unsicherheit, Überlastung et cetera Faktoren sind, die krank machen.
Politik macht die Menschen krank oder verhindert deren Genesung, wo sie das Geschehen ökonomischen Interessen überlässt. Selbst eher konservativ‑marktwirtschaftlich denkende Menschen stellen mittlerweile fest, dass eine allzu eifrige Privatisierung des Gesundheitswesens, der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen vor allem, ein Fehler ist. Dass international agierende Pharma- und Krankenhauskonzerne möglicherweise so wenig die Interessen der Menschen vertreten wie Versicherungen, die Menschen zu Objekten von Gewinn- und Verlustrechnungen machen. Nicht nur ein Staat, der von seinen Bürgerinnen und Bürgern zu viel verlangt, kann zum Krankheitsfaktor werden, sondern auch einer, der sich gegenüber ökonomischen Interessen und individuellen Egoismen zu schwach verhält.
Politik macht den Menschen krank, wenn sie ihr eigenes Instrument, die Bürokratie, zu einer Kraft werden lässt, die die Beziehung zwischen Arzt und Patient erschwert. Ist es nicht absurd, dass eine Arztpraxis heute zu 70 Prozent mit Bürokratie beschäftigt ist und nur noch 30 Prozent für die wirkliche ärztliche Tätigkeit übrig bleiben? Als kranker Mensch gerät man immer in drei Mühlen, die der Maschinen, die der Medikamente und die der Bürokratie. Und als gesunder Mensch macht einem die Angst vor allen drei zu schaffen. Arzt und Patient sind mal Verbündete und mal Gegner in einem unübersichtlichen Verteilungs- und Kontrollkampf. Daraus entsteht ein zweites Krankheitsbild, neben körperlichen und psychischen Störungen nämlich das Empfinden von Entwürdigung und Entmündigung. Die größte Paradoxie eines zugleich ökonomisierten und bürokratisierten Gesundheitswesens besteht darin, dass es dem gesunden Menschen den Schein individueller Freiheit lässt, um ihm im Krankheitsfall umso gründlicher Rechte zu entziehen.
Der Patient als Verwaltungsobjekt und Zahlungsmedium
Ein Gesundheitssystem kann nur so gerecht gegenüber der Gesellschaft agieren, wie es in sich selbst gerecht ist. Ungeheure Einkommensunterschiede im medizinischen Bereich führen nicht nur zu einer schlechten medizinischen Kultur, sie bringen auch Interessenkonflikte mit sich, so dass, nur zum Beispiel, die Ärzteschaft in sich gespalten ist. Der Patient in einem solchen System wird von einzelnen Ärzten noch als Mensch gesehen, dem es zu helfen gilt, vom System aber als Verwaltungsobjekt, als Zahlungsmedium, als Konkurrenzmasse, als Kostenfaktor, als statistische Größe und so weiter. Das medizinische System ist zwar in sich ausgesprochen dynamisch, aber im Großen und Ganzen kann es gar nicht anders, als die Verfassung der gesamten Gesellschaft, der Politik und auch der Ideologien widerzuspiegeln.
Die Probleme, die in einem Gesundheitssystem auftreten, sind ihrerseits Symptome des politischen Systems. Der kranke Mensch hat eine große Hoffnung, nämlich die, dass man ihn mit seiner Krankheit nicht allein lässt. Ob diese Hoffnung sich erfüllen lässt, darüber bestimmt nicht allein ärztliches und pflegerisches Personal, es ist die ganze Gesellschaft, von der Regierung bis zu den Medien, die darüber entscheidet.
Politik und Krankheit begegnen sich im Zeichen eines rar gewordenen Empfindens. Nennen wir es allgemein Vertrauen. Zwischen der politischen und der privaten Sphäre nämlich gibt es nicht nur rationale und interessengeleitete Beziehungen, sondern auch symbolische und emotionale. Krank machen Regierung und Staat also nicht nur, wenn sie Bürgerinnen und Bürger angesichts gesundheitlicher Konfliktfälle allein lassen, bürokratisch drangsalieren oder ökonomischen Interessen ausliefern, sondern auch, wenn sie einem allgemeinen Gefühl von Unsicherheit, Zwiespalt und Konkurrenz Vorschub leisten.

Kommerzielle Ausbeutung und Politikversagen - in der Pandemie sichtbarer
In der Pandemie wird es besonders deutlich: Weniger die Angst vor einer falschen Entscheidung verstärkt das Misstrauen gegenüber der Politik als vielmehr das offenkundige Schwanken zwischen Notstand und Opportunismus, zwischen Expertenwissen und Lobbyismus. Gegenseitiges Vertrauen ist offenbar eine Grundvoraussetzung für Gesundheit in einer Gesellschaft, und wie wenig davon in der Krise bleibt, führt zu einem Kern des Problems von Politik und Krankheit. Es ist der Widerspruch, dem wir am Anfang bei der Politikdefinition zwischen Aristoteles und Machiavelli begegnet sind. Geht es um das Glück oder geht es um die Macht?
Das Gesundheitswesen eines demokratisch-kapitalistischen Staates wie des unseren ist geprägt durch das Zusammenspiel von individueller Selbstbestimmung, im besten Fall also Freiheit, die durch Verantwortung gedeckt ist, von ökonomischem Interesse, im besten Fall eine bezahlbare Medizin, die zugleich genügend Rendite abwirft, um weitere medizinische Forschung zu finanzieren, und politischer Macht, im besten Fall also Regierung, Parlament, Gesetzgebung und kritischer Diskurs, der medizinische Versorgung als Bürger- und Menschenrecht bewahrt und nach Kräften verbessert. Der beste Fall freilich bleibt ein Ideal. Zu fürchten ist der schlimmste Fall: Eine politische Macht, die Gesundheitspolitik zu Konkurrenz- und Machtspielen verwendet, eine Ökonomie, die medizinische Für- und Vorsorge vor allem als einträgliches Geschäft versteht und Patienten zu Kunden macht, die nach ihrer Kaufkraft beurteilt werden. Und Bürgerinnen und Bürger, die Freiheit im Umgang mit dem eigenen Körper und dem der anderen als blanken Egoismus und soziale Rücksichtslosigkeit missverstehen. Politik als 'Kunst des Möglichen' wird zwischen diesen Extremen vermitteln. Manchmal gelingt das, und manchmal offenbart es enorme Widersprüche, wie zum Beispiel in einer Pandemie, die ein Gesundheitssystem an den Rand seiner Belastbarkeit bringt und die Schwächen der Kompromisse, die Individuum, Staat und Ökonomie eingehen, offenbart. Individueller Eigennutz, kommerzielle Ausbeutung und politisches Versagen werden in der Krise sichtbarer als im Normalzustand.
Medizin als Instanz und die Gefahr des Missbrauchs durch Politik
Wo also fängt verantwortungsloses Verhalten an? Wo sind die Grenzen für eine ökonomisierte medizinische Versorgung, aus der Krankheit Gewinn zu erzielen? Wo sind die Grenzen für einen Staat, der zum Wohl der Bevölkerung Gesetze und Verbote erlassen muss, die die Freiheit des Einzelnen beschränken? Wo schließlich sind die Grenzen zwischen medialer Information und Desinformation? Jeder Mensch möchte gesund sein, zweifellos. Aber was ist das überhaupt, Gesundheit? Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO ist Gesundheit "ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen."
Nach dieser Definition ist die Mehrheit der Menschen sehr weit entfernt davon, wirklich gesund zu sein. Was Krankheit ist, wird vielmehr an einem anderen Zustand gemessen, an dem der "Normalität". Neben der Definition der WHO gilt nämlich in der medizinischen Praxis eine andere, nämlich eine statistische Definition, die uns überall begegnet, etwa auf der Webseite eines Consulting-Dienstleisters im Gesundheitswesen:
"Als 'krank' gilt in der klinischen Praxis jeder Zustand, der außerhalb eines gewissen Entfernungsbereiches vom Mittelwert liegt. Dieses Maß kann jeden quantifizierbaren Zustand erfassen, also etwa Körpergröße, -gewicht oder Hämoglobingehalt. Nach dieser Definition liegen üblicherweise circa fünf Prozent der Bevölkerung außerhalb des 'Norm'-Bereiches."
So kommt der Medizin eine höchst problematische Doppelrolle zu: Die Medizin nämlich ist nicht nur die segensreiche Kraft, die Kranke heilen oder wenigstens ihre Leiden lindern kann. Sie ist zugleich auch die Instanz, die definiert, was krank und was gesund ist. Man muss nicht in die Zeit der nationalsozialistischen Medizin mit ihrer Definition von lebensunwertem Leben zurückgehen, um zu begreifen, wie gefährlich diese Macht wird, wenn sie sich politisch missbrauchen lässt.
Wer für die Kosten einer Behandlung zahlt
In der Geschichte von Politik und Medizin gibt es keine stabile Definition der Beziehung von Gesundheit und Krankheit. Sie wird ständig neu formuliert, und zwar einerseits von dem, was man das ärztliche Gewissen nennen kann, andererseits von kulturellen Standards, von ökonomischen Interessen, von bürokratischen Zwängen und von politischem Kalkül. Als Krankheit definiert das medizinische Standardwerk, der Pschyrembel "eine Störung der Lebensvorgänge in Organen oder im gesamten Organismus mit der Folge von subjektiv empfundenen und/oder objektiv feststellbaren körperlichen, geistigen oder seelischen Veränderungen."
Krank-Sein bedeutet also eine Kommunikation zwischen dem Menschen, der eine Störung in seinen Lebensvorgängen empfindet, und der ärztlichen Instanz, die nach wissenschaftlichen, aber auch nach sozialen Standards Symptome der Störung erkennen, benennen und behandeln kann. Die beiden Extremfälle dieser Kommunikation: Die ärztliche Instanz erklärt Symptome zur Krankheit, die nicht oder noch nicht als Störung empfunden werden. Oder die ärztliche Instanz kann aus Symptomen auf keine der ihr bekannten Krankheiten schließen. Patient und Arzt begegnen sich nicht allein auf einer direkten Ebene, sondern in einem normativen Rahmen. Was krank und was gesund ist, das bestimmen auch Faktoren, die außerhalb der Behandlung liegen: Das ist der Stand der medizinischen Forschung und der Erkenntnisse der sogenannten Gesundheitswissenschaft, das ist die gesellschaftliche Übereinkunft, zum Beispiel welche Menschen unter welchen Umständen Zuwendung und Schonung erhalten, und das ist das ökonomische Interesse, beginnend mit der schlichten Frage: Wer bezahlt für die Kosten einer Behandlung? Dieses Verhältnis zwischen Forschung und Lehre, gesellschaftlicher Übereinkunft und ökonomischem Interesse muss in einer komplexen Gesellschaft wie der unseren immer wieder neu bestimmt werden.
Die Gesundheitswissenschaften unterscheiden drei Erklärungsmodelle von Krankheiten:
naturwissenschaftlich-somatisch
sozio-psycho-somatisch
verhaltensbedingt.
sozio-psycho-somatisch
verhaltensbedingt.
Arbeitsunfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit als Definitionsfrage
Das heißt: Krank ist, wer erkennbare körperliche Symptome aufweist, bei wem eine Krankheitsgeschichte und Krankheitsgründe aus seinem gesellschaftlichen Umfeld erkennbar sind, oder schließlich, wessen Erscheinung und Verhalten in der Gesellschaft als auffällig, störend, eben nicht normal erscheint. Damit sind wir wieder beim Problem der normativen Aufgaben, die sich Medizin und Politik teilen. Nicht nur bei der medizinischen Behandlung, sondern auch beim Umgang mit Vorsorgemaßnahmen und mit Folgen wie Arbeitsunfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit kommt es darauf an, was als gesund, was als normal, und was als krank definiert wird. Wir kennen Krankheiten, die lange nicht als solche akzeptiert wurden, vor allem solche, die als Folge von beruflicher Belastung oder schädlichen Umwelteinflüssen wirken. Nur zum Beispiel wird wissenschaftlich, juristisch und eben auch politisch darum gestritten, welche chemischen Mittel wir als ursächlich für Krebsleiden ansehen. Umgekehrt wird gewiss nicht zu Unrecht geargwöhnt, dass in bestimmten Situationen Krankheiten förmlich erfunden werden, um lukrative Behandlungsmethoden zu vermarkten.
Das deutsche Gesundheitssystem, wie es sich seit den Bismarckschen Sozialgesetzen entwickelt hat und wie es in vielen Teilen der Welt als vorbildlich angesehen wird, besteht aus einer Mischung von staatlicher Aufsicht und Organisation mit marktwirtschaftlichen und individuellen Elementen. Aus dieser Mischung entsteht eine kolossale Dynamik, die sich unter anderem darin zeigt, dass die Öffentlichkeit Zeuge eines permanenten Kampfes von Verbänden und Gruppierungen um Einfluss und Anteile wird, dass sich die Verhältnisse zwischen Privatisierungen und gesellschaftlicher Organisation beständig verändern und dass es, damit verbunden, auch beständig Korrekturen, Variationen und Verschiebungen gibt. Der positive Effekt eines solchen Systems liegt in einer permanenten Anpassung an die wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und ökonomischen Umstände. Der negative Effekt allerdings ist neben einer permanenten Verunsicherung und einer absurden Bürokratisierung auch die wechselseitige Abhängigkeit von Politik und Gesundheit. Der tiefe politische Graben, der zum Beispiel die US-amerikanische Gesellschaft spaltet, verläuft auch zwischen zwei fundamental verschiedenen Auffassungen der Gesundheitsvorsorge, zwischen reiner Privatsache und sozialem Auftrag. Aber selbst in einer sich vorbildlich wähnenden Organisation wie der unseren stehen sich die Impulse von sozialer Solidarität und Ökonomisierung gegenüber. Die individuelle Freiheit, die ein System der Gesundheitsvorsorge gewährt oder auch verlangt, kommt auch als individuelle Katastrophe, als Überforderung und Leiden zurück.
Die Angst vor der Krankheit und den damit verbundenen Kosten
Der Trend ging zweifellos in den letzten Jahren dahin, dass immer weitere Bereiche des Gesundheitswesens privatisiert wurden, einschließlich der Trägerschaft von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Aber auch die Bereiche der Medizin, der Vorsorge und der Pflege, die weiterhin staatlich organisiert sind, sind von dieser Ökonomisierung betroffen. Wir können gar nicht mehr genau sagen, ob wir Krankheit deswegen fürchten, weil sie Schmerz, Leiden und Beeinträchtigung bedeutet, oder weil sie so viel kostet, dass mit dem finanziellen immer auch ein soziales und biographisches Risiko einhergeht. So heißt es in einer Untersuchung der Bundeszentrale für politische Bildung:
"Die sozialen Ungleichheiten spiegeln sich auch in der Gesundheit und Lebenserwartung der Bevölkerung wider. Mittlerweile zeigt eine große Zahl an Studien, dass Menschen mit niedrigem sozialen Status, gemessen zumeist über Einkommen, Bildungsniveau und berufliche Stellung vermehrt von chronischen Krankheiten und Beschwerden betroffen sind, ihre eigene Gesundheit und gesundheitsbezogene Lebensqualität schlechter einschätzen und ein erhöhtes vorzeitiges Sterberisiko haben. Diese gesundheitlichen Ungleichheiten sind nicht nur für Deutschland, sondern für alle Länder, für die aussagekräftige Daten vorliegen, belegt."
Wie also lässt sich eine Politik im Dienste einer guten medizinischen Versorgung aller Bürger und Bürgerinnen definieren? Möglicherweise mit Hilfe von (zehn) einer Reihe leider nur auf den ersten Blick einfachen Grundsätzen:
Es geht nicht allein darum, die Krankheit zu verwalten, sondern immer auch darum, die Gesundheit zu fördern. Das Gesundheitssystem soll nicht Teil der sozialen Ungerechtigkeit, sondern Teil ihrer Überwindung sein.
Es geht nicht nur darum, Krankheiten zu heilen, sondern auch darum, die sozialen und ökonomischen Folgen zumindest abzumildern.
Ein gutes System sorgt für gerechte Entlohnung und ausreichend Personal
Ein medizinisches System, das nur der Ökonomie folgt, wird in jeder Krise an seine Grenzen kommen. Ein gutes System ist auch auf unvorhergesehene Ereignisse vorbereitet, hält Reserven bereit – auch für internationale Hilfeleistung – und sorgt für gerechte Entlohnung und ausreichend Personal.
Auch für die medizinische Versorgung gelten die drei grundsätzlichen Impulse der Demokratie: Freiheit, das heißt Selbstbestimmung der Patienten, Gerechtigkeit, das heißt prinzipielle Gleichbehandlung aller Menschen und Solidarität, das heißt, jeder gesundheitliche Konflikt und die Maßnahmen zu seiner Lösung gehen nicht nur mich, sondern auch die anderen Menschen an. Das medizinische System muss also selbst demokratisch werden, ganz so, wie ja auch die Beziehung zwischen Arzt und Patient nicht mehr nach dem Prinzip Halbgott in Weiß, aber eben auch nicht nach dem Prinzip Maschine plus Chemie ablaufen soll.
Das medizinische System muss nicht nur unentwegt auf den neuesten Stand von Wissenschaft und Forschung gebracht, sondern immer wieder auch auf seine soziale Basis hin reformiert werden.
Das medizinische System darf den Menschen nicht nur auf seine Arbeitskraft reduzieren, die wiederhergestellt werden muss.
Krankheit als Armutsrisiko, Armut als Krankheitsrisiko
Soziale Gerechtigkeit ist die Basis jedes demokratischen Gesundheitssystems. Krankheit ist ein Armutsrisiko, umgekehrt ist Armut aber auch ein Krankheitsrisiko. Untersuchungen zeigen, dass es in einem der reichsten Länder der Welt immer noch Armut gibt, ja sogar in wachsendem Maße, sie zeigen, wie sehr der soziale auch den gesundheitlichen Status bestimmt und wie groß das Risiko chronischer Erkrankung im unteren sozialen Feld ist. Auch die Pandemie hat diesen Zusammenhang einigermaßen drastisch sichtbar werden lassen. Da aber kaum etwas geschieht, um auch nur die Exzesse der strukturellen Ungleichheit zu mildern, ist die Politik entweder nicht in der Lage oder nicht willens, statt Krankheit zu verwalten am Projekt einer gesunden Gesellschaft zu arbeiten.
Nicht allein die Krankheit muss besiegt werden, der ganze Mensch muss wieder gesund werden.
Die viel gescholtene Apparatemedizin ist nur ein Symptom einer Degradierung. Maschinen können Menschen immer nur als maschinelle Wesen mit mechanischen Defekten behandeln. Ein funktionierendes Gesundheitswesen muss darüber hinaus Möglichkeiten und Fähigkeiten fördern, den Menschen ganzheitlich zu begreifen.
Medizinische Aufklärung ist eine Angelegenheit von Regierung, Staat und Gesellschaft, nicht eine Angelegenheit von Medien, Märkten und Mythen, die in Vorabendserien im Fernsehen melodramatische Zerrbilder erzeugen. Ein gutes, demokratisches und humanistisches Gesundheitssystem zeichnet sich auch durch das Wissen von der Krankheit aus.
Die Verantwortung der Politik gegenüber dem gesundheitlichen Diskurs
Oder anders gesagt: Von einem allgemeinen Konsens des medizinischen Weltbildes, das auch gegen Scharlatanerie und Wahn immunisiert. Man muss nicht erst eine Demonstration von Corona-Leugnern betrachten, um eine Mischung aus magisch‑esoterischem und psychopathischem Verhältnis zu Krankheiten und deren Behandlungen zu erkennen. Woher das wachsende Misstrauen gegenüber dem wissenschaftlichen Weltbild der heutigen Medizin auch kommen mag, es stellt eine Bedrohung für das gesamte System dar, der nur durch Aufklärung und durch Offenheit zu begegnen ist. Medizin heißt also nicht nur, Krankheiten zu heilen und Krankheiten zu verhindern, heißt nicht nur, Krankheiten zu definieren und zu normieren.
Medizin heißt auch, über Krankheit aufzuklären, heißt eine Kultur zu schaffen, die den Menschen Angst und Misstrauen nimmt.
Es gibt eine allgemeine Kultur von Krankheit und Gesundheit, die auf der Wertschätzung des Lebens und der Körper basiert. Diese Kultur freilich ist infiziert von Zeitgeist und Marktinteresse. Werbung als immerwährende Begleitung liefert, komplett mit medialen Arzt-Darstellern und fragwürdigen Heilungsbildern, sozusagen eine medizinische Gegenerzählung. Das führt zu einer Art der pharmazeutischen Überdosierung. Aus Angst vor Krankheit und Beeinträchtigung pumpt sich der Mensch – angeleitet von den Medienbildern – mit Medikamenten und vor allem Pseudo-Arzneimitteln voll. Politik hat nicht nur eine Verantwortung gegenüber der medizinischen Organisation, sondern auch gegenüber dem gesundheitlichen Diskurs, der Information und Aufklärung.
Eine Neufassung des hippokratischen Eides für die Gesellschaft
Einer Politik, die krank macht, kann man begegnen, indem man das Politische an der Krankheit erkennt.
Vielleicht benötigen wir eine neue Fassung des berühmten hippokratischen Eides, den nun freilich nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern die gesamte Gesellschaft leisten müsste:
"Meine Verordnungen werde ich treffen zu Nutz und Frommen der Kranken, nach bestem Vermögen und Urteil; ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht."
Vor falscher Politik und erbarmungsloser Bürokratie.
Vor Profitgier und Habsucht.
Vor systematischer menschlicher und fachlicher Überforderung.
Vor Entwürdigung und Entmenschung.
Vor falschen Versprechungen und unsinnigen Medikamenten.
Vor Medizin-Entertainment und Pharma-Reklame.
Vor Unwissen und Einflüsterung.
Vor sozialen Folgeschäden und ökonomischer Herabstufung.
Vor Machtspielen und Wahlversprechen.
Vor Gesetzeswirrwarr und Lobbyismus.
Vor einer Gesellschaft, die die Schwachen schwächt und die Starken stärkt.
Vor Angst und Misstrauen.
Vor Einsamkeit und Verachtung.
Vor der eigenen Gleichgültigkeit und Blindheit.
Es gibt keine Krankheit an sich. Es gibt nur kranke Menschen. Politik, die in der Krankheit den Menschen aus dem Blick verliert, ist selbst krank.