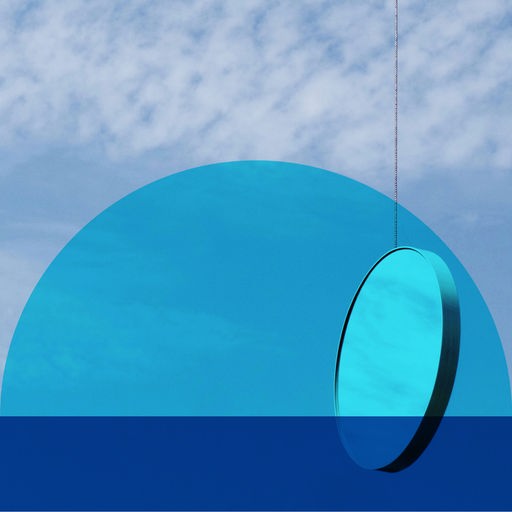Jens Kastner, Jahrgang 1970, Soziologe und Kunsthistoriker, lebt als freier Autor in Wien und unterrichtet dort an der Akademie der bildenden Künste. Er veröffentlichte in diversen Zeitungen und Zeitschriften Texte zu Sozialen Bewegungen, Cultural Studies und zeitgenössischer Kunst. Seit 2005 ist er koordinierender Redakteur von "Bildpunkt. Zeitschrift der IG BILDENDE KUNST".
Ein Bumerang von Chanel löste im Frühsommer einen Shitstorm in den sozialen Medien aus. Nicht nur, weil er für 2.000 Euro verkauft werden sollte, sondern auch und gerade, weil ein Bumerang ursprünglich die Waffe von australischen Aborigines war. Es sei rassistisch, ihn nun als sündhaft teures Sportaccessoire zu verkaufen.
Noch größer war die Aufregung, als der Modedesigner Marc Jacobs seine Frühjahrskollektion 2017 mit Models präsentierte, die bunte Dreadlock-Frisuren trugen. Weil die Models überwiegend weiß waren, wurde der Vorwurf der "Cultural Appropriation" erhoben, der kulturellen Aneignung.
Doch was ist Cultural Appropriation, also kulturelle Aneignung eigentlich? Diese Frage lässt sich vielleicht ganz gut anhand eines Buchtitels beantworten. Das Buch, um das es geht, heißt "Everything But The Burden" und wurde 2003 vom US-amerikanischen Kulturtheoretiker Greg Tate herausgegeben. Die Aufsatzsammlung beschäftigt sich mit schwarzer Popkultur und ihr Untertitel macht das Thema deutlich:
"What White People Are Taking From Black Culture."
Greg Tates Untertitel ist die These: Die große Bürde - The Burden - des Schwarzseins bestand darin, dass Afroamerikanern in den USA Menschen- und Bürgerrechte ebenso verwehrt wurden, wie ökonomische Teilhabe.
Gleichzeitig aber ist US-amerikanische Kultur - Musik, Tanz, Mode, Humor, Spiritualität, basisdemokratische Politik, Slang, Literatur und Sport - "in ihren Ursprüngen, Konzeptionen und Inspirationen afro-amerikanisch gewesen".
Was Weiße also übernommen, letztlich ohne zu fragen genommen haben, war: "Everything But The Burden" - alles, außer der Last, die damit verbunden ist, schwarz zu sein.
Woran sich bis heute nichts geändert hat. Auf der einen Seite bedienen sich Modedesigner und Werbeleute an schwarzer Kultur. Auf der anderen Seite besteht die Ungleichheit fort: Der Vermögenswert weißer Haushalte ist heute in den USA rund 20 Mal so hoch wie derjenige schwarzer Haushalte; von 100.000 Schwarzen befinden sich heute 2.300 Menschen im Gefängnis, von 100.000 Weißen sind es im Vergleich nur 450. In einem Viertel aller schwarzen Haushalte herrscht sogenannte Ernährungsunsicherheit, ein euphemistisches Wort für Hunger.
Auch unter Barack Obama, dem ersten schwarzen Präsidenten der USA, hat sich die Situation nicht verbessert. Im Gegenteil. Schwarze Familien waren von der Finanzkrise um 2008 wesentlich stärker betroffen als weiße, wie etwa Keeanga-Yamahtta Taylor, Professorin für African American Studies in Princeton, detailliert nachgewiesen hat.
Während also Mode und Pop sich fröhlich an den kulturellen Errungenschaften von Minderheiten bedienen und damit Geld machen, kommt vom Glamour und Prestige bei denen nichts an, die die eigentlichen Urheberinnen und Urheber sind. Von Ausnahmen natürlich abgesehen.
Die Kritik daran ist berechtigt und wichtig!
Denn: Weiße - oder allgemeiner: Angehörige der sogenannten Dominanzkultur - haben sich kulturelle Ausdrucksformen angeeignet und davon profitiert. Allerdings mussten sie dabei nicht die Geschichte von Sklaverei und sogenannter Rassentrennung durchleben.
Dominanzkultur: Den Begriff hat im deutschsprachigen Raum Anfang der 1990er-Jahre die mittlerweile verstorbene Berliner Sozialwissenschaftlerin Birgit Rommelspacher geprägt. Sie wollte darauf aufmerksam machen, dass der damals in Deutschland grassierende Rassismus nicht nur das Problem kleiner Neonazi-Gruppen oder der deutschen Vergangenheit war. Der Begriff der Dominanzkultur betont demgegenüber, dass - Zitat - "Mächtige wie Machtlose rassistisch orientiert sind, wenn sie in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind und nicht gelernt haben, sich bewusst davon zu distanzieren." - Zitatende.
Mit Angehörigen der Dominanzkultur sind also all jene gemeint, die aufgrund der ethnischen Zuschreibung "weiß" von gesellschaftlichen Verhältnissen profitieren. Weiße müssen nicht damit rechnen, wegen ihrer Hautfarbe auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt zu werden; sie müssen nicht überdurchschnittlich viel verdienen, um in bestimmten Stadtteilen wohnen zu können und sie müssen nicht mit ungleich höherer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, Polizeigewalt ausgesetzt zu sein.
Ja, sie können Blues, Jazz und Hip-Hop machen, damit Geld verdienen und kulturelle Anerkennung gewinnen, ohne von all dem systematischen Übel, dem Schwarze ausgesetzt sind, überhaupt zu wissen. Das regt - so Greg Tate - immer mehr Leute auf - politische Aktivistinnen und Aktivisten, Intellektuelle, Künstlerinnen und Künstler. Deshalb ist eine Bewegung gegen kulturelle Aneignung entstanden, gegen Cultural Appropriation.
Die Jahrhunderte währende Geschichte der Aneignung kultureller Ausdrucksformen sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben, wenn man sich mit aktuellen Beispielen der Debatte beschäftigt.
Zurück zu Greg Tates Buch "Everything But The Burden": Ein anderes Problem, das der Buchtitel benennt, ist weniger offensichtlich und steckt im Untertitel: "Was Weiße von schwarzer Kultur nehmen". Es wirft nämlich die Frage auf, was schwarze Kultur überhaupt ist. Und diese Frage ist wesentlich schwieriger zu beantworten, als es auf den ersten Blick scheint. Zunächst geht es sicherlich um bestimmte Arten und Weisen, Musik zu machen, um kulturelle Ausdrucksformen im engeren Sinne, eben um Blues und Soul, Jazz und HipHop.
Aber es geht darüber hinaus auch um den sozioökonomischen Kontext, der diese Ausdrucksformen jeweils hervorgebracht hat. Im Falle der US-amerikanischen Geschichte müssen also auch die Baumwollplantagen in den früheren Südstaaten und die Bronx der 1970er-Jahre mitgedacht werden.
Oder, wie es der antikoloniale Theoretiker Frantz Fanon einst etwas provokant zusammenfasste: "Ohne Unterdrückung und Rassismus kein Blues."
Schwarze Kultur ist ohne historische und aktuelle Unterdrückungs- und Diskriminierungserfahrung nicht zu denken
Schwarze Kultur ist ohne historische und aktuelle Unterdrückungs- und Diskriminierungserfahrungen nicht zu denken. Aber auch das ist noch keine befriedigende Antwort auf die Frage nach den Bestimmungsmerkmalen schwarzer Kultur. Denn geteilte Diskriminierungserfahrung macht noch keine Kultur aus. Es müssen auch positive, geteilte Elemente hinzukommen: Vorlieben für Musik etwa, also geteilte Geschmäcker oder Haltungen, Festtage und Feierlichkeiten, gemeinsame Bezugspunkte. Historische Ereignisse wie die Dekolonisierung Afrikas oder auch Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft wie Martin Luther King jr., Rosa Parks oder Louis Armstrong.
Damit steht aber jeder Versuch, Kultur ethnisch - hier also über das Wort Schwarz - zu definieren, vor dem Problem der Vereinheitlichung. Wer von schwarzer Kultur redet, unterstellt implizit, es gäbe bestimmte Gemeinsamkeiten zwischen schwarzen US-Amerikanern und US-Amerikanerinnen und Schwarzen aus Südafrika, zwischen Schwarzen aus der Karibik zur Zeit der haitianischen Revolution von 1804 und schwarzen Geschäftsleuten aus der Londoner Innenstadt von heute, zwischen Anhängern der Rastafarian-Sekte und ehemaligen Spitzenpolitikerinnen wie Condoleezza Rice sowie auch zwischen schwarzen Männern und Frauen. Anders gesagt: Wer von schwarzer Kultur spricht, bezieht sich in der Regel auf Gemeinsamkeiten, für die Geschichte, Geografie und Geschlechterverhältnisse weitgehend irrelevant sind.
Der Schritt vom Verweis auf solche Gemeinsamkeiten hin zu der Annahme, es gäbe so etwas wie einen schwarzen Wesenskern, ist nur klein. Damit wird ethnische Zugehörigkeit essenzialisiert, das bedeutet, es wird unterstellt, schwarze Menschen würden einzig und allein aufgrund ihrer Hautfarbe bestimmte Eigenschaften miteinander teilen.
In der Geschichte des Kolonialismus und des institutionalisierten Rassismus hat dieser Essenzialismus eine zentrale und verheerende Rolle gespielt, um die brutale Unterdrückung und Entrechtung zu legitimieren. Denn um Menschen überhaupt in kategorisierbare Gruppen einteilen zu können, müssen ihnen Bestimmungsmerkmale attestiert werden, die sie im Unterschied zu allen anderen auszeichnen. Die - biologisch und genetisch übrigens längst zweifelsfrei widerlegte - Kategorisierung von Menschen in verschiedene Ethnien wirkt bis heute in zahllosen Klischees über sogenannte Mentalitätsunterschiede und kulturelle Eigenheiten fort: Dass schwarze Menschen "den Rhythmus im Blut haben", ist beispielsweise solch ein scheinbar anerkennendes, letztendlich aber zutiefst rassistisches Stereotyp.
Selbst wenn man also konstatieren muss: Alle Schwarzen, egal wann, wo und welchen Geschlechts, erfahren Diskriminierung. So fällt doch sofort ins Auge, dass sich die Formen der Ausgrenzung und Benachteiligung deutlich unterscheiden. Und das hat auch Folgen für schwarze Kultur. Ohne Rassismus kein Blues, sicherlich. Aber weder ist aus rassistischen Bedingungen allein der Blues entstanden, noch waren diese Bedingungen auch nur annähernd dieselben wie jene, die etwa Reggae oder Hip-Hop mit hervorgebracht haben.
Und nicht zuletzt, weil spätestens mit Aufkommen des Hip-Hop auch offensiv mit anderen Musikstilen gearbeitet wird - das Mixen ist schließlich konstitutiv für Hip-Hop - und eben auch für den "weißen Markt" produziert wird, halten schwarze Kulturtheoretiker wie Stuart Hall die schwarze populäre Kultur auch für "notwendigerweise widersprüchlich".
Um das Widersprüchliche dreht sich die Debatte um kulturelle Aneignung aber nicht.
Debatte der kulturellen Aneignung dreht sich nicht nur um Musik
Sie dreht sich auch nicht nur um Musik. Wie am Beispiel Hip-Hop ebenfalls schnell deutlich wird, geht es bei alldem um weit mehr als um Klang und Gesang. Hip-Hop ist nicht nur ein Musikstil, der die Dominanz von Soul ablöste. Sein Aufkommen ging einher mit Breakdance, mit Graffiti, mit einem neuen, zunächst jugendkulturellen Lebensstil.
Wenn um kulturelle Aneignung heute so verbissen gestritten wird, hat das genau damit zu tun: Es geht nicht nur um Kultur im engeren Sinne, also um Musik, Theater, Tanz, bildende Kunst. Es geht um Kultur in einem weiten Sinn, verstanden als Lebensweise, als Form der Wahrnehmung; um Kultur als Frage danach, wie Menschen sich und die Welt, in der sie leben, mit Sinn ausstatten.
Ein Musikstück oder ein Gemälde ist dann immer nur Ausdruck dieser allgemeinen Kultur. Und es kann vor diesem allgemeinen Hintergrund sogar etwas so Banales wie eine Frisur sein, die kulturelle Kämpfe um Aneignung entfacht.
Die Frage nach der kulturellen Aneignung wird allerdings längst nicht mehr nur in den USA gestellt und heftig diskutiert. Hier drei Beispiele aus Deutschland.
Anfang des Jahres 2012 inszenierte das Berliner Schlosspark Theater das Stück "Ich bin nicht Rappaport" von Herb Gardner. Es spielt im New Yorker Central Park und handelt von der Freundschaft zweier älterer Herren. Einer der beiden ist Afroamerikaner. In der Berliner Aufführung wurde die Rolle mit dem weißen Schauspieler Joachim Bliese besetzt, der zu diesem Anlass mit schwarzer Schminke bemalt wurde. Die Kritik war heftig. Sie entzündete sich nicht nur an der empörenden Tatsache, dass man sich offenbar nicht die Mühe gemacht hatte, einen schwarzen Darsteller zu suchen. Womit einem Schwarzen ein Engagement wieder einmal ganz konkret vorenthalten wurde. Die Kritik richtete sich vor allem auf die Geschichtsblindheit dieser Anstellungspolitik: Das Schwärzen von Gesichtern weißer Schauspieler - als Blackfacing bekannt -, damit diese auf der Bühne Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen spielen können, steht in einer üblen Tradition. Es geht zurück auf die Minstrel-Shows in den USA des späten 19. Jahrhunderts. Darin wurden Schwarze durch angemalte Weiße in stereotypen Darstellungsformen veralbert und gedemütigt, zur Belustigung des weißen Publikums.
Beides muss jede Kulturproduktion reflektieren: das Vorenthalten eines Jobs für einen schwarzen Darsteller ebenso wie die rassistische Darstellungstradition des Blackfacing. Denn wenn es nicht reflektiert wird, werden systematische Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt wie auch herabwürdigende Stereotype immer weiter tradiert. Und zwar auch, wenn es - wie das Schlosspark Theater natürlich sofort versicherte - nicht so gemeint ist.
Auch im zweiten Beispiel geht es um Blackfacing. Zumindest stand der Vorwurf im Raum. Erhoben hat ihn Hengameh Yaghoobifarah, die als Autorin für die "taz" und für das feministische "Missy Magazine" tätig ist. Im "Missy Magazine" schrieb sie über das Fusion Festival, ein nördlich von Berlin jährlich stattfindendes Techno-Event. Das Festival versteht sich als alternativer Ort, als -, Zitat, "ein Karneval der Sinne, indem sich für uns alle die Sehnsucht nach einer besseren Welt spiegelt". Zitatende. Aber gerade das karnevalistische Element war es, das Yaghoobifarah aufstieß.
Die Journalistin beklagte in ihrem Text "Karneval der Kulturlosen" einerseits, dass es sich beim Fusion Festival um eine beinahe rein weiße Veranstaltung handle, Menschen mit Migrationshintergrund und People of Color also vor allem durch Abwesenheit glänzten. Zitat:
"Ob ihre Abwesenheit wohl der Anlass dafür war, dass weiße Leute Personen of Color cosplayten? Ihre stereotypen, rassistischen Kostüme waren jedenfalls überall. Neben den Dreadlocks trugen weiße Menschen Kimonos, Kegelhüte, Oberteile mit random chinesischen Zeichen, Bindis, Saris, Federkopfschmuck, Tunnel, Turbane, Sharwals oder einzelne Federn im Haar - gerne einfach ins verfilzte Haar gesteckt. Wie Karneval der Kulturen in Berlin, nur ohne Kulturen. Wir schreiben das Jahr 2016 und bei der Mehrheit der Festivalbesucher*innen ist nicht angekommen, dass Red-, Black-, Brown- und Yellow-Facing unterste Schublade in der Garderobenwahl sind."
Weiße, Angehörige der Dominanzkultur, nehmen sich, so der Vorwurf, einfach irgendwelche Kleidungsstücke oder Frisuren, die nicht aus ihrer Kultur stammen. Sie eignen sie sich an, betreiben also kulturelle Aneignung. Dreadlocks bei Weißen sind demnach nicht nur illegitim, sie werden hier sogar mit Blackfacing gleichgesetzt, Kimonos werden als "rassistische Kostüme" bezeichnet.
Bevor wir zu den Problemen kommen, die mit dieser Gleichsetzung verbunden sind, zunächst noch das dritte Beispiel: Die postkoloniale Theoretikerin Nikita Dhawan, Professorin für Politikwissenschaft in Innsbruck, hat in einem Text für das Berliner Theater Hebbel am Ufer linke Protestbewegungen kritisiert. Dhawan sagt den westeuropäisch-nordamerikanischen Straßenprotesten der letzten Jahre eine Freude am eigenen Widerstand nach, die an Selbstverliebtheit grenze.
Dabei komme vor allem die, Zitat, "feudale Einstellung" der Protestierenden zum Ausdruck. Proteste wie etwa die Bewegung Occupy Wall Street hätten häufig strukturelle soziale Ungleichheit nicht nur nicht thematisiert, sondern sogar verschleiert. Denn es bestehe - so Dhawan - ein "himmelweiter Unterschied zwischen einem arbeitslosen Jugendlichen in Spanien und einem Farmer in Indien, der sein Land verliert aufgrund des Zwanges, genetisch veränderte Monsanto-BT-Baumwolle anzubauen".
Die einen, so wird suggeriert, protestieren aus Spaß und ohne Risiko, bei den anderen geht es um Leben und Tod. Es geht damit ganz grundsätzlich um Fragen der Legitimität, also um die Frage, wer wann wozu Stellung beziehen darf.
Das Absprechen von Legitimation
Und das verbindet auch alle drei Beispiele. Es geht jeweils um das Absprechen von Legitimation, um Delegitimierung: Einem weißen Schauspieler wird die Legitimation abgesprochen, einen Schwarzen darzustellen; Angehörigen der Dominanzkultur wird das Recht abgesprochen, bestimmte Frisuren wie Dreadlocks und Kleidungsstücke wie Kimonos zu tragen; und Teilnehmerinnen und Teilnehmern linker Demonstrationszüge wird die Berechtigung abgesprochen, wirklich für die Belange eintreten zu können, für die sie protestieren, nämlich für soziale Gerechtigkeit.
In allen drei Beispielen wird die Legitimität an kulturelle Zugehörigkeit geknüpft. Oder anders gesagt: Die Zugehörigkeit zu einer Kultur wird als entscheidend dafür angesehen, wer befugt ist, was zu tun. Ob es nun darum geht, gegen den Kapitalismus zu protestieren, verfilzte Haare zu tragen oder bestimmte Rollen zu spielen.
Unterscheiden muss man dabei unbedingt zwischen der berechtigten Empörung über den Ausschluss von People of Color bei einer subkulturellen, linken Veranstaltung einerseits und andererseits dem Versuch, als Antwort darauf kulturelle Eigenheiten zu betonen. Als wäre den Abwesenden damit direkt gedient, wird versucht, die Verbindung von kulturellen Zeichen wie etwa Dreadlocks, ihrer Bedeutung und den TrägerInnen dieser Zeichen festzuzurren: Widerstand, den können nur indische Kleinbauern (oder vergleichbare Subalterne) auf angemessene Art und Weise leisten, Dreadlocks stehen legitim nur Schwarzen zu. Das ist eine Re-Essenzialisierung, also die Wiedereinführung der Behauptung einer Wesensverbindung.
Mit der Durchsetzung poststrukturalistischer Theorieansätze galten solche Wesensbestimmungen eigentlich als passé - deshalb die Vorsilbe Re-. Denn sie ist analytisch wie auch politisch extrem problematisch. Politisch ist sie vor allem deshalb so gefährlich - so viel sei vorweggenommen -, weil sie in letzter Konsequenz Solidarität unmöglich macht.
Analytisch besteht das Problem darin, ungeheure Verallgemeinerungen vorzunehmen. Was hat das nicht-kommerzielle Techno-Festival in Mecklenburg tatsächlich mit jenen Minstrel-Shows in den USA des späten 19. Jahrhunderts gemeinsam, auf denen weiße Darsteller sich das Gesicht schwarz anmalten?
Ist das mit der Kleidungswahl des Fusion-Publikums gleichzusetzen? Nein. Denn erstens handelt es sich bei dem nicht-kommerziellen Festival nicht um eine Institution wie das Theater. Zweitens verkleiden sich die Leute dort auch nicht, sondern leben in der Regel diesen Stil. Kleider und Frisuren funktionieren dabei als Zeichen, die eine bestimmte Botschaft senden.
Damit verorten sich diese Leute - so unreflektiert und peinlich das auch oft daherkommt - eher in einer anderen Tradition des kulturellen Zeichengebrauchs, nämlich dem subkulturellen und gegenkulturellen. Es gibt nämlich neben dem herabwürdigenden und rassistischen auch noch einen achtenden, solidarischen Zeichentransfer.
Und zudem nehmen sie mit ihrem Outfit auch keinen Minderheitenangehörigen und Marginalisierten den Job oder die Repräsentationsmöglichkeit weg. Minstrel-Show und Fusion gleichzusetzen, läuft deshalb immer auch Gefahr, erstere zu verharmlosen. Nach dem Motto, wenn die Fusion wie Minstrel ist, kann letzteres so schlimm ja nicht gewesen sein.
Darüber hinaus basieren die Vorwürfe der kulturellen Aneignung oft ganz grundsätzlich auf einem sehr statischen Verständnis von Kultur. Das gilt auch für Yaghoobifarahs und Dhawans Ansätze. Zu Ende gedacht läuft ihre Kritik nämlich auf ein starres - und damit extrem konservatives - Verständnis von Kultur hinaus.
Kultur meint dann: kollektiv geteilte Merkmale - wobei angeblich feststeht, wer zum Kollektiv gehört und um welche Merkmale es geht.
Wenn es nur für Schwarze legitim sein soll, Dreadlocks zu tragen, wird eine kulturelle Praxis - das Frisieren - an eine als kulturell verstandene Zugehörigkeit gebunden - Schwarzsein. Kultur besteht dann nicht mehr aus Prozessen, in denen Menschen bestimmte Handlungen mit Sinn und Bedeutungen ausstatten. Stattdessen werden sie bloß als ausführende Agenten und Agentinnen eines bereits vorhandenen Fundus an Bedeutungen gedacht. Wer sich nicht daran hält, gehört dann unweigerlich zu den "Kulturlosen", wie Yaghoobifarah die Fusion-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer ja im Titel ihres Textes auch nennt.
Dabei hatte linke Kulturtheorie von den Postcolonial Studies, den britischen Cultural Studies bis zur feministischen Queer Theory in den letzten Jahrzehnten doch genau das Gegenteil zum Ziel. Die Unterschiede zwischen Angehörigen vermeintlich homogener Gruppen wurden betont, gehen mit ihnen doch meist auch Machtgefälle einher. Schwarze und weiße Frauen sind ebenso wenig in derselben Position wie es weibliche und männliche Schwarze sind. Im Zuge dieser Sensibilisierung für Differenzen wurde auch stark auf die politisch-emanzipatorischen Effekte von Vermischung, Mix und Hybridität gesetzt und es erschien als zentrale Errungenschaft, kollektive Identität wie etwa Frau- oder Schwarzsein nicht mehr als fixe und ahistorische Gegebenheit zu betrachten.
Der Kulturwissenschaftler Stuart Hall etwa hatte vorgeschlagen, Identitäten nicht als feste Größen zu begreifen. Kulturelle Identität sei "[k]ein Wesen, sondern eine Positionierung". Sie ist nie stabil. Und es gibt auch keine Garantie für ihren Fortbestand. Und zudem wurden und werden solche Vermischungen ja auch bei Minderheiten selbst aktiv betrieben: Man denke nur an Mister T, den schwarzen Schauspieler mit seinem Irokesenschnitt. Ist das Ausbeutung einer Minderheitenpraxis durch eine andere, sozusagen schwarzes Redfacing? Oder an den Kommandanten der südmexikanischen Guerilla EZLN, der sich Comandante Brus Li nennt. Darf er sich auf internationale Popkultur beziehen, anstatt sich bei indigenen Traditionen zu bedienen?
Doch genau gegen diese Errungenschaften der eigenen Theorietradition treten nun die Vertreterinnen und Vertreter des Cultural Appropriation-Ansatzes häufig an. Sie wollen, dass eine möglichst festgeschriebene Zugehörigkeit darüber entscheidet, wer legitimerweise etwas tun oder sagen darf, wenn sie zum Beispiel darauf pochen, dass Weiße keine Dreadlocks tragen sollen.
Dieser Entzug von Legitimität - das ist wichtig festzuhalten - ist noch keine Zensur. Der Zensurvorwurf kommt in der Regel von rechts, wo man sich schon seit Jahrzehnten vom vermeintlichen Tugendterror der Political Correctness tyrannisiert sieht. Doch die Kritik an kultureller Aneignung wird aus der Perspektive der Minderheit ausgesprochen und hat in der Regel wenig Möglichkeiten, auch politisch durchgesetzt zu werden. Das Berliner Theater spielte seine Aufführungen, das Fusion Festival findet weiterhin statt und protestiert wird in den Reihen der linken europäischen Mittelschicht ebenfalls.
Auch wenn es nicht um Zensur geht, höchst politisch ist der Vorwurf der kulturellen Aneignung dennoch. Damit zu den Problemen auf der politischen Ebene.
In der Dominanzkultur wird eine kulturelle und politische Einheit suggeriert
In der Dominanzkultur wird eine kulturelle und politische Einheit suggeriert. Die starke Betonung, dass bestimmte Frisuren und Kleidungsstücke, also Zeichen zu einer bestimmten "Kultur" gehören und dieser nicht entliehen werden sollten, schreibt auch die "Weißen" - wie links oder wie arm und marginalisiert auch immer - auf ihre angebliche "Kultur" fest.
Auch Nikita Dhawans hämischer Hinweis auf die Begeisterung weißer MitteleuropäerInnen und NordamerikanerInnen für das "Spektakel des Widerstands" lässt letztlich keinen Ausweg. Wer der Dominanzkultur angehört, kann demnach noch so heftig gegen sie protestieren, er oder sie - sie etwas weniger vielleicht - profitiert strukturell.
Birgit Rommelspachers Definition der Dominanzkultur zielte ebenfalls auf unbewusste Beteiligung und Profite. Man profitiert vom ausgesprochenen Rassismus anderer, auch, wenn man selbst erst mal wenig aktiv dazu beiträgt. Man profitiert als weißer Mensch von systematischen Privilegien.
Das Weißsein lässt sich nicht abstreifen, aber man kann sich von den Normen und Werten der Dominanzgesellschaft distanzieren. Darin bestand ein entscheidender Punkt in Rommelspachers Definition der Dominanzkultur: Die Möglichkeit einer bewussten Distanzierung wird explizit eingeräumt. In diesem Kontext muss auch das Aufgreifen und Adaptieren von Zeichen aus anderen Weltgegenden gesehen werden - so merkwürdig, unreflektiert und oberflächlich das auch oft geschah und geschieht.
Es gibt eine linke und gegenkulturelle Tradition, in der es um ein Nicht-Einverstandensein ging und eine Abgrenzung von dominanten, kulturellen Umgangsformen inklusive Warenform und Fortschrittsparadigma. Dieses Nicht-Einverstandensein sollte demonstriert werden, und zwar von den sogenannten Stadtindianern der 1970er-Jahre über den Irokesenschnitt im Punk und bis hin zu den Dreadlocks. Auch wenn von dieser gegenkulturellen Tradition bei Chanel-Bumerangs für 2.000 Euro und Dreadlocks auf dem Laufsteg wenig übrig geblieben zu sein scheint - es gibt sie.
Wenn aber nur denjenigen die Legitimität zum Protest zugestanden wird, die direkt von einem kapitalistischen Übel betroffen sind, am besten noch auf Leben und Tod, dann ist jede Form von Bündnis und Allianz unmöglich. Ja, schlimmer noch: Solidarisches Handeln erscheint dann bloß noch als heuchlerische Aktion Privilegierter. Solidarität selbst wird schließlich unmöglich gemacht. Wo bleiben dann Handlungsmöglichkeiten?
Auch die Ausgegrenzten, Marginalisierten, die ethnischen Minderheiten werden im Cultural-Appropriation-Ansatz oft vereinheitlicht. Es wird unterstellt, eine strukturelle Ausgrenzung führe zu kollektiv geteilten Haltungen und Vorlieben. Aber: Geteilte Diskriminierungen waren noch nie Garant für kollektive Mobilisierungen. Überhaupt wird der Zusammenhang von Diskriminierung und Geschmack viel zu kurzschlüssig gedacht. Trägt Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo ihre Dreads, weil sie gewissermaßen natürliche Sympathien für die Rastafarians hat? Wohl kaum.
Im Juli 2016 wurde im buddhistischen Kloster in Bagan in Myanmar ein spanischer Tourist verhaftet, weil er ein Buddha-Tattoo auf dem Bein trug. Die Religiösen empfanden das als unangemessen und riefen die Polizei. Sie transferierten ihre moralische Regung - derjenigen Yaghoobifarahs durchaus ähnlich - also gleich ins Juristische. Ob das als emanzipatorischer Akt durchgehen kann, der einer Minderheit die Hoheit über den Gebrauch ihrer Zeichen zurückerobert, ist mehr als fraglich. Denn schließlich ist es eine Errungenschaft der Säkularisierung, dass Religiöse niemandem - außer ihren Anhängern - die Wahl des Schmucks und der Klamotten vorschreiben dürfen. Die Vereinheitlichungen von Gruppen und die an sie geknüpfte Legitimität im Gebrauch von Zeichen sind also häufig mit restriktiven Regulierungen verbunden. Sie sind zwar nicht selbst Zensur, führen aber oft zu autoritärer Politik.
Im Kampf gegen Diskriminierung waren und sind der geteilte Erfahrungshorizont und die gemeinsame Geschichte als Referenzpunkt ungeheuer wichtig. Auch für die Selbstermächtigung der Black-Liberation-Bewegung. Denn ganz generell sind soziale Bewegungen zu einem gewissen Ausmaß auf die Kollektivität eines konstruierten Wir angewiesen. Nur darüber kann Solidarisierung und Identifizierung stattfinden.
Was ist kulturelle Aneignung?
Der Bezug auf die schwarze Kultur, die geplündert wird, und die Wut darauf, dass dies nur zum Nutzen und Wohle anderer geschieht, ist durchaus nachvollziehbar. Vielen der Kritikerinnen und Kritiker der kulturellen Aneignung ist dabei das Dilemma jeder emanzipatorischen Identitätspolitik durchaus bewusst: sich auf Kategorien beziehen zu müssen, die zugleich die Grundlage der Diskriminierung bilden.
Diejenigen aber, die die schwarze Kultur als einheitliche Essenz verteidigen wollen, fallen hinter die Errungenschaften der eigenen Theorie- und Bewegungsgeschichte weit zurück.
Schwarze Befreiung, meinte auch Greg Tate 2003 in "Everything But The Burden", muss damit beginnen, Konzepte wie Schwarz und Weiß infrage zu stellen, anstatt sie einheitlich und eindeutig machen zu wollen.
Von Jens Kastner, mit Nina Lentföhr und Daniel Berger, Technik: Katrin Fidorra, Regie: Anna Panknin, Redaktion: Barbara Schäfer