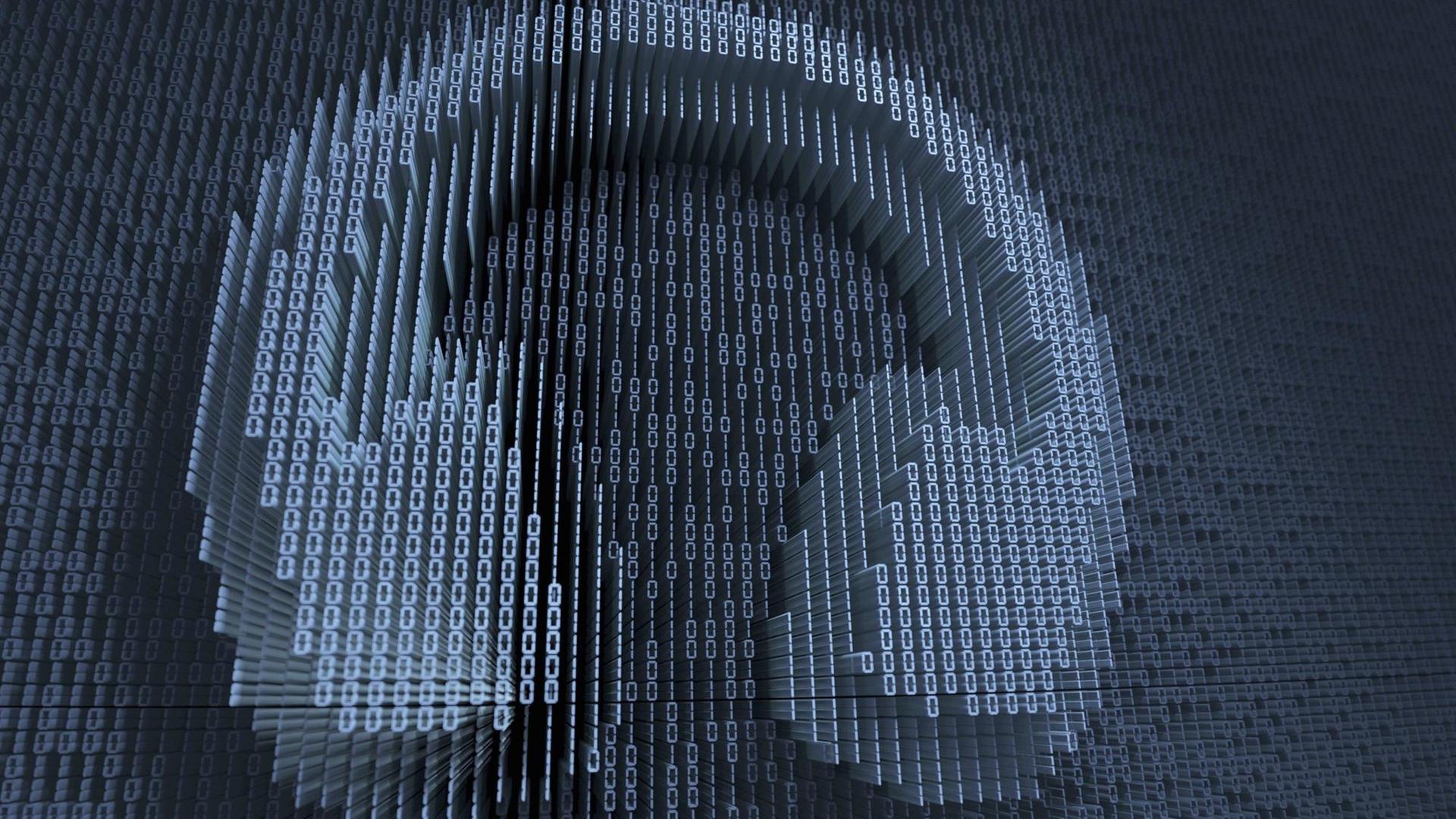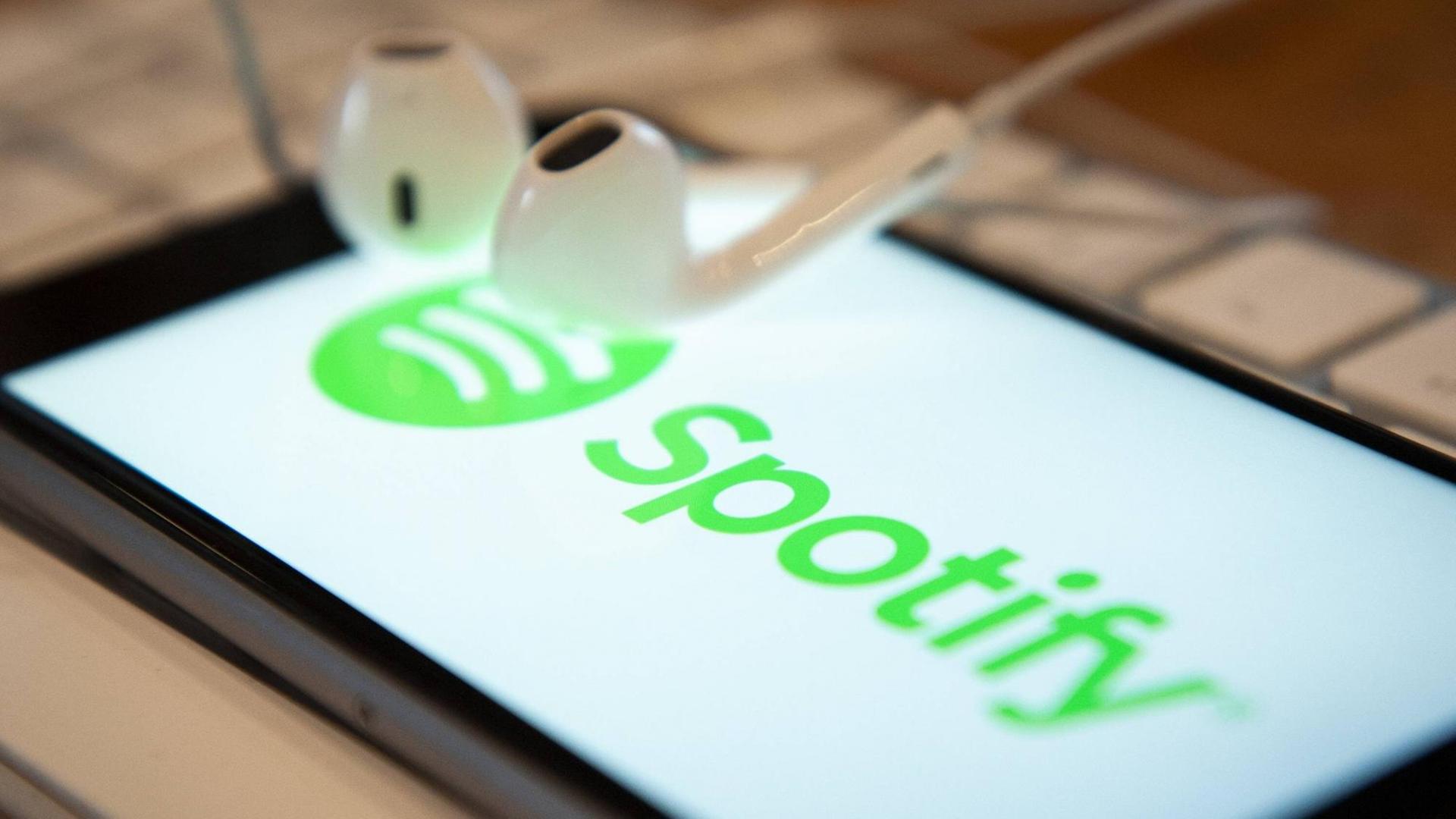Als The Whitest Boy Alive 2006 ihr Album "Dreams" veröffentlicht haben, war die Indiepopwelt noch in Ordnung. Klar, die Musikindustrie steckte voll in ihrer Krise – Daniel Ek hat Spotify zu dem Zeitpunkt überhaupt erst gegründet – aber es war möglicherweise die letzte Zeit, in der sich Musikmagazine wie "Intro" oder "Spex" einig waren: Die Band The Whitest Boy Alive, die ist super. Musikfans konnten sich in dieser Zeit noch auskennen und wissen, wer gerade angesagt ist und wer es in einem halben Jahr sein wird.

Doch 2019, allerspätestens, ist alles anders: Die Krise der Musikindustrie ist vermeintlich überwunden, "Spex", "Intro", "De:Bug", "Groove" gibt es – wenn überhaupt – nur noch online. Ist deshalb auch die Zeit, in der es möglich war, sich in der Popmusik auszukennen, vorbei?
Von der Masse erschlagen
"Ja, das geht mir auch so", sagt Annika Hintz. "Ich bin ja auch tagtäglich mit Musik beschäftigt im Grunde genommen." Sie sucht seit zwölf2 Jahren die Bands für das MS-Dockville-Festival in Hamburg aus. "Auch ich fühle mich manchmal von der vielen Musik, die einfach verfügbar ist, etwas erschlagen." Die Entwicklung der Headliner auf Festivals zeigt das Phänomen besonders gut: 2007 waren Tocotronic, die es damals schon eine halbe Ewigkeit gab, Headliner. Und The Whitest Boy Alive. Sie wissen schon – auf die sich vor 12 Jahren alle einigen konnten. "Also gefühlt war es damals schon anders. So, dass man einen höheren Fokus auf bestimmte Acts hatte, und die nicht so auf so viele verteilt waren", sagt Annika Hintz.

2019 ist das Geschäft mit den Headlinern, also Bands, die viele Fans anziehen und viele kennen müssen, anders. Als Annika Hintz Ende 2018 Billie Eilish als Headliner gebucht hat, war ihr eigentlich so musikbegeisterter und informierter Freundeskreis gar nicht angetan. Aus einem einfachen Grund: "Da kannte sie noch keiner." Bis dann Ende März das Debütalbum erschienen ist. "Vor zwei, drei Wochen bekam ich eine Nachricht, dass sich das ja als total gutes Händchen bewiesen hätte."
Die 17-jährige Billie Eilish kannten viele potenzielle Festivalgänger ein halbes Jahr vor dem Festival noch nicht mal. Und nun ist sie Headliner. Die Erkenntnis daraus: Die Popwelt ist wahnsinnig schnelllebig geworden. Das weiß aber im Vergleich dazu, wer die nächste tolle, große Band wird, wohl jeder. Billie Eilish zeigt aber noch ein aktuelles Phänomen:
"Ich höre nur Punk" gibt es nicht mehr
"Früher gab es halt wirklich viel mehr Genrehörer, die dann gesagt haben ‚Ich höre nur Punk’ oder ‚Ich höre nur Rock’, ‚Ich höre nur, was im Radio läuft’. Und heutzutage ist da jeder bereitwillig dabei, alles zu hören."
Was heißt: Die Masse an Bands und Musiker*innen, die ein Fan kennen kann, ist größer geworden, wenn er nicht mehr nur Punk hört, sondern Punk, Rap, Folk und Pop – falls die Musik überhaupt noch einem Genre zuzuordnen ist. Billie Eilish sagte in einem "New York Times"-Interview, dass sie sich weder der Popwelt noch dem Hip-Hop-Genre zuordnen lassen will. Sie macht eben Billie-Eilish-Kind-Of-Music. Christoph Jacke ist Sprecher des Instituts für Kunst, Musik, Textil der Universität Paderborn und meint: Die Auskenner, die auf Konzerten mit ihrem Geheimwissen über noch unbekannte Bands prahlen, die gibt es vor allem in Berlin immer noch zuhauf. Aber:

"Ich glaube, dass es eine gewisse Individualisierung und eine gewisse Abkehr von einer auch zwanghaften Sozialisierung gibt - die ja schön waren – der Club, wo man hingeht, der Plattenladen, wo man hingeht. Mann gerne mit Doppel-n."
Jeder darf also hören, was er will und man – mit einem n – muss sich gar nicht mehr so auskennen? Diese Erfahrung hat auch Dennis Pohl gemacht, er ist der Chefredakteur von "spex.de":
"Früher war das ja so: Man wollte alles dafür tun, um einer gewissen Szene anzugehören. Wenn man dann irgendwie zu diesem Erhabenen-Kanon von Insidern gehört hat, die mehr wissen als andere ... Aber die gibt’s nicht mehr so richtig."
Er meint: Klar, er hat auch vor zehn Jahren schon sagen können: ‚Die neue gehypte Band The-Irgendwas? Nie gehört.’ Wobei ihm das heute ständig passiert, sagt er.
"Irgendwelche Bands, die auf Spotify und Co wahnsinnig gut laufen, die irgendwie Klicks in zweistelliger Millionenhöhe haben, dass ich noch nie was von ihnen gehört habe."
Playlists statt Platten
Spotify will die Hörer an seine Plattform binden – und nicht an Künstler*innen. Deshalb werden den Hörern vor allem Playlists angeboten. Und die bedeuten vor allem eines:
"Meine Schwester hat da ganz passend mal gesagt: ‚Ich kenne den Song, ich weiß aber nicht, wer der Künstler ist’. Und ich glaube, das passiert ganz vielen einfach, die heutzutage Musik über Playlisten konsumieren, die dann viele Songs kennen, aber sich gar nicht mehr verbunden mit dem Künstler oder der Künstlerin fühlen", sagt Annika Hintz.

2019 ist es viel einfacher geworden, Musik zu veröffentlichen. Aber als Künstler sichtbar zu werden und auch gekannt zu werden, das ist viel schwieriger. Christoph Jacke sieht diese Entwicklung – immer mehr Musiker*innen und damit auch Musik, aber positiv:
"Vieles ist viel sichtbarer als früher und nicht mehr so gefiltert wie durch irgendeine Musiksendung oder den Plattenladen um die Ecke, die Peergroup. Das gibt es alles bedingt natürlich auch noch. Man kann so sagen: Im Grunde ist das Ganze wieder das totale Demokratieversprechen."
Denn es ist natürlich längst nicht mehr so, dass sich ein paar Musikjournalisten darüber einigen, wer toll sein wird und damit eine Relevanz schaffen. Oder sogar nur ein Mann wie John Peel bei der BBC. Für Dennis Pohl hat sich in seiner Arbeit als Musikjournalist vor allem eines geändert:
"Ich finde, heute ist es eher schwieriger geworden, die wirklich guten Sachen zu entdecken."
Weil es von den mittelguten Sachen, die klingen wie andere mittelgute Songs, wirklich enorm viel gibt. All die Bands und Musiker*innen dahinter zu kennen – das braucht eigentlich keiner. Popkultur-Fan sein, heißt heute also: Mut zur Lücke. Und damit angeben.