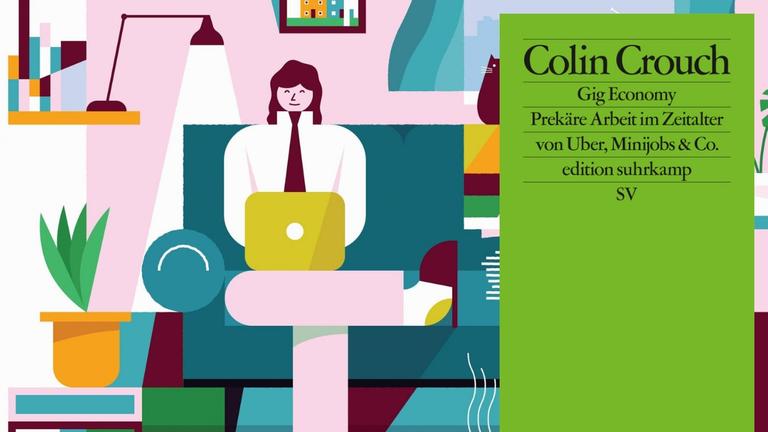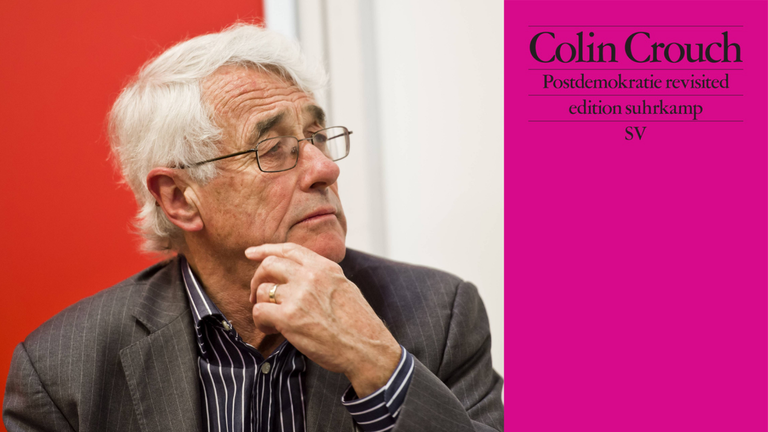
Es gehe ihm um den „schlechten Gesundheitszustand der Demokratie“, schrieb Colin Crouch im Jahr 2000, in seinem ersten Text zum Thema – „Coping with Post-Democracy“, das als Pamphlet der Fabian Society erschien. Als Hauptursache benannte er damals die Vorherrschaft der Interessen von Konzernen über praktisch alle anderen Interessen.
„Zusammen mit der unvermeidlichen Entropie der Demokratie führt dies dazu, dass die Politik wieder zu einer Angelegenheit geschlossener Eliten wird, wie das in vordemokratischen Zeiten der Fall war.“
Der Befund bleibt bitter. Heute, resümiert Crouch in seiner aktuellen Bestandsaufnahme, sei es „um die Demokratie überall in der entwickelten Welt schlechter bestellt als zu Beginn des Jahrhunderts, als ich ‚Postdemokratie‘ schrieb. […] Unsere Politik ist dafür anfällig, von Milliardären oder Machthabern gekapert zu werden, die die sozialen Medien manipulieren, um diverse Arten von Hass anzufachen und von den Folgen eines unregulierten Kapitalismus abzulenken.“
Und doch, erklärt Crouch schon im Vorwort, habe er sich damals in mindestens drei Punkten geirrt. Er habe zu viel Gewicht auf Augenblicke bürgerlichen Engagements gelegt und die Rolle der Institutionen unterbewertet. Die der Gerichte zum Beispiel. In Polen, sagt der Soziologe im Gespräch, könne man derzeit erleben, wie sehr weit rechts stehenden Kräften daran gelegen sei, diese Institutionen politisch unter Kontrolle zu bringen.
Es fehle an politischem Bewusstsein
Auch seine Einschätzung des Feminismus korrigiert Crouch in seinem neuen Buch. Der habe nicht nur „eine wichtige Funktion bei der Bekämpfung postdemokratischer Zustände“. Der Feminismus könne auch helfen, die überfällige neue Agenda der mittleren und unteren Klassen zu entwickeln. Denn es fehle, sagt Crouch, an Visionen für ein Leben in der postindustriellen Gesellschaft.
„Die postindustrielle Gesellschaft hat kaum Gruppen hervorgebracht, die ein politisches Bewusstsein haben. Wir, die normalen Leute, wissen nicht mehr, wer wir sind. Daher fällt es uns tatsächlich schwer, uns für die Politik zu engagieren. Das ist nicht die Schuld irgendeines Politikers. Die Politiker ringen damit. Sie haben Mühe, noch zu verstehen, was Menschen wollen. Deshalb müssen sie zum Beispiel Marktforschungstechniken anwenden. Und so wird ihre Beziehung zu uns wie die Beziehung eines Unternehmens zu seinen Kunden.“
Vor allem aber, bilanziert Couch, habe er den „xenophoben Populismus“ unterschätzt „und nicht vorausgesehen, dass er nur in zweiter Linie eine Gegenbewegung zu postdemokratischen Tendenzen darstellt, in erster Linie aber zu deren Verschärfung führt.“
Rechtspopulisten schreibt Crouch nostalgischen Pessimismus zu
Zur Ideologie und Strategie der fremdenfeindlichen Populisten, der „Xenophobisten“, wie Crouch sie nennt, liefert er umfangreiche Analysen. Mitunter, so scheint es, auch aus Angst vor falschen Freunden. „Sie könnten meine Argumente benutzen“, sagt er im Gespräch und lacht. Weil auch sie postulieren, dass sich die Politik meilenweit vom Volk entfernt habe. Und weil ihre Ursprünge etwas mit dem Phänomen der Postdemokratie zu tun haben. Ihr Einfluss wuchs nach der Finanzkrise. Ihre Haltung beschreibt Crouch als „nostalgischen Pessimismus“.
„Diese Stimmung kann nur von der extremen Rechten wirklich gebündelt werden. Weil die sagt: Die Welt ist schlecht. Wir müssen den Ausländern widerstehen, den Fremden. Wir dürfen nicht teilen. Wir behalten, was wir haben und schützen es und verteidigen es.“
Ein Denken, das uns – da ist er überzeugt – ins Dunkel führt. Crouch sieht dabei durchaus, dass Menschen in aller Welt von sehr realen Unsicherheiten bedrängt werden. Nicht zuletzt als Folge der Corona-Pandemie. Die ja auch Probleme von Macht und Reichtum, von Korruption und fehlender politischer Kontrolle spiegelt, nicht nur bei ihm zuhause, in Großbritannien.
Die Pandemie könnte den Neoliberalismus schwächen
„Die Covid-Krise hat das ganz klar gezeigt: Die Regierung konnte alle Regeln des fairen Wettbewerbs für Regierungsaufträge aussetzen. Sie hat sich verteidigt, in dem sie erklärte: ‚Wir müssen ja schnell handeln. Und die Leute, die wir kennen, das sind unsere Freunde.‘“
Und doch habe gerade die Pandemie uns gezeigt, wie abhängig wir von einem funktionierenden Gemeinwesen sind. „Wir brauchen einander. Und wir brauchen öffentliche, kollektive Institutionen. […] Das ist für den reinen Neoliberalismus ein Problem. Neoliberalismus ist eine sehr individualistische Theorie. Es gibt einen neuen Kollektivismus, wahrscheinlich –– aus dieser Pandemie.“
Man hat häufiger den Eindruck, dass Crouch so einiges zurechtrücken und klarstellen möchte. Was ein Vorteil ist. Zwingt es ihn doch, präziser und detaillierter zu argumentieren. So ist sein Buch zugleich vielschichtige Analyse, Mahnung und Aufruf zum Handeln.
„Postdemokratie war eine Warnung, sozusagen eine negative Utopie: In diese Richtung geht die Entwicklung, und das ist schlecht. Wer als Autor*in einer solchen Dystopie blanken Pessimismus vermeiden will, muss dem Leser aber auch sagen: Wenn dir diese Entwicklung nicht gefällt, können wir etwas dagegen tun.“
Colin Crouch will die Demokratie nicht schlecht reden, er will sie retten. Und auch die Politiker nicht in Bausch und Bogen verdammen.
„Es ist verlockend, die Entfernung der Politiker von den Wählern allein auf die Arroganz und Eitelkeit Ersterer zurückzuführen, doch es gibt Probleme im Verhältnis beider, die selbst jene Politiker betreffen, die durch und durch guten Willens sind.“
Obendrein bricht er eine Lanze für Europa. Weil ein Grund für postdemokratische Tendenzen die Tatsache sei, dass nationale Politik gegenüber dem globalen Kapital meist machtlos bleibt.
„Demokratie ist auf der Ebene des Nationalstaates gefangen und wird dadurch hilflos. In der Europäischen Union stehen die Dinge anders. Sie ist eine supranationale, demokratische Institution. Deshalb glaube ich fest an sie.“
Colin Crouch: „Postdemokratie revisited“
Edition Suhrkamp, Übersetzung: Frank Jakubzik, 278 Seiten, 18 Euro.
Edition Suhrkamp, Übersetzung: Frank Jakubzik, 278 Seiten, 18 Euro.