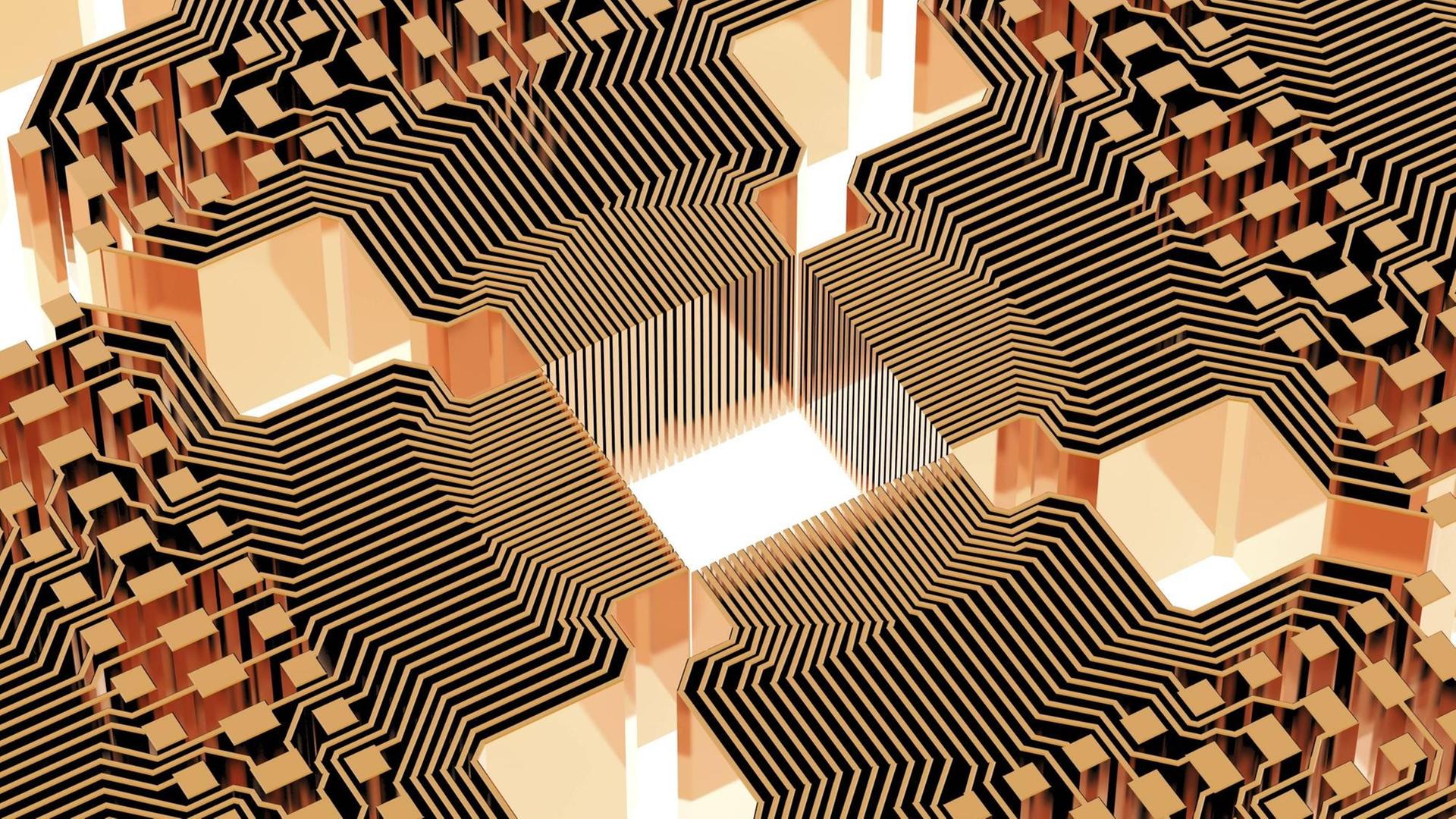In Yorktown Heights, 45 Meilen nördlich von New York, findet sich eines der Forschungszentren des Computerkonzerns IBM. Hier arbeitet die deutsche Physikerin Heike Riel und in ihrem Labor hat sie einen Aufkleber angebracht, deutlich sichtbar für ihr Team.
"Da steht drauf: You think too classical!"
Auf deutsch: Ihr denkt zu klassisch! Weil Riel bei einem IT-Riesen angestellt ist, geht es natürlich um Computer - in diesem Fall den Quantencomputer. Der unterscheidet sich von einem klassischen Rechner ganz grundlegend.
"Im klassischen Computing haben wir uns die Eins und die Null als Bit zurechtgelegt. Damit sind aber nicht alle Probleme exakt und akkurat lösbar. Wenn man auch nur einfache Moleküle exakt lösen möchte, deren Eigenschaften berechnen möchte, funktioniert das heutzutage nur über Approximationen. Mit dem Quantencomputer könnte man die exakte Lösung relativ einfach und schnell bekommen."
Qubit statt Null und Eins
Und so ein Quantencomputer soll noch viel mehr können, hofft die Fachwelt: Datenbanken durchforsten, Bilder erkennen, Routen optimieren, Geheimcodes knacken – und zwar ungleich schneller als die heutigen Rechner. Seine grundlegende Recheneinheit ist nicht mehr das Bit, also das Umschalten zwischen Null und Eins. Stattdessen arbeitet er mit dem Quantenbit, kurz Qubit.
"Bei einem Quantenbit geht man in die Quantenphysik. Da kann man zwischen der Eins und der Null nicht genau unterscheiden. Das System kann auch eine Mischung von Einsen und Nullen haben. Diese Eigenschaft hat zur Folge, dass ein Qubit viele Zustände gleichzeitig annehmen kann und somit ein Rechenraum zur Verfügung steht, der viel größer ist als bei einem klassischen Bit."
Ein Beispiel: Ein PC kann mit zehn Bits einen von 1024 Werten kodieren. Ein Quantenrechner vermag in zehn Qubits alle 1024 Werte auf einmal zu bewältigen. Das Problem: Quantenbits sind schwierig zu bauen, sind überaus fragil und verlieren die gespeicherte Information rasch wieder. Bisher gelang es lediglich, Prototypen mit etwa zwei Dutzend Quantenbits zu bauen - zu wenig, um besser zu sein als ein gewöhnlicher Computer. Doch das dürfte sich nun ändern, sagt Heike Riel.
"Dieses Jahr könnte sehr interessant werden, weil man in einen Bereich der Anzahl der Qubits kommt, wo es keinen klassischen Computer mehr gibt, der diese Leistungsfähigkeit besitzt. Man kann dann Rechnungen durchführen, die man heutzutage mit einem klassischen Computer nicht durchführen kann, weil man keinen Computer bauen kann, der diese Art von Performance besitzt."
Anspruchsvolle Technik im Super-Gefrierschrank
Konkret heißt das: "Der 50-Qubit-Chip ist gebaut und wird im Augenblick getestet. Wir kommen in einen spannenden Bereich, um wirklich zu testen, wie leistungsfähig diese Computer sind."
Ein Quantencomputer mit 50 Qubits - damit würde IBM in derselben Liga wie Google und Intel spielen, die ähnliche Prozessoren entwickeln. Die Technik dahinter ist anspruchsvoll.
"Das Ding kann man sich nicht so vorstellen wie einen Laptop, wie er gerade vor mir steht."
Die 50 Quantenbits sind supraleitend, sie können Ströme verlustfrei leiten. Eingebaut sind sie in eine voluminöse Tonne, eine Art Super-Gefrierschrank.
"Weil der Quantenprozessor nur bei sehr tiefen Temperaturen funktioniert. Man geht da auf zehn Millikelvin runter. Das ist kälter als im Universum."
Konkurrent Google
Angesteuert werden die Quantenbits mit Hilfe von Mikrowellensignalen. Nur: IBM ist nicht der einzige Konzern, der einen Quantenrekord aufstellen will. Auch Google hat einen Prototyp angekündigt - mit sogar 72 Qubits. Wer den Wettlauf gewinnt, dürfte erstmals beweisen können, dass ein Quantencomputer den heutigen Rechnern in manchen Belangen überlegen ist. Der Weg zur Marktreife ist dennoch weit: Dazu sind die Quantenbits noch zu fehleranfällig.
"Die effektive Fehlerrate muss verbessert werden und die Anzahl der Qubits zusammen, um die Leistungsfähigkeit der Quantencomputer zu erhöhen."
Probleme, die sich lösen lassen sollten, meint Heike Riel.
"Ich denke, in zehn Jahren sehen wir sicher die ersten Anwendungen."
Dann könnten Quantencomputer Fahrtrouten und Lieferketten optimieren und Materialforschern helfen, neue Werkstoffe zu entwickeln.