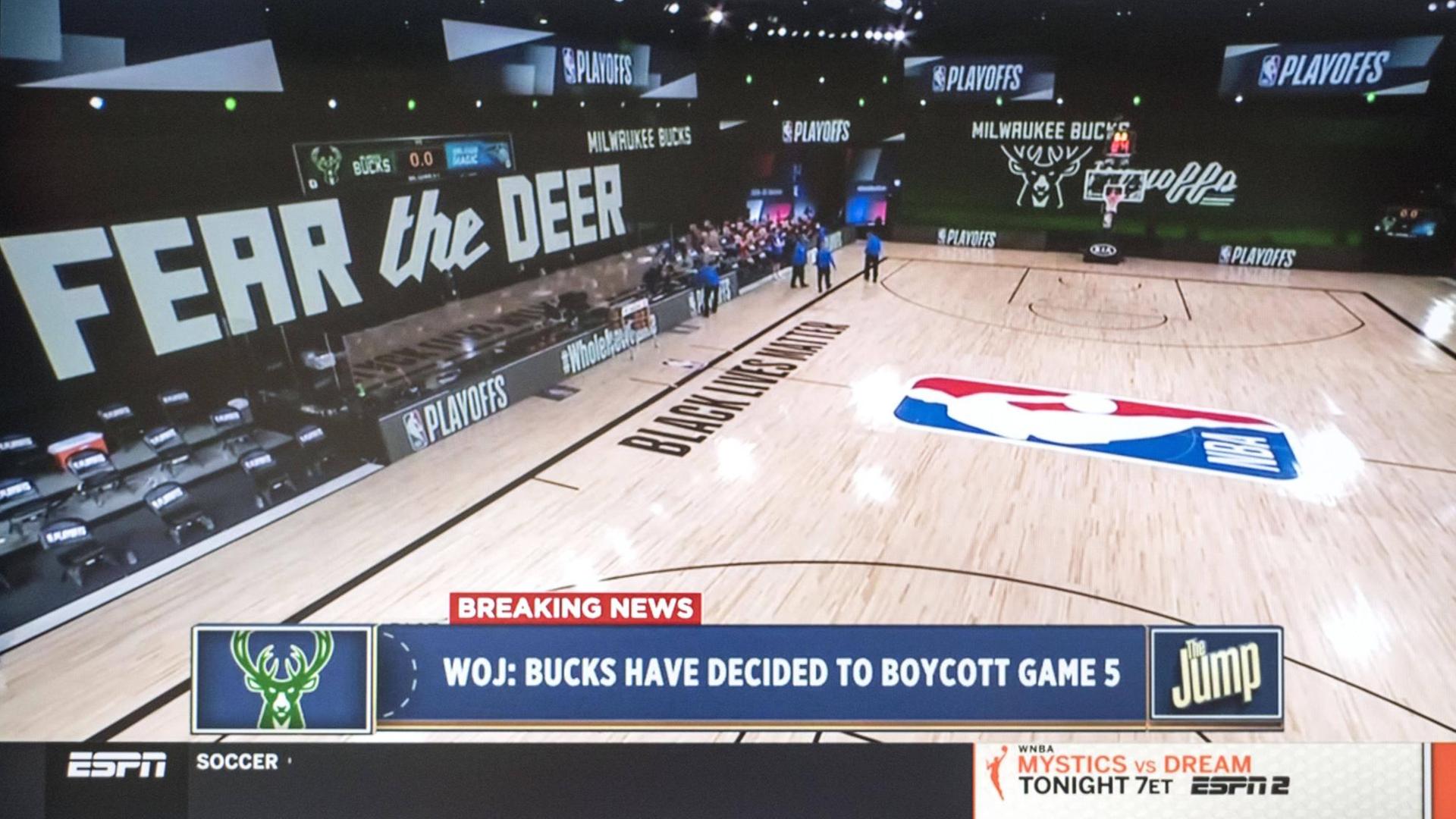Mit dem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans (34:20) ist in der Nacht zum Freitag (11.9.) die neue NFL-Saison gestartet. Und auch beim Football stand der Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt im Fokus. Die Texans blieben während der Nationalhymne in ihrer Kabine, ebenso beim Abspielen des Songs "Lift Ev'ry Voice and Sing", der als die Nationalhymne der Schwarzen gilt. Die Chiefs zogen sich dafür noch einmal in die Kabine zurück, nachdem sie sich während der Nationalhymne zunächst an der Seitenlinie aufgestellt hatten.
"Ein großes Statement von beiden Teams", sagte der ehemalige deutsche NFL-Profi Markus Kuhn im Dlf. "Es geht aber natürlich nicht nur um die Symbolik, sondern darum, wirklich weiter Veränderungen in den USA voranzutreiben." Den Spielern ginge es vor allem darum, dass es keine Debatte mehr sein soll, ob Schwarze und Weiße in den USA gleich behandelt werden, so Kuhn. "Es sollte mittlerweile jedem bewusst sein, dass das nicht so ist."
"Das war schon wieder Teil des Rasissmus"
Vier Jahre ist es nun her, dass Colin Kapernick, damals Quarterback der San Francisco 49ers, aus Protest gegen Polizeigewalt gegen Schwarze bei der Nationalhymne auf die Knie gegangen ist. Damals hagelte es Kritik an Kapernick, der bis heute keinen Job mehr in der NFL bekommen hat. "Die Botschaft wurde gleich umgedreht", sagte Kuhn. Kapernick wurde vorgeworfen, gegen das Militär und die Flagge zu protestieren. "Das war eigentlich schon wieder Teil des Rassismus, dass man gleich die Message umdreht, ohne sich darauf zu konzentrieren, warum er wirklich kniet."
Mittlerweile werde der Protest in der Gesellschaft anders wahrgenommen, so Kuhn. Unter anderem, weil auch NFL-Boss Roger Goodell seine Unterstützung ausgedrückt habe. Nun wünschten sich Spieler und Coaches auch von Team-Besitzern mehr Engagement. "Die würden noch einen größeren Unterschied machen, wenn sie sich lautstark für Veränderungen einsetzen würden", sagte Kuhn.
"Zeigen, dass es in der Politik Grenzen gibt"
Problematisch sei hier jedoch die Nähe vieler Besitzer zu US-Präsident Donald Trump. "Es ist natürlich eine Sache, wenn man sich für die Spieler einsetzt und die mit Geldspenden unterstützt. Aber wenn man dann Donald Trump und seine Wahlkampagne mit den gleichen Beträgen unterstützt, fragt sich der ein oder andere, ob sich das nicht gegenseitig aufhebt", sagte Kuhn. Die Gesellschaft in den USA habe sich durch Trump zum negativen verändert. Deshalb sollten auch Club-Besitzer, "die sonst die Republikaner wählen, zeigen, dass es in der Politik Grenzen gibt."
Trump hatte sich in der Vergangenheit klar gegen die Proteste gestellt. Auch sein Sohn Eric Trump hat auf Twitter die NFL für tot erklärt. "Man sollte den Präsidenten öfter mal ausschalten", sagte Kuhn deutlich. "Dann braucht man auch auf seine Kinder nicht weiter zu hören. Die sprechen alle in das gleiche Sprachrohr rein und ob da am Ende das Schlauste bei rauskommt, sei dahingestellt."