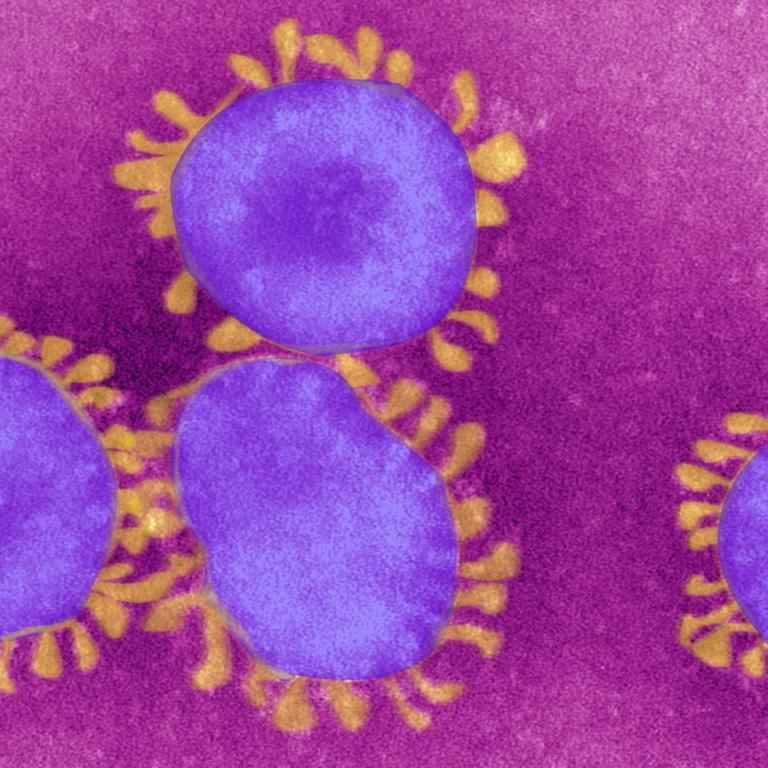Noch vor wenigen Monaten kannte es niemand, inzwischen ist es zu einer weltweiten Bedrohung geworden und schränkt den Alltag in Deutschland zunehmend ein: Sars-CoV-2. Die WHO spricht inzwischen von einer Pandemie, Veranstaltungen werden abgesagt, Kitas und Schulen geschlossen, Menschen in Quarantäne geschickt. Wie reagiert unsere Gesellschaft auf das Risiko durch das neue Virus? Welches Verhalten löst die Angst aus – und wie lässt sie sich in den Griff bekommen?
Darüber sprechen wir mit Ralph Hertwig, Psychologe und Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.
Lennart Pyritz: Was macht uns aus psychologischer Sicht Angst bei der Corona-Epidemie?
Ralph Hertwig: Da muss man vielleicht einen Schritt zurücktreten und erst mal sagen, dass jedes Risiko bestimmte Charakteristika hat, und diese Charakteristika, die unterscheiden sich von Risiko zu Risiko, und einige dieser Charakteristika führen dazu, dass sie uns mehr Angst machen als andere.
Pyritz: Sie haben jetzt schon diese Faktoren erwähnt, die unser Risikoempfinden beeinflussen. Welche Faktoren sind das zum Beispiel?
Hertwig: Das sind zum Beispiel solche Dinge wie, ob das ein Risiko ist, was wir als alt einstufen oder neu einstufen. Damit ist einfach gemeint, haben wir uns daran schon gewöhnt, kennen wir es, und wenn wir es kennen, dann ist es ja auch häufig so, dass es bereits irgendwelche Kontrollstrategien für die Risiken gibt, oder ist es ein ganz neues, wo auch die Wissenschaft erst mal sagen würde, wir wissen relativ wenig darüber, wir haben große Wissenslücken. Eine andere Dimension ist, ist es was, was ich sehen kann, was ich anfassen kann, oder ist das etwas, was ich nicht unmittelbar sehen kann, was nicht beobachtbar für mich ist. Was auch eine Rolle spielt, ist, ob ein Risiko auf eine einzelne Person oder eine einzelne Region begrenzt ist oder ob es ein Risiko ist, was potenziell sich global ausbreiten kann und damit sehr großflächige Konsequenzen haben kann. Das sind auch eher Dinge, die wir dann als risikoreich einschätzen.
"Wir sind bereit, unser Verhalten zu ändern"
Pyritz: Das wollte ich gerade sagen. Da kommt ja dann beim Coronavirus einiges an diesen Faktoren, die Sie dargestellt haben, zusammen, also Viren als unsichtbare Erreger, unsichtbares Problem, es ist noch relativ wenig bekannt über das Virus, und es ist ein pandemisches Geschehen, also es betrifft die ganze Welt. Wie beeinflusst denn die Angst, unsere Angst oder unsere Risikowahrnehmung unser Verhalten?
Hertwig: Ich würde sagen, das kann man jetzt tatsächlich an uns selber beobachten. Also prinzipiell ist es so, wenn wir bestimmte Risiken als besonders risikoreich einschätzen – und Sie haben recht mit Ihrer Frage, der Coronavirus, der drückt in gewissem Sinne einen Haufen Knöpfe bei uns, die dazu führen, dass wir ihn als besonders risikoreich einstufen. Wenn wir etwas subjektiv als besonders risikoreich wahrnehmen, dann haben wir ein Kontrollbedürfnis. Wir möchten es gerne kontrolliert haben, wir sind auch bereit und erwarten beispielsweise von dem Staat, dass er finanzielle Ressourcen investiert, um alles zu tun, um dieses Risiko zu regulieren, um es zu minimieren.
Wir sind natürlich auch bereit, in unserem individuellen Verhalten Dinge zu tun, die wir möglicherweise unter anderen Umständen nicht getan hätten. Also zum Beispiel, wir haben seit Jahren eine Diskussion darüber, ob wir denn fliegen oder nicht fliegen sollten im Rahmen der globalen Erwärmung, und jetzt ist es so, dass wir offensichtlich bereits sehr wohl bereit sind, unser Verhalten zu ändern, weil es auch ganz unmittelbar auch einen mit Angst besetzten Grund gibt, das zu tun. Oder wenn Sie an Hamsterkäufe denken, das ist sicher eine andere Manifestation davon, dass Angst bestimmte Verhaltensweisen, die dann auch nicht immer hochvernünftig sein müssen, anstoßen und motivieren kann.
"Die Unsicherheit ist sehr groß"
Pyritz: Sie haben jetzt schon die Hamsterkäufe erwähnt. Wie färbt denn sozusagen die Risikowahrnehmung durch unsere Mitmenschen auf uns selbst ab? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Nachbarn bei Hamsterkäufen beobachte oder Nudel- und Seifenregale im Supermarkt leergeräumt sind und mir das zeigt, dass meine Mitmenschen in einer bestimmten Weise reagieren, färbt das ab?
Hertwig: Also wir müssen uns vorstellen, wir sind in einer Situation, in der die Unsicherheit sehr groß ist. Das heißt, wir schwimmen alle, auch die Wissenschaft, auch die Politik schwimmt ein Stück weit. Und in der Situation, wo wir alle ein Stück weit schwimmen, ist natürlich auch das Verhalten von anderen Menschen für uns eine Information. Wenn wir jetzt in den Supermarkt gehen und sehen, dass die Regale leerer sind, was sie ja nun nicht immer und in jedem Fall sind, also man muss auch da vorsichtig sein, das Phänomen auch nicht herbeizureden, aber wenn wir das sehen, dass bestimmte Güter ausverkauft sind, dann deutet das drauf hin, dass andere Leute offensichtlich – in Anführungsstrichen – glauben, sich vorbereiten zu müssen und dass sie sich auch mit ganz bestimmten Dingen vorbereiten, also Thema Desinfektionsmittel. Das ist eine Situation, in der wir das Gefühl haben, wir wissen wenig, und die Unsicherheit ist sehr groß. Auch das Verhalten der anderen wird für uns zum informativen Signal.
Information, Kommunikation und Kompetenzvermittlung
Pyritz: Wie können wir denn sozusagen aktiv mit dieser Unsicherheit umgehen als Einzelne oder auch als Gesellschaft?
Hertwig: Wir benutzen ja häufig solche Sätze, oder auch in der öffentlichen Diskussion können wir häufig solche Sätze hören wie: jetzt bitte einen kühlen Kopf bewahren und nicht in Panik verfallen. Diese Sätze sind völlig legitim und nachvollziehbar. Ich glaube aber, wichtig ist, dass wir die ergänzen müssen. Wir müssen die ergänzen durch Information, und wir müssen die auch ergänzen durch Kompetenzvermittlung.
Was meine ich damit: Informationen, meine ich erst mal, erklären, warum wir bestimmte Maßnahmen ergreifen. Das heißt, ich glaube, es ist notwendig, nicht nur zu sagen, wir sagen jetzt diese Großveranstaltung ab oder tun diese oder jene Dinge, sondern wir müssen auch erklären, warum wir das tun. Ich glaube, wenn wir verstehen, warum wir das tun, dass wir dann auch das nicht als Signal für Panik interpretieren, sondern verstehen, was die Logik dahinter ist und dass es gute Gründe gibt, das zu tun.
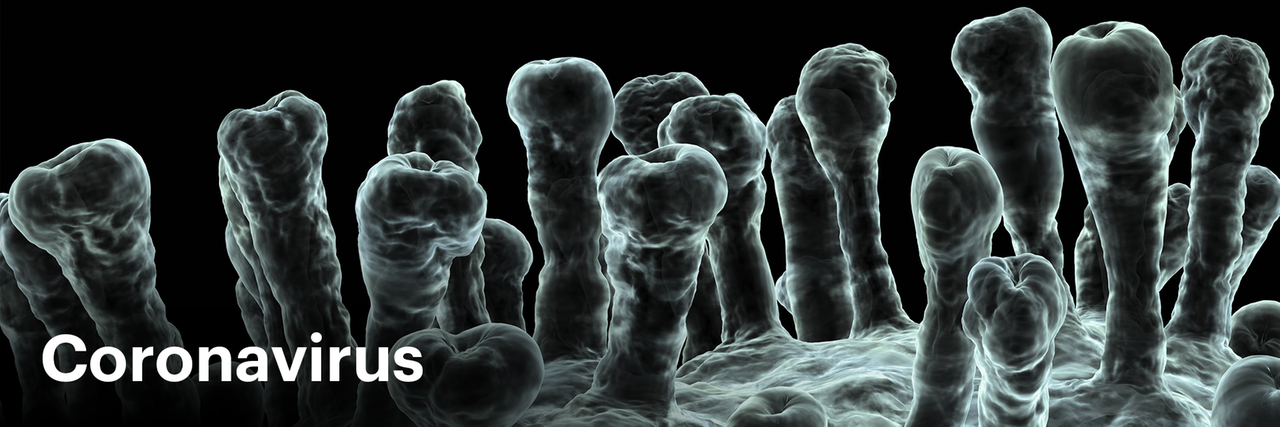
Eine andere Art der Kommunikation ist, dass wir uns auch noch mal vor Augen führen, was die Größenverhältnisse des Risikos sind. Ich benutze gerne das Beispiel, vor ein, zwei Wochen war in den Nachrichten, dass über 3.000 Menschen 2019 in Deutschland im Straßenverkehr verstorben sind. Wenn wir jetzt mal unterstellen würden, dass die Mortalität des Risikos bei zwei Prozent liegt, würde das bedeuten das Äquivalent von 150.000 infizierten Menschen in Deutschland. Von dieser Zahl sind wir weit entfernt. Das heißt, wir akzeptieren das Risiko des Straßenverkehrs relativ einfach und scheinen aber sehr viel stärker in Panik zu geraten, wenn wir über den Coronavirus nachdenken, obgleich die Größenordnung im Moment noch eine ganz andere ist.
Der dritte Punkt, den ich gerne machen möchte oder was in meinen Augen auch hilfreich ist, es reicht dann gelegentlich nicht, nur Informationen zu geben, sondern wir müssen auch Kompetenzen vermitteln. Also ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel: Wir hören sehr häufig, wir sollen uns zum Beispiel nicht ins Gesicht fassen, oder wir sollen uns die Hände reinigen, oder wir sollen Begrüßungsrituale anders gestalten. Das ist aber gar nicht so einfach. Also wenn Sie sich selber beobachten, wie häufig Sie sich am Tag ins Gesicht fassen, dann ist das eine echte Herausforderung, sich nicht ins Gesicht zu fassen. Das heißt, es genügt nicht, zu sagen, wir dürfen uns nicht ins Gesicht fassen, sondern wir müssen auch sagen, wie schaffen wir das denn überhaupt, wie kriegen wir das denn überhaupt hin.
"Unsere Risikowahrnehmung ist nicht statisch"
Pyritz: Wie verändert die Zeit die Risikowahrnehmung? Zum Beispiel angenommen, einzelne Ausbrüche, wie wir sie jetzt in diesen Tagen erleben, treten über die kommenden Monate regelmäßig auf und immer wieder über ganz Deutschland verteilt, das Risiko würde oder wird dann sozusagen zum ständigen Begleiter. Wie beeinflusst sozusagen diese Zeitkomponente unser Risikoempfinden?
Hertwig: Das ist wiederum ja eine der Risikocharakteristika oder Dimensionen des Risikos. Wir haben kurz am Anfang davon gesprochen, dass neue Risiken, die uns neuartig erscheinen, uns unbekannt erscheinen, in uns eher ein ständiges Gefühl von Risiko und Gefahr auslösen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass je mehr es genau das wird, nämlich zum alltäglichen Begleiter, weil es jeden Tag passiert, desto weniger stark ist unser Risikogefühl ausgeprägt. Unsere Risikowahrnehmung ist nicht statisch, sondern die verändert sich auch durch die Erfahrungen, die wir machen. Was als sehr risikoreich wahrgenommen werden kann, kann sich im Laufe der Zeit dann völlig verändern.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.