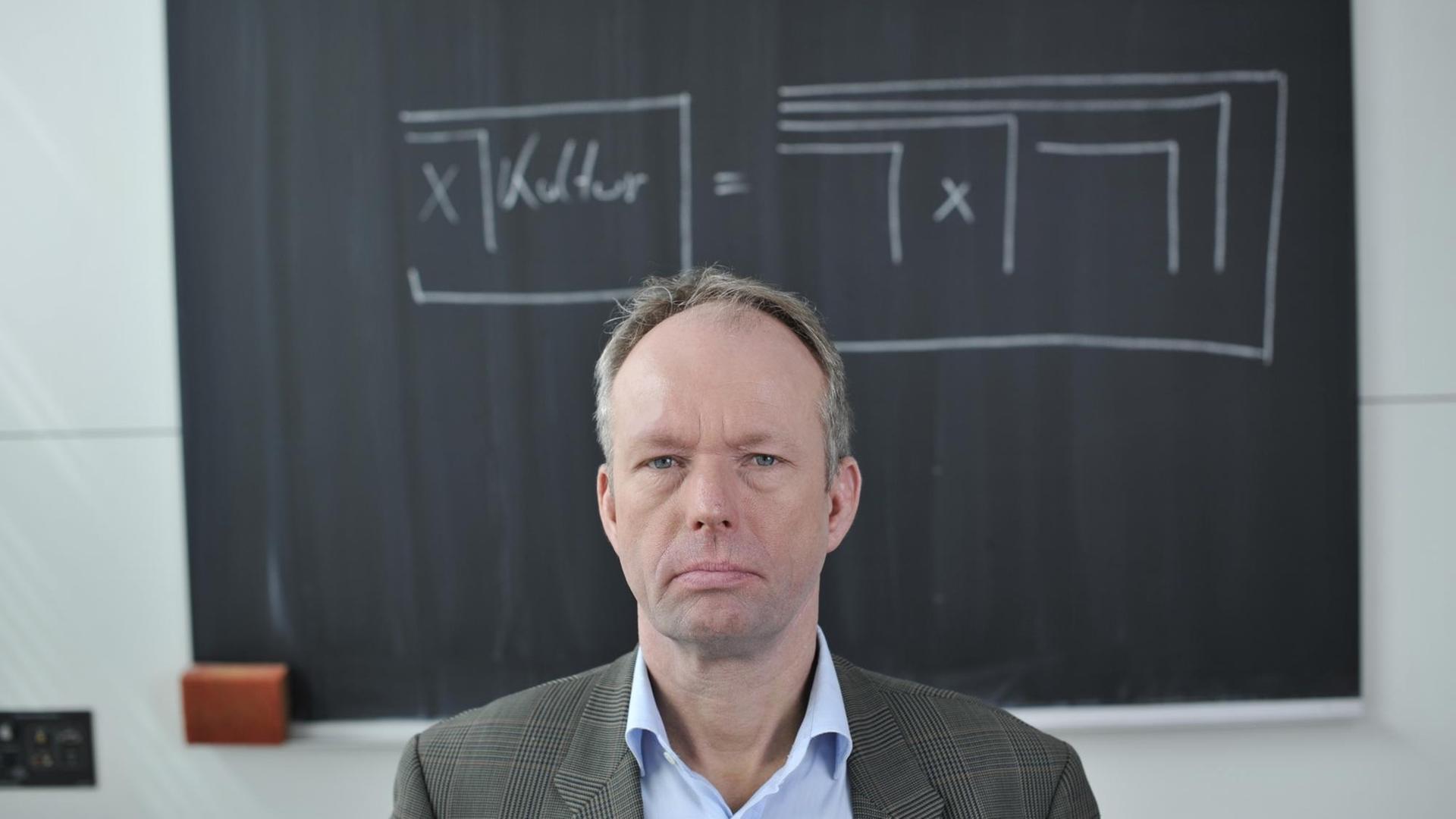Kübra Gümüşay gilt als eine der wichtigsten migrantischen, muslimischen und feministischen Stimmen in der Bundesrepublik. In Hamburg in dritter Generation einer türkischen Einwandererfamilie geboren, studierte sie Politikwissenschaft und arbeitet heute als freie Journalistin und Netzaktivistin. Sie lebt mit ihrer Familie in Oxford und Hamburg.
Ihr Markenzeichen ist ihr Kopftuch, darum heißt ihre taz-Kolumne auch "Das Tuch". 2008 gründete Kübra Gümüşay ihren Blog "Ein Fremdwörterbuch", auf dem sie über Politik, Gesellschaft, Islam und Medien schreibt. Gümüşay mischt sich immer wieder in aktuelle politische Debatten ein. So initiierte sie nach den Vorkommnissen in der Kölner Silvesternacht 2015/16, als es zu sexuellen Übergriffen kam, den Hashtag #ausnahmslos, um gegen die Instrumentalisierung feministischer Positionen zu rassistischen Zwecken protestieren und ein emotionales Zeichen zu setzen gegen den Hass im Netz.
Der Luxus der Ambiguität
Seit fast andertalb Jahren liegt Gümüsays Blog quasi brach. Eine bewusste Entscheidung: Sie habe gemerkt, dass sie sehr fremd definiert gelebt habe, sagte Gümüsay im Dlf. Sie habe sich auf bestimmte Facetten reduziert gefühlt - und beobachtet, dass auch andere junge Menschen "sich selbst auf die Definition anderer reduziert" hätten:
"Durch das extensive Labeling und Kategorisierenwollen von Menschengruppen in unserer Gesellschaft, die wir als fremd und anders markieren, verhindern wir es, dass diese Menschengruppen in unserer Gesellschaft Menschen sein können: komplex sein können, sich in sich mal widersprechen können."
Das Privileg einer Ambiguität hätten in unserer Gesellschaft nur bestimmte Menschen. Alljene die als "fremd" markiert werden würden, hätten diesen "Luxus" nicht.
"Dieses Spiel wollte ich nicht mehr mitmachen und habe mich dann damit beschäftigt: Wie können wir wieder eine Atmosphäre schaffen, wo wir wieder zweifeln und denken können?"
Florian Fricke: Kübra Gümüşay, Sie wurden eigentlich bekannt als islamische Feministin, ich sag mal: als die bekannteste Kopftuchträgerin Deutschlands. Ihren Blog "Ein Fremdwörterbuch" haben Sie aber vor anderthalb Jahren eigentlich auch beendet, auch mit einem Eintrag, wo Sie sich wehren gegen Vereinnahmung, wo Sie sagen, ich stehe für jede Minderheit und mache mich gegen jegliche Art von Rassismus stark. Und seitdem ist es eigentlich ein bisschen ruhig geworden um Sie. Was ist passiert?
Kübra Gümüşay: Ich habe gemerkt, dass ich sehr fremddefiniert gelebt habe und dass ein Raum geschaffen worden ist, wo ich nicht mehr sprechen konnte. Weil, Sie haben das gerade gesagt, die bekannteste Kopftuchträgerin Deutschlands, dabei ist das keine definierende Eigenschaft meiner Person. Und dass sozusagen das Reduziert‑Werden auf bestimmte Facetten dazu führt, dass ein Sprechen in dieser Gesellschaft unmöglich wird, weil durch das stetige Sprechen man sich selbst verändert.
Ich habe gesehen, dass junge Muslime in Deutschland meinen Weg kopiert haben oder meinen Weg als Vorbild genommen haben und dann Dinge gesagt haben wie: Ich möchte Islamwissenschaften studieren oder Politikwissenschaften studieren, um den Menschen den Islam zu erklären. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, weil ich nicht möchte, dass junge Menschen glauben, ihr Lebensinhalt sei es, sich selbst anderen zu erklären oder die Religion, an die sie glauben - oder vermeintlich glauben -, zu erklären, dass der Lebenssinn einer ganzen Generation nicht darin bestehen kann, Pressesprecherin oder Pressesprecher einer Weltreligion oder einer Gruppierung zu sein, und ich gemerkt habe, wie diese jungen Menschen angefangen haben, sich selbst auf die Definition anderer zu reduzieren. Und ich habe auch gesehen, dass dieses ständige Erklären und dieses ständige Übersetzen dazu führt, dass man zu einem anderen Menschen wird.
Ein Beispiel, das ich versucht habe anzuwenden, um zu verdeutlichen, was dies mit einem macht, ist: Wir führen ja Debatten über den Islam, und häufig geht es gar nicht um Religion und häufig erklären oder diskutieren wir mit Menschen, die weder mit Religion noch mit Spiritualität etwas anfangen können. Und so fangen wir an, Erklärungen anzuwenden und Rationalisierungen anzuwenden, von denen wir hoffen, dass die Person sie versteht. Es ist so ein bisschen, wie jemandem, der das Konzept von Liebe nicht versteht, zu erklären, weshalb man mit seinem Partner zusammen ist. Und dann fängt man an zu erklären und erklären, und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, er bietet mir finanzielle Sicherheit, obwohl das nie ein Beweggrund gewesen ist, wendet man aber irgendwann diese Rationalisierung an, weil man hofft, dass die andere Seite, das Gegenüber einen versteht.
Und das Problem ist, in diesem Moment, wo man Dinge sagt, von denen man hofft, dass das Gegenüber sie versteht, aber die eigentlich gar nicht auf einen zutreffen, hat man sich von sich selbst entfremdet und man hört auf zu existieren. Man ist nur noch das, worauf man reduziert wird. Und durch das extensive Labelling, durch das extensive Kategorisieren-Wollen von Menschengruppen in unserer Gesellschaft, die wir als fremd und anders markieren, verhindern wir es, dass diese Menschen in unserer Gesellschaft Menschen sein können, komplex sein können, sich in sich mal widersprechen können und auch mal eine gewisse Ambiguität haben.
Und ich finde, Ambiguität ist eines der größten Privilegien in unserer Gesellschaft, nicht zu Ende definiert sein zu müssen. Und dieses Privileg haben in unserer Gesellschaft nur bestimmte Menschen. Und all jene, die fremd sind - in Anführungszeichen, die als fremd markiert werden -, haben diesen Luxus nicht. Und dieses Spiel wollte ich nicht mehr mitmachen und habe mich dann damit beschäftigt: Wie kann Sprechen wieder gelingen? Wie können wir wieder eine Atmosphäre schaffen, Umstände schaffen, wo wir wieder zweifeln können, denken können? Wie kann öffentliches Denken überhaupt funktionieren in einer Gesellschaft, wo im Netz vor allem wir jedes Wort umdrehen, wo wir Menschen auf ihre Position von vor zehn Jahren festnageln, einfach weil es im Internet noch fortbesteht?
"Ich lese ja auch kaum mehr Blogs"
Fricke: Und werden Sie den Blog … Warum heißt der eigentlich "Fremdwörterbuch"?
Gümüşay: Eigentlich eine kurze Antwort, und zwar wollte ich, als ich meinen Blog damals gestartet habe, einfach über alles sprechen. Und "Wörterbuch" war bereits vergeben und "Ein Wörterbuch" auch, aber ein "Fremdwörterbuch" gab es noch. Und ich fand dann, irgendwie passte das sehr schön, weil ich fremde - in Anführungszeichen fremde - Perspektiven mit reinbringe und auch vielleicht, in Anführungszeichen, fremde Wörter mit reinbringe und zu einer Wahrnehmungsvielfalt führe. Und deshalb hat sozusagen diese unfreiwillige Entscheidung dann doch irgendwie sehr gut gepasst.
Fricke: Und wird er noch mal aufleben oder ist er Geschichte?
Gümüşay: Also der steht da ja noch und das ist deshalb, weil ich glaube, dass es da noch Hoffnung gibt. Beziehungsweise, ich gucke ja mein eigenes Leseverhalten an und ich lese ja auch kaum mehr Blogs, eigentlich gar keine mehr, und ich halte diese Form des Diskurses derzeit nicht für wirklich sinnig.
Weil, ich möchte Räume zum Denken schaffen und ich glaube, dass ein Blog leider derzeit noch so eine gewisse Erhabenheit symbolisiert und die anderen sind halt in den Kommentarspalten, das ist ja kein Diskutieren auf Augenhöhe, und dass es da andere Tools gibt, wo das besser funktioniert. Und die probiere ich gerade aus, sei es jetzt Instagram Live Sessions, wo ich dann abends um elf oder noch später teilweise dann, ja, mit Hunderten von Menschen zusammen diskutiere. Und das Schöne ist daran, dass es flüchtig ist, es ist danach weg. Und weil es danach weg ist, weil das, was gesagt und gedacht worden ist, nicht für die Ewigkeit bestehen bleibt, hat der Austausch eine andere Ebene.
"Der Hass ist organisiert"
Fricke: Man hat das ja gemerkt, im Mai 2016, als Sie auf der re:publica quasi die Keynote gehalten haben, das war ein leidenschaftliches Plädoyer, wie haben Sie gesagt … gegen den Hass …
Gümüşay: Organisierte Liebe.
Fricke: Organisierte Liebe, genau. Das hat, glaube ich, viele Menschen bewegt. Und so rückblickend, wie meinen Sie, wie ist das aufgenommen worden und was waren so die Folgen?
Gümüşay: Der Talk wurde überwiegend überwältigend positiv aufgenommen und, ich glaube, war für viele Menschen zu dem Zeitpunkt auch ein … ja, so ein Wake-up Call. Weil viele einfach bestimmte Entwicklungen geduldet haben, und es stimmte halt auch einfach: Was ich im Talk angesprochen hatte, war, dass es ein Luxus ist, die AfD einfach derart ignorieren zu können und einfach so zu tun, als würde sie einen nicht tangieren, während diese einfach mehr und mehr Plattform bekommen und bestimmte Menschen unserer Gesellschaft einfach als Zielscheibe instrumentalisieren und auch vorführen. Und ich glaube, das war für viele ein Wake‑up Call.
Allerdings war mein Ziel bei diesem Talk eigentlich, aufzuzeigen oder deutlich zu machen, dass der Hass in unserer Gesellschaft organisiert ist. Ich habe zwar den Titel gehabt "Organisierte Liebe", habe mich aber zu 80 Prozent mit Hass beschäftigt, weil es mir wichtig war, dass es jedem einzelnen Nutzer und jeder einzelnen Nutzerin bewusst wird, dass der Hass, den wir im Netz erleben und sehen und beobachten, nicht einfach nur eine organische Entwicklung ist oder eine Reflexion unserer Gesellschaft, sondern dass der Hass organisiert ist.
Das heißt, bestimmte politische und ideologische Gruppierungen haben ein Interesse daran, den Eindruck zu erwecken, als gäbe es eine überwältigend große Gruppierung in unserer Gesellschaft, die derart hasserfüllt ist oder die diese Meinung hat, weil ja vieles mit uns passiert, wenn wir diesen Hass sehen. Dieser gezielte, organisierte Hass hat dazu geführt, dass bestimmte Themen in unserer Gesellschaft als marginal gelten oder als provokant.
Wir glauben heute, es sei unmöglich, über Islam oder Frauenrechte oder über Geflüchtete besonnen zu diskutieren, als seien diese Themen per se provokant. Das muss man sich so vorstellen: Schon bevor sie diese Strategien im Netz angewandt haben, haben bestimmte rechtspopulistische Gruppen das offline ja auch schon getan, diesen organisierten Hass in den Kommentarspalten, nämlich in Form von Präsenz auf bestimmten Veranstaltungen. Und wenn dann die Fragerunden eröffnet worden sind, waren die ersten fünf, sechs Beiträge von ihnen. Das macht etwas mit denjenigen, die auch im Publikum sitzen. Und zwar, man stellt sich vor, ja, man hört sich jetzt etwas an und findet das alles eigentlich ganz gut und stimmt auch überein und hält das für eine gute Meinung oder einen guten Ansatz.
Wenn aber die Menschen um einen herum, und scheinbar die ersten fünf Redebeiträge sind negativ, dann lässt man sich davon beeinflussen und fängt dann selber an zu denken: Ja stimmt, eigentlich ist diese Position streitbar. Ich glaube, diesen Effekt haben wir vollkommen vernachlässigt und haben uns dem absolut hingegeben, weil, wir glauben immer, der Hass hätte nur einen direkten Einfluss auf diejenigen, die hassen, und diejenigen, die den Hass empfangen. Aber wir haben vollkommen vernachlässigt, was der Hass mit denjenigen macht, die ihn beobachten. Und ich finde nicht oder ich plädiere nicht dafür, dass wir bestimmte Fragen nicht diskutieren sollten oder dass Hass nicht diskutiert werden sollte oder irgendeine Äußerung von Gauland nicht diskutiert werden sollte, sondern das kann man durchaus tun - die Frage ist: Wie tut man das?
"Bullshit hat null Respekt"
Fricke: Aber wie könnte denn eine Gegenstrategie aussehen? Ich meine, das ist ja gerade die große Frage im Hinblick auf die AfD.
Gümüşay: Ja. Ich denke, eine Gegenstrategie ist Arbeitsaufteilung. Nicht alle Menschen in unserer Gesellschaft müssen auf die AfD reagieren. Und ich sage das ein bisschen ironisch, aber ich glaube, da ist auch … oder ich glaube nicht, sondern ich weiß, da ist ein großer Ernst bei: Wir brauchen einen Erklärbären, der immer dann, wenn Bullshit kommt - und das sage ich bewusst -, Bullshit geäußert wird, darauf reagiert und erklärt, warum das Bullshit ist.
Es gibt einen sehr schönen Essay von Frankfurt über Bullshit. Er sagt: Es gibt die Wahrheit, dann gibt es die Lüge, die Lüge hat einen gewissen Respekt vor der Wahrheit. Und dann gibt es Bullshit. Bullshit hat null Respekt, weder vor der Wahrheit, noch vor der Lüge, und sucht sich Daten und Fakten zusammen, die zur eigenen Narrative passen. Und häufig kommt aus rechtspopulistischer Ecke Bullshit.
Und da ist es egal, da kommt man mit Daten und Fakten nicht an, weil die sich nur diejenigen Zahlen und Daten zusammensuchen, die zu ihrer Narrative passen. Wenn wir aber bestimmte Erklärbären hätten, um das wirklich jetzt noch ironisch zu sagen, dann müssten nicht alle anderen Teile unserer Gesellschaft sich damit aufhalten.
Und die Strategie Nummer zwei ist: Wir brauchen eine eigene Agenda. Wir brauchen eigene Themen, die wir diskutieren. 2016 gab es nur eine einzige Talkshowsendung zum Thema Bildung. Und das sagt unheimlich viel über uns aus. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Und die nachhaltigste Strategie, die ich sehe, ist, daran zu arbeiten: Was sind die Themen, die uns bewegen, was ist unsere Agenda, um sich wirklich mit den Fragen zu beschäftigen - und das war eine Frage, die ich mir wirklich gestellt habe nach vielen Jahren, wo ich ja mich an Rassismus und Sexismus und Co abgearbeitet hatte.
Ich habe mich irgendwann gefragt: Worüber würde ich schreiben, worüber würde ich nachdenken, was würde ich sagen, was würde ich tun, wenn es in dieser Gesellschaft keinen Rassismus gäbe, keinen Sexismus gäbe, wenn es keinen Hass gäbe? Und im ersten Moment hatte ich keine Antwort auf diese Frage und habe aber dann monatelang daran gearbeitet, Antworten zu finden, die mich bewegen, wo ich auch einen Handlungsansatz sehe. Und ich glaube, das ist jetzt mein ganz persönliches Problem gewesen, aber ich glaube, unsere Gesamtgesellschaft hat das gleiche Problem.
"Optimistisch bleiben und aktiv die Gesellschaft mitgestalten"
Fricke: Das heißt, Sie waren eigentlich gut vorbereitet auf das Ergebnis der Bundestagswahl, oder hat das noch mal was verändert?
Gümüşay: Ich war eigentlich gut vorbereitet, weil ich wusste, dass die AfD einziehen wird. Worauf ich nicht vorbereitet war, war die Kälte, die sie verbreiten würden. Und ich erinnere mich an die Wahlnacht, ich war bei einer Wochenzeitung eingeladen zu einem Nachgespräch zur Wahl, und haben uns dann um 18:00 Uhr die Verkündung der Wahlergebnisse angeschaut, und das war der Moment, wo dann Gauland ins Mikrofon geschrien hat, wir werden sie jagen, wir werden sie jagen, und dass sich der Bundestag, die Bundesregierung warm anziehen müsse. Und in dem Moment habe ich so einen Schauer gefühlt und habe dann Menschen um mich herum beobachtet und gefragt, wer von diesen Menschen hat jetzt für diese Partei gestimmt und damit auch für die Zugehörigkeit von Menschen wie mir?
Das habe ich dann ein, zwei, drei Tage gedacht und gefühlt, aber am vierten, fünften Tag hat dieses Gefühl aufgehört. Und ich habe mich an diese Kälte, an diesen Schauer und auch auf diesen Blick sozusagen eingelassen und daran gewöhnt gehabt. Und dann las ich einen Text, der mich sehr bewegt hat, von einem Rabbi, Abraham Joshua Heschel. Und er sagt darin, dass er zu einem der unangepasstesten Menschen unserer Gesellschaft gehört. Er sagt darin, dass er jeden Morgen, wenn er aufwacht, die Sonne sieht, sich daran erfreut und dass er, wenn er auf der Straße geht und Unrecht sieht, erbost ist und dass er sich niemals an Ungerechtigkeit gewöhnen wird. Und dass Mensch sein bedeutet, immer wieder überrascht zu werden.
Als ich das gelesen habe, war ich wiederum überrascht, weil mir vor Augen geführt worden ist, wie ungesund es ist eigentlich, sich an diese Situation zu gewöhnen. Und dann habe ich mich erinnert an den schönen Satz: "It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society" - es ist kein Maßstab oder Grad von Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft angepasst zu sein. Und dann habe ich so einen Auftrag darin gesehen, trotz all der Dinge in unserer Gesellschaft, die schieflaufen, es zu schaffen, sich nicht daran zu gewöhnen und wach zu bleiben und gleichzeitig trotzdem optimistisch zu bleiben und aktiv die Gesellschaft mitzugestalten. Ich weiß noch nicht, wie man diese Balance hinkriegt, dass man sozusagen seinen Alltag leben kann und gleichzeitig unangepasst bleibt an bestimmte politische und gesellschaftliche Verhältnisse, aber ich glaube, da müssen wir diesen Weg finden und ihn auch gehen.
"Ich hatte das Gefühl, ich werde Heimat nie erleben"
Fricke: Kübra Gümüşay, Sie waren jahrelang quasi auf Wanderschaft - Istanbul, Kairo, London, Oxford - und sind jetzt zurückgekommen, hier nach Hamburg, wo Sie geboren wurden, wo Sie aufgewachsen sind. Fühlen Sie sich als Hamburger Mädchen sozusagen? Inwieweit sind Sie hier verwurzelt, Sie als vielleicht die bekannteste Identitätspublizistin in Deutschland?
Gümüşay: Ich wurde letztens zum Thema Heimat befragt und habe mich dann intensiver damit beschäftigt. Also, Menschen finden Heimat in unterschiedlichen Facetten. Manche Menschen finden Heimat in einem Land, manche in einer Stadt, manche in einem Stadtteil, manche in einer Straße, manche in einem Gebäude, manche in Gegenständen; manche in Menschen, die sie lieben, manche in Gefühlen, manche in Gerüchen, in Tönen, in Büchern. Heimat kann man in vielfältigen Facetten finden.
Und für mich war aber Heimat immer die Zukunft. Und zwar habe ich immer geglaubt - und ich glaube das nach wie vor -, dass man ein Teil einer Gesellschaft wird, indem man diese Gesellschaft mitgestaltet. Denn indem man sie gestaltet, schafft man einen Raum in dieser Gesellschaft, für sich selbst, ohne sich verändern zu müssen, grundlegend, und sich ablegen zu müssen oder sich einpassen zu müssen, sondern man kann die Gesellschaft und sich aneinander anpassen. Und dann ist man irgendwie letztlich integriert, weil, die ganzen Vorbilder, die wir ja immer so nennen, wenn es um das Thema Integration geht - von Fatih Akın zu Fußballspielern -, das sind Menschen, die durch Engagement, durch Gestaltung einfach unsere Wahrnehmung verändert haben und dadurch letztlich integriert waren, aber nie weil sie sich aktiv integriert hätten.
Deshalb fand ich politische Partizipation als Auftrag und als Aufforderung an alle immer konstruktiv. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass man den Menschen ja etwas verkauft, indem man sagt, engagiert euch, dann seid ihr integriert. Und zwar, man verkauft ihnen Hoffnung auf eine Zukunft, wo sie irgendwann dazugehören. Aber wann fängt diese Zukunft an? Und wann ist dieser Traum irgendwann kein Traum mehr, sondern Realität? Weil, bis dahin, bis diese Zukunft eintrifft, haben alle anderen Menschen in der Gesellschaft eine Bedeutungs- und Definitionshoheit über einen selbst, ob man dazugehört oder nicht, bis zum Eintreffen dieser Zukunft. Und ich habe gemerkt, dass mir das nicht ausreicht.
Es reicht mir nicht aus, mich abzuarbeiten, mich zu engagieren, alles zu versuchen, diese Gesellschaft mitzugestalten in der Hoffnung, dass ich irgendwann dazugehöre, und nicht weiß, ob ich das jemals erleben werde oder ob meine Kinder das jemals erleben werden. Und war dann in einem sehr verbitterten Zustand, weil ich das Gefühl hatte, ich werde Heimat nie fühlen und nie erleben.
Und dann sind viele Dinge passiert, unter anderem folgende Begebenheit: Ich war unterwegs in Ostdeutschland, in einer kleinen Stadt, und habe einen Vortrag zum Thema Digitales und Feminismus gehalten. Und da kam eine ältere Frau zu mir, die eine gestandene Feministin war und sich seit Jahrzehnten engagierte, und hatte so Tränen in den Augen und hat sich zu mir vorgelehnt und hat zu mir gesagt, dass es sie so stolz macht und voller Glück und Freude erfüllt, eine junge Frau wie mich zu sehen, die ihre Arbeit fortführt. Und ihre Worte und dass es sie war, die das gesagt hat, hat mich so bewegt, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht ein Fremdobjekt bin, das sich jetzt sozusagen versucht, in diese Gesellschaft einzuschleichen durch Engagement, um irgendwann dazuzugehören, sondern dass ich Teil einer Kette bin. Und diese Kette reicht nicht nur in die Zukunft, sondern sie hat auch eine Vergangenheit. Und dann habe ich angefangen, Heimat in der Vergangenheit zu suchen.
Und das war für mich so, als hätte sie eine Hand aus der Vergangenheit gereicht und ich reiche meine Hand in die Zukunft, und das war so, als hätte sozusagen eine Kette sich geschlossen. Und das Heimatgefühl, das ich in dem Moment empfand, war fundamental anders als alles, was ich bis dahin empfunden hatte. Ich habe mich irgendwie angekommen gefühlt.
Und dann habe ich angefangen, auf die Vergangenheit zu schauen und zu gucken, wie erzählen wir die Geschichte in unserer Gesellschaft? Wenn Pluralität im Heute selbstverständlich sein soll, dann braucht es auch einen pluralen Blick auf die Vergangenheit. Das heißt, in unseren Geschichtsbüchern müssen wir, wenn wir Pluralität im Heute selbstverständlich halten wollen, auch einen pluralen Blick auf die unterschiedlichen Perspektiven in der Vergangenheit haben. Das heißt Gastarbeiter und ihre Perspektiven und die ihrer Kinder, weil, das sind unsere Vorfahren, die auch diese Gesellschaft mitgestaltet haben und die uns hier verwurzeln. Aber auch, um ein gesamtdeutsches Problem zu benennen, auch die Perspektive von Ostdeutschen, und nicht nur die ostdeutsche Perspektive auf die Geschichte so zu behandeln wie die eines Familienmitglieds, das auf die falsche und schiefe Bahn geraten ist und irgendwie nach Jahrzehnten wieder zur Familie gefunden hat, aber einem irgendwie fremd geworden ist, sondern aus deren Perspektive. Denn dann erst weiß man, dass man in der heutigen Narrative mitgemeint ist, weil sie in der Vergangenheit mit inkludiert werden.
Dieser Baustelle müssen wir uns annehmen. Das heißt, nicht nur Hoffnung verkaufen, sondern auch uns mit der Vergangenheit und der Geschichte in unserer Gesellschaft beschäftigen, denn Deutschland ist nicht heute eine Migrationsgesellschaft, war es nicht vor 50 Jahren und auch nicht vor 100 Jahren, sondern schon immer.
"Heimat ist die Suche nach Zugehörigkeit in unserer Gesamtheit"
Fricke: Also Sie sind Migrantenkind dritter Generation. Wie haben Sie denn das Leben Ihrer Großeltern und Eltern erlebt? War das hart für die? Sind die jemals angekommen?
Gümüşay: Das Interessante ist ja, dass aufgrund von Sprachbarrieren, aber auch von Schichtbarrieren bestimmte Dinge ihnen vorenthalten worden sind. Das heißt, mein Großvater oder meine Großmutter haben, wenn sie Hass erlebt haben, ihn nur in seiner gröbsten Form wahrgenommen. Dieses Feinsinnige, dieses kleine Sticheln, das haben sie ja nie bewusst wahrgenommen. Vielleicht gefühlt, aber er war ihnen nicht zugänglich. Und damit hatten sie eine andere Wahrnehmung dieser Gesellschaft. Und es hat ihnen auch anders wehgetan, als es zum Beispiel mir wehtut, weil sie als Gastarbeiter hergekommen sind und nie den Anspruch hatten, in ihrer Komplexität und ihrer gesamten Menschlichkeit von anderen in der Form akzeptiert zu werden. Sie haben Heimat hier noch nicht gesucht gehabt.
Und die Generation danach, die meiner Eltern, sie hat sehr daran gerüttelt und gerieben und hatte ein stärkeres Bewusstsein für Rassismus, für Diskriminierung, aber hat glaube ich durch gewissen Aufstieg und durch ein gewisses Gestalten-Können sich ihren eigenen Platz geschaffen und auch nicht mehr Ansprüche gehabt als das. Und meine Generation aber, sie ist fremd in der Heimat unserer Großeltern und sucht sozusagen nach Zugehörigkeit in unserer Komplexität, in unserer Gesamtheit, weil, Heimat ist genau das, die Suche nach Zugehörigkeit in unserer Gesamtheit, ein Ort, an dem wir in unserer Komplexität nicht nur willkommen sind, sondern akzeptiert werden und auch wohlbehütet sind.
Deshalb ist glaube ich meine Generation, um das jetzt mal zu verallgemeinern, empfindlicher vielleicht und verletzter, wenn solche Dinge geschehen. Und was mein Großvater erlebt hat, dass ihm in sein Maul geschaut worden ist, in Anführungszeichen, dass er … Von seinen anderen Freunden aus seiner Generation habe ich Erzählungen mitbekommen, wo auf der Arbeitsstelle die Toilettentüren hochstanden, damit sie sehen konnten, wie lange Leute auf der Toilette sitzen, oder überhaupt, wie menschenfeindlich sie behandelt worden sind, das sind Dinge, die wir heute niemals dulden würden. Trotzdem haben sie es geschafft, trotz dieser wirklich menschenfeindlichen Umstände, einen Raum für sich zu wahren, und hatten andere Ansprüche an diese Gesellschaft.
Aber jetzt in der dritten Generation und, ich glaube, schon eigentlich in der zweiten hatten Menschen den Anspruch, als Menschen respektiert zu werden. Und ich glaube, wahrscheinlich schon in der ersten Generation, aber ich glaube, dass sie unter solchen Umständen nach Deutschland gekommen sind, als Gastarbeiter, dass sie diesen Anspruch niemals geäußert hätten. Wir wandern ja durch unterschiedliche gesellschaftliche Schichten und sehen halt viel mehr Ungerechtigkeiten. Also, wir sind dann mal eingeladen beim Bundespräsidenten ins Schloss Bellevue, aber sind auch im Brennpunktstadtteil und wissen, was dort passiert.
"Ich wusste, wie ich nie sein möchte"
Fricke: Was bekommen Sie eigentlich mit vom Leben in der Türkei? Sie haben natürlich da Verwandte. Erfüllt Sie eigentlich die gegenwärtige politische Lage in der Türkei mit größter Sorge? Sie haben zum Beispiel jahrelang für die taz geschrieben, ich weiß nicht, ob Sie jemals Deniz Yücel getroffen haben. Wie fühlen Sie gerade?
Gümüşay: Das, was in der Türkei passiert, betrifft mich auf vielen Ebenen. Eine Ebene ist unter anderem zu beobachten, wie Deutschtürken hier in Deutschland, ja, durch diese starke Polarisierung erblinden für das Leid des anderen. Und die Türkei ist ein Land mit sehr, sehr vielen Traumata. Ich sehe, wie jetzt neue Traumata hinzukommen, und ich frage mich, wie jemals diese Wunden heilen können und ob sie überhaupt heilen können und welche langfristigen Folgen das haben wird. Und es betrübt mich sehr, wenn ich sehe, wie Deutschtürken hier in Deutschland aus ihrer Situation hier keine direkten Schlussfolgerungen treffen für andere Minderheiten in der Türkei.
Ich habe es immer als unheimliches Geschenk wahrgenommen, ein … Kein schönes Geschenk, ein Geschenk mit einem hohen Preis, aber Diskriminierung erlebt zu haben und Rassismus erlebt zu haben und beobachtet zu haben in den jüngsten Jahren, hat mir die Augen geöffnet für Missstände in dieser Gesellschaft, auf dieser Welt. Und mein Impuls, die direkte Folge des Erlebens dessen war, um mich herumzublicken und zu schauen: Was gibt es noch? Und ich halte das für die beste oder für die einzig richtige Schlussfolgerung daraus. Weil, wenn man nicht in der Lage ist, trotz dessen das Leid anderer zu sehen, dann läuft etwas falsch.
Es gibt in der islamischen Tradition sozusagen Abhandlungen über das Unrecht, und da wird unter anderem gesagt, dass man dankbar sein soll, dass man nicht zu den Unterdrückenden gehört, dass es aber Unterdrückte gibt, die unterdrücken. Und ich war dankbar dafür, das erlebt zu haben, weil ich wusste, wie ich nie sein möchte. Und ich wünschte mir, dass auch andere diese Schlussfolgerung daraus ziehen würden, dass … Ich sage nicht, dass hier alles gut läuft, im Gegenteil. Aber das, was ich daraus lerne, ist etwas, woraus ich Ideale entwickele. Und die würde ich niemals betrügen wollen. Und ich sehe da eine gewisse inkonsistente Haltung, wenn man nicht in der Lage ist, das in der Türkei zu geben, was man hier einfordert.
"Tretet Parteien bei und engagiert euch!"
Fricke: Können Sie sich eigentlich vorstellen, sich in Deutschland auch mal parteipolitisch zu engagieren? Oder hatten Sie den Impuls schon?
Gümüşay: Ja, den Impuls hatte ich mehrfach. Und mein Mann und ich diskutieren das sehr intensiv. Noch glauben wir, dass wir Möglichkeiten haben, Einfluss auf politische und gesellschaftliche Diskurse vorzunehmen, indem wir nicht in Parteien sind, und dass das Engagieren direkt durch Parteiwerkzeuge sozusagen wahrscheinlich eher weniger nachhaltig wäre für uns. Aber es soll nicht heißen, dass … Meine Aufforderung, mein Appell wäre an alle: Tretet Parteien bei und engagiert euch! Folgt nicht unserem Vorbild! Es hängt, glaube ich, sehr davon ab, dass man schaut, was für Möglichkeiten hat man, und dann entlang der Möglichkeiten sozusagen Gesellschaft mitzugestalten. Und noch, glaube ich, klappt das außerparteiisch und außerparlamentarisch ganz gut.
Fricke: Es ist ja gerade Weihnachten. Sie haben das mal scherzhaft als das langweiligste und verzichtbarste Fest der Welt beschrieben. Was machen Sie denn die Feiertage dann so?
Gümüşay: Da muss ich was sagen zu dem Text. Weil, die taz hat gesagt, die haben jetzt einen Pro-Weihnachtstext und sie brauchen einen Contra-Weihnachtstext, und ob ich denn da was zu schreiben würde. Da musste ich mir was aus den Fingern saugen, weil ich eigentlich wirklich die Weihnachtszeit mag, weil es so ruhig ist und so langweilig ist. Letztlich war ja der Negativansatz im Text, dass meine Freundinnen keine Zeit für mich haben, weil sie alle mit ihren Familien feiern!
Ja, es ist ja Zeit der Besinnlichkeit, und da färbt sich natürlich auf alle anderen Teile der Gesellschaft auch ab, die nicht Weihnachten feiern, weil ja auch wirklich wenig zu tun ist und auch viele nicht arbeiten müssen und im Fernsehen halt auch wirklich immer wieder das Gleiche läuft und auch das nicht viel Unterhaltung bietet. Und so kommen tatsächlich alle Familien, glaube ich, zusammen, alle, die eine Familie haben oder die mit ihren Wahlfamilien zusammenkommen. Und so ist für mich halt auch Weihnachten tatsächlich eine Zeit, wo ich endlich mehr Zeit mit denjenigen Menschen verbringe, die mir viel bedeuten.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.