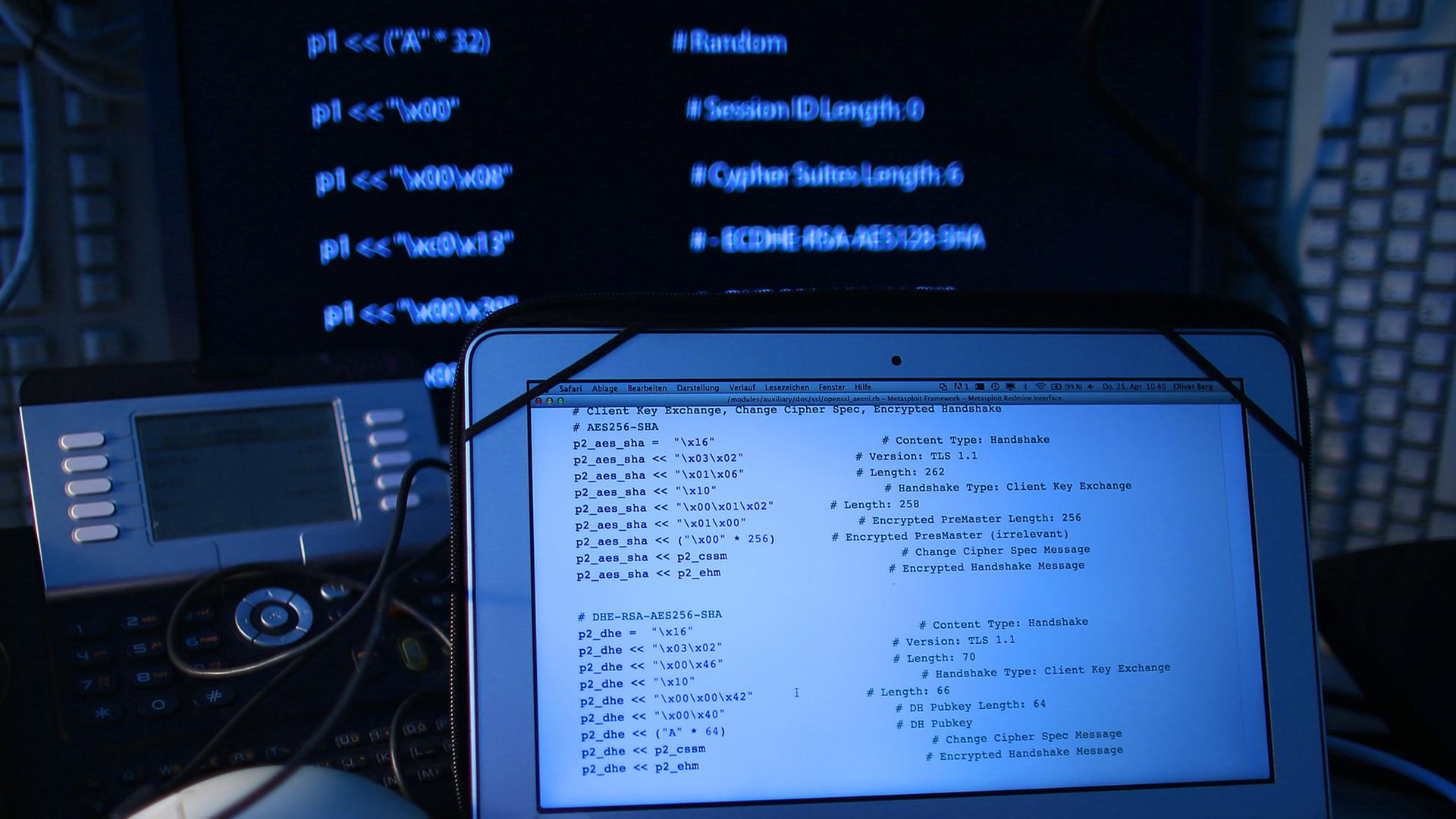Karin Fischer: Dass die digitale Revolution große Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat, das wissen wir, das haben wir in unserer Reihe "Leben in der digitalisierten Welt" jetzt auch schon häufig thematisiert, aber heute will es der Zufall, dass im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2014 die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften eine Tagung in Berlin zum Thema "Wissen, Information und Kommunikation im digitalen Umbruch" veranstaltet. Mit dabei: die Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Mercedes Bunz. Sie lebt in London und Lüneburg, leitet dort das Hyrid Publishing Lab, das an der Leuphana Universität angesiedelt ist und die Wissenschaftskommunikation im digitalen Zeitalter untersucht. Dabei geht es um ganz Verschiedenes, von der Debatte um Open Access und die Zukunft etwa der Wissenschaftsverlage bis hin zu den Möglichkeiten, die das global geteilte Wissen wie zum Beispiel Forschungsergebnisse, mit sich bringen. Immer aber geht es auch darum, zu wissen, was man da tut, und dafür sind Algorithmen nötig und wichtig, mit denen sich Mercedes Bunz auch schon beschäftigt hat. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und als Erstes gefragt, wie denn der Konflikt zwischen den Vertretern eines flächendeckenden "Open Access" und den Ängsten der Wissenschaftsverlage derzeit diskutiert wird.
Mercedes Bunz: Ich glaube, was wir gerade sehen in dem Bereich der Wissensproduktion und in dem Bereich der medialen Welten der Wissenschaftler, ist, dass Verlage natürlich sich neu orientieren. Es gibt aber immer noch die Möglichkeit, Geld zu machen auch im digitalen Bereich. Das Interessante ist ja, dass wir Menschen ganz oft immer diesen Fehler machen, dass wir denken, Sachen sind digital im Netz, also sind sie umsonst. Das stimmt natürlich nicht. Die Buchproduktion, bis das Buch gedruckt wird, ist natürlich kostenaufwendig. Wissen wird ganz oft geprüft, korrekturgelesen, wieder geprüft und dann eben erst veröffentlicht, und all diese Arbeit fällt auch nach wie vor noch an und muss auch bezahlt werden. Und die Forschungsförderungen werden erst langsam sich darauf einstellen und sind jetzt aktuell dabei, sich umzuorientieren. Wenn das mal läuft - wir reden hier ja um Wissenschaftsvertrieb von Büchern; das sind ja oft kleine Stückzahlen -, dann sollte das eigentlich auch gehen, dass Verlage professionell Wissensproduktion begleiten und dafür auch von den Förderungen Geld bekommen. Aber sie bekommen natürlich weniger Geld durch den Verkauf, gerade durch das digitale Herunterladen. Das ist ja dann umsonst, da haben Sie recht. Das sind große Neuerungen, die wir gemeinsam meistern müssen, denn in diesem offenen Zugang zu Wissen liegt ja auch eine große Chance.
"Wir stehen hier vor einem riesengroßen Wandel"
Fischer: Es gibt aber eine kulturelle oder vielleicht sogar auch philosophische Dimension des Problems, die ich dazu kurz ansprechen möchte. Menschen wie Frank Schirrmacher, der verstorbene Mitherausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", haben darauf hingewiesen, dass etwas sehr Dynamisches und Negatives geschieht, wenn wir, wie Sie gerade auch gesagt haben, uns immer mehr daran gewöhnen, dass Wissen im Internet frei verfügbar und auch kostenfrei verfügbar ist. Das bedeutet, dass sozusagen der Wert des menschlichen Geistes abgewertet wird.
Bunz: Ja ganz so sehe ich das tatsächlich nicht. Wir sind ja schon immer mit Wissen, das jetzt nicht an einen menschlichen Geist, an einen individuellen Geist gebunden war, umgegangen. Wenn wir über Kochrezepte reden zum Beispiel, wird uns das sofort klar. Das ist alles natürlich relativ zu sehen. Wo Herr Schirrmacher absolut recht hat, ist, dass sich unsere Wissenskultur gerade verschiebt und man das gestalterisch begleiten muss. Es gibt im Deutschen allerdings ein Problem, immer die negativen Seiten sehr stark zu betonen. Wir stehen hier vor einem riesengroßen Wandel, der eine Herausforderung ist, aber vor diesem Wandel standen wir auch schon, als das Buch eingeführt wurde. Historiker werden sehr gut wissen, dass es damals einen großen Aufschrei in der Gesellschaft gab, die Leute würden sich von der Welt abwenden und in diese fiktionalen Welten verschwinden, man würde sogar buchsüchtig werden, es gibt eine Lesesucht. All diese Debatten, die wir um das Internet haben, mit der Internetsucht, mit dem Wissen, das schal wird, die gibt es seit der Antike.
Fischer: Geben Sie mal ein Beispiel, wie man das positiv gestalterisch entwickeln kann.
Bunz: Wenn man sieht, was es für Probleme gibt - Sie haben das ja schon sehr gut angesprochen: Es gibt eine Vereinzelung, oder nehmen wir einfach mal die Tatsache, dass man Wissen zu oft umsonst herunterlädt. Ich komme ja aus dem journalistischen Bereich. Es gab sehr, sehr lange da einen Aufschrei und ein Stöhnen darüber, aber niemand hat eine günstige Geldbörse entwickelt, mit denen es Leuten digital möglich war, einfach Geld zu bezahlen, bis Steve Jobs von Apple kam und iTunes entwickelt hat und damit sozusagen die Möglichkeit des Micropayment für eine Schallplatte, für einen Song vielleicht sogar nur einfach gegeben war. Das meine ich damit. Wenn wir merken, es gibt ein Problem, es gibt zum Beispiel mit dem Bücherlesen ein Problem, dann müssen wir da gestalterisch forschen, wie Geld fließen kann, und wir können uns nicht immer nur hinsetzen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das bringt in der Technologie sehr wenig und ich sehe wirklich mit Bedauern, dass die gestalterische Seite in der technischen Kultur in Amerika liegt, in den USA. Alle Programme, mit denen wir arbeiten, Google, Microsoft, Word, Twitter, Facebook, das sind amerikanische Firmen. Wir Deutschen sind im Autobereich nach wie vor sehr gut, auch digital wird da sozusagen das Internet der Dinge, Smart-Autos werden da sehr gut entwickelt. Aber in dem Bereich des Wissens und des Textes, wo wir doch auch eine sehr, sehr große Kompetenz haben, sind wir zu vorsichtig.
"Wissensvorschläge, die verifiziert werden müssen"
Fischer: Sie haben sich schon früh mit dem Phänomen befasst und ein Buch geschrieben, das heißt: "Die stille Revolution - Wie Algorithmen Wissen, Arbeit, Öffentlichkeit und Politik verändern, ohne dabei viel Lärm zu machen." Wie verändern denn Algorithmen, zum Beispiel das Thema Wissen, dieses Gebiet?
Bunz: Jetzt wollen Sie das ganze Buch in einem Satz zusammengefasst haben. Das werde ich jetzt mal versuchen. Was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass wir klassisch eigentlich Wissen als institutionelle Autorität kennen. Das heißt, wir gucken es im Brockhaus nach, und dann wissen wir, das stimmt, das haben andere Experten so erforscht und verifiziert. Durch das Internet werden alle Leute, die mit dem Internet arbeiten, selber zu diesen Experten. Im Grunde genommen wird von uns eigentlich mehr gefordert als vorher. Das bedeutet, wir googeln einen Begriff, und dann kriegen wir diese Links, und dann müssen wir, wenn wir mehrere Links öffnen, das, was wir für richtig halten, da selber verifizieren. Das bedeutet, wir alle werden quasi zu Experten, und damit verändert sich das, was faktisches Wissen ist, natürlich sehr stark. Im Internet gibt es ja immer nur Wissensvorschläge, die verifiziert werden müssen. Es gibt nach wie vor institutionelles Wissen, immer noch, das ist nicht der Punkt. Aber wir müssen jetzt lernen, wo schlagen wir das nach, welchem Link kann ich vertrauen und welchem nicht, und dadurch gibt es natürlich eine ganz große Veränderung.
Fischer: Ich muss jetzt noch mal den Advocatus Diaboli spielen und sagen, die Algorithmen sind uns ja gerade im Zusammenhang mit der NSA-Affäre, oder im Zusammenhang mit der Durchökonomisierung unserer ureigensten Wünsche im Netz - Amazon weiß schon, was ich möchte, bevor ich es überhaupt selber weiß - ins Bewusstsein geraten. Die Rolle der Algorithmen kann auch eine böse sein, formuliere ich jetzt mal. Wie funktionieren Algorithmen eigentlich genau?
Bunz: In gewisser Weise funktionieren die so wie Schachspiel. Wenn ich bei Google etwas suche, guckt Google als Erstes, von wo suche ich. A ich bin deutsch, dann suche ich im deutschsprachigen Raum. So wird per drei oder vier Parameter erst mal die Suche radikal eingegrenzt. Das ist ein Wissen, das wir alle haben sollten. Wir sollten wissen, wie Algorithmen Inhalte sortieren, ganz grob. Den Algorithmus muss man dafür nicht unbedingt veröffentlichen. Diesen Ruf gibt es ja auch ganz oft, Google sollte seinen Algorithmus offenlegen, Facebook sollte seinen Algorithmus offenlegen. Das halte ich so ein bisschen für nicht gerade sehr praktikabel, weil das auch wieder von uns Menschen so etwas ist, dass wir im Grunde genommen dann eigentlich wollen, dass wir nicht die Arbeit des Verstehens tun müssen, sondern die Experten, die Informatiker sich dann darum kümmern und das überprüfen. Das finde ich etwas kurzsichtig. Ich glaube, man muss wissen, wie Algorithmen funktionieren. Die groben Beispiele, die ich gerade genannt habe, welche Parameter greifen eigentlich, die sollte man in der Schule eigentlich lernen, so wie man lernt, Zeitungen zu bewerten, Medien zu bewerten. Das ist ganz wichtig und man kann auch Algorithmen sehr leicht austesten. Das wird ja immer wieder gemacht: Was passiert, wenn ich eine Woche auf Facebook alles like, oder was passiert, wenn ich überhaupt nichts mehr auf Facebook mag. Da werden ja immer wieder Versuche in der Öffentlichkeit am eigenen Leib, sozusagen am virtuellen Leib durchgezogen ...
"Betonen zu wenig, wie viel Wissen wir mehr durch Google haben"
Fischer: ..., damit man einfach auch weiß, was man für Spuren im Netz hinterlässt.
Bunz: Ja. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir leben heutzutage alle in einer Öffentlichkeit, die sich nicht öffentlich anfühlt, und das ist auch was, mit dem wir umgehen müssen. Aber auf der anderen Seite betonen wir immer zu wenig, wie viel Wissen wir eigentlich jetzt mehr durch Google haben, und darüber schreiben wir auch nicht. Wir wissen, wann wo Stau ist, wir wissen, wann die Bahn fährt, wir haben Museumsöffnungszeiten zur Verfügung, wenn wir krank sind, können wir Sachen ergoogeln. Wenn Sie mit Ärzten sprechen: Viele sind eigentlich gar nicht so traurig darüber, dass die Patienten jetzt mit einer anderen Informationshöhe in die Praxis kommen, dass man mit denen ganz anders reden kann. Leute, die sich Sorgen machen um ihre Lieben und die Krankheiten ergoogeln können, haben auch nicht mehr das Gefühl, sie sind so hilflos ausgeliefert. Es hat sehr, sehr viele gute Seiten.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.