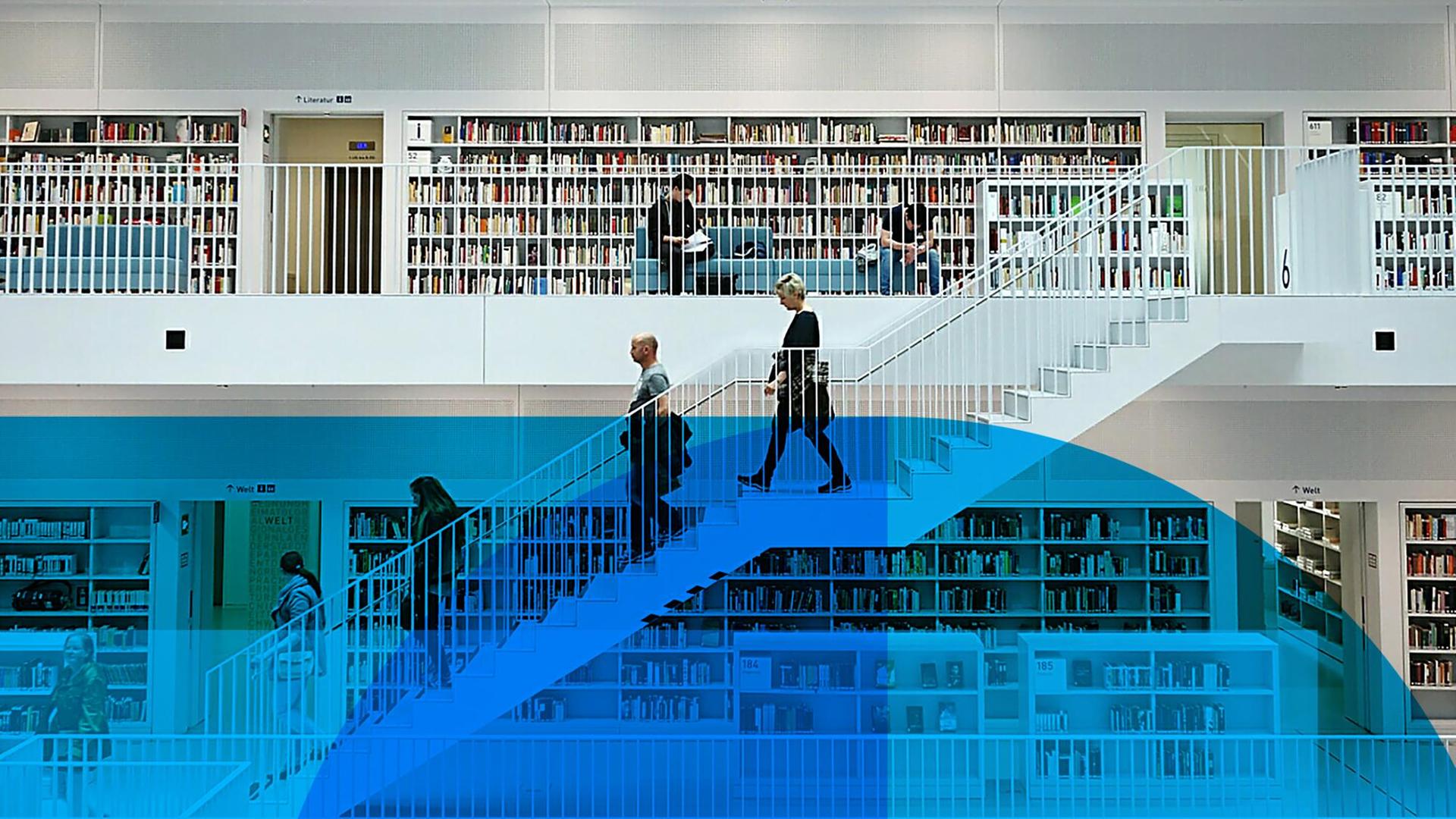Mascha Drost: In unserer Reihe "Schweres Erbe" fragen wir in den nächsten Tagen Wissenschaftler, Künstler, Kuratoren und Museumsleiter, wie sie es halten mit dem Erbe des Kolonialismus, im Besonderen mit dem Erbe, dass öffentlich, in Museen ausgestellt wird.
Die Direktorin des Völkerkundemuseums in Hamburg, Barbara Plankensteiner, mahnte gestern in dieser Sendung, man könne in einem Museum nicht die Geschichte des Kolonialismus erzählen, aber man könne unterschiedliche Perspektiven auf die Objekte werfen; man dürfe sich zudem nicht nur mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern müsse auch den Bogen zur Gegenwart schlagen.
Als zweite Stimme in dieser Debatte sprechen wir heute mit Inés de Castro, Leiterin des Lindenmuseums in Stuttgart, einem der bekanntesten Museen für Völkerkunde in Deutschland: Nicht nur über diesen Namen habe ich mit ihr gesprochen.
Ihr eigener Name sorgte übrigens vor wenigen Wochen auch für Schlagzeilen, als sie dem Humboldt-Forum in Berlin einen Korb gab und sich gegen die ihr angetragene zukünftige Leitung entschied.
Inés de Castro, wie sähe ihr Museum ohne die deutsche Kolonialgeschichte aus?
Inés de Castro: Die ethnologischen Museen haben ja wirklich eine Vergangenheit, die sehr eng mit dem Kolonialismus zu tun hat. Sie sind in dieser Zeit des Kolonialismus entstanden wie das Fach Ethnologie auch selber. Und insofern ist diese Verstrickung, glaube ich, so eng, dass, wenn es keinen Kolonialismus gegeben hätte, vermutlich eine ganz andere Form von ethnologischem Museum gebildet worden wäre oder entstanden wäre.
Provenienzforschung zu Objekten der Kolonialzeit
Drost: Gibt es denn bei Ihnen in Stuttgart besondere Problemfälle, Objekte, die mit der Brutalität und auch Gewissenlosigkeit der Kolonisation besonders verbunden sind?
De Castro: Mit Sicherheit. Wir haben durch die Förderung der Exzellenz-Initiative der Universität Tübingen die wunderbare Möglichkeit gehabt, in den letzten zwei Jahren eine systematischere Provenienzforschung Kolonialzeit durchzuführen. Im Fokus hatten wir dabei Namibia, Kamerun und Bismarck-Archipel und da festgestellt, dass ungefähr von diesen 25.000 Objekten schon ein sehr, sehr großer Teil während der Kolonialzeit in das Museum gekommen ist und dass auch davon etwa ein Drittel über Militärkontext hineingekommen ist. Das bedeutet über Aktivitäten der deutschen Schutztruppe, die auf natürlich eine kriegerische Auseinandersetzung, auf Unrechtskontext natürlich ganz deutlich hinweist.
Drost: Sie haben das Forschungsprojekt gerade angesprochen, das in Zusammenarbeit mit der Uni Tübingen den Umgang mit kolonialzeitlichen Objekten untersucht hat. Zu welchem Ergebnis ist man da gekommen? Gibt es schon so etwas wie konkrete Handlungsanweisungen?
De Castro: Handlungsanweisungen sicherlich nicht. Aber es war für uns ein ganz wichtiger erster Schritt, uns mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und für uns ganz wichtig ist auch sicherlich die Vermittlung, die Präsentation der Ergebnisse aus der Provenienzforschung, die zum Beispiel bei der Umgestaltung unserer neuen Afrika-Dauerausstellung Ende Februar 2019 auch einfließen werden.
Drost: Wenn Sie das noch mal ein bisschen genauer ausführen könnten? Wie wollen Sie diese Forschungsergebnisse ganz direkt in die Sammlung, in die Ausstellung integrieren?
De Castro: Indem man wirklich diese Themen anspricht, indem man offen und auch selbstreflexiv damit umgeht. Ich glaube nicht, dass ein ethnologisches Museum mit dieser Vergangenheit sich so leicht, sage ich mal, aus dieser kolonialen Verstrickung lösen kann oder sich "befreien" kann, wenn Sie so möchten; sondern wir können eigentlich nur offen damit umgehen und so transparent wie möglich damit umgehen. Das möchten wir gerne in dieser Dauerausstellung zum Beispiel versuchen, indem wir einige Beispiele darstellen, wie Objekte wirklich den Weg in das Museum gefunden haben, unter welchen Kontexten das geschehen ist.
Eigene Geschichte des Museums reflektieren
Drost: Und wie kann man das machen? Anhand von Schautafeln, von Texten, oder?
De Castro: Das sind Texte, das sind Karten. Wir planen für die neue Dauerausstellung eine Art Tisch, indem wir verschiedene so wie Blitzlichter auf die Kolonialzeit werfen, dass man die Kolonialzeit überhaupt mit hineinnimmt, die eigene Geschichte des Museums mit in der Ausstellung präsentiert. Das haben viele unserer Häuser ein bisschen vernachlässigt.
Drost: Gibt es auch Problemfälle, die man tatsächlich nicht mehr zeigen kann?
De Castro: Bislang sind wir nicht auf solche Problemfälle gestoßen. Sehr wichtig finde ich natürlich, dass diese Provenienzforschung damit verbunden wird, auch mit einer Zusammenarbeit mit den Herkunftsgesellschaften. Wir haben zum Beispiel ein Projekt mit Kamerun jetzt begonnen. Es ist uns auch sehr wichtig, mit den kamerunischen Kollegen, mit Vertretern aus den Museen, aus den Institutionen darüber zu sprechen, wie sie das sehen und wie sie diese Geschichte der Verflechtung in der Kolonialzeit auch präsentiert haben möchten.
Drost: Sie gehen immer mehr dazu, tatsächlich mit den Ländern zu kooperieren. Auf welche Weise? Wie ist das denn zum Beispiel, wenn aus diesen Ländern ganz konkrete Rückforderungen etwa kommen?
De Castro: Wenn konkrete Rückforderungen kommen, dann nehmen wir diese sehr ernst und leiten sie der Politik weiter, die darüber ja auch entscheidet.
Drost: Diese Forschungsergebnisse, um noch mal zurückzukommen, könnte das Gültigkeit haben für jedes ethnologische Museum? Oder muss da jedes Museum einen ganz eigenen Weg finden, wie man mit Objekten dieser Art umgeht?
De Castro: Ich denke, es gibt jetzt nicht einen Königsweg, um mit dieser geschichtlichen Periode wirklich umzugehen. Wir müssen auch schauen, welche Folgen auch die Kolonialzeit bis heute hat. Die Museen, die ethnologischen Museen waren ja schon daran beteiligt, dass kulturell Fremde noch mal zu konstruieren und zu betonen, und wir müssen uns, glaube ich, dieser Verantwortung auch sehr bewusst sein und schauen, welche Rolle wir bis heute spielen, und diese auch wirklich transparent vermitteln.
Museen keine objektiven Wissensspeicher
Drost: Neil MacGregor, der Leiter der Gründungsintendanz des Humboldt-Forums, hat in der aktuellen "Zeit" geschrieben: Es käme auf die Vielfältigkeit der Erzählungen an. Es gebe die eine eindeutige, richtige Sichtweise auf ein Objekt gar nicht. Stimmen Sie dem zu?
De Castro: Absolut! Ich denke, wir müssen davon wegkommen, dass unsere Häuser wirklich als objektive Wissensspeicher gesehen werden – auch vom Publikum. Da appelliere ich natürlich auch an das Publikum, in den Museen nicht die eine Wahrheit zu suchen, sondern wir können nur verschiedene Ansätze zeigen, die immer sehr subjektiv sind. Und was wir versuchen, zum Beispiel auch in der neuen Dauerausstellung "Afrika", ist, verschiedene Sichtweisen zusammenzubringen, eine Mehrstimmigkeit zu schaffen, und wir werden nie irgendwie alle Interpretationen zusammenbringen.
Drost: Wie schwierig ist es eigentlich, Mittel für die Forschungsprojekte wie das, was bei Ihnen gerade abschließt im Haus, Mittel für solche Projekte zu generieren, überhaupt Provenienzforschung in einem Haus wie dem Linden-Museum zu etablieren?
De Castro: Da sind natürlich begrenzte Mittel und viele Museen, die an diese Mittel heran möchten. Insofern ist es keine leichte Aufgabe. Aber Gott sei Dank bietet die Politik und auch die Stiftung uns mittlerweile gute Ansätze.
Drost: Sehen Sie da die Häuser in der Pflicht oder auch die Politik?
De Castro: Ich sehe da beide in der Pflicht, sowohl die Politik, die diese reflexive Wende der ethnologischen Museen unterstützen sollte und das auch tut, zumindest in Baden-Württemberg; aber natürlich auch die Museen, die sich selber mit sich selbst auch beschäftigen müssen und auf ihre Geschichte schauen müssen, auf ihre Rolle, die sie dabei gespielt haben.
Drost: Auf die Geschichte oder vielleicht sogar auf den Namen? Das ist nämlich das, was ich mich immer wieder frage: Ist der Begriff Völkerkundemuseum überhaupt noch zeitgemäß? In Hamburg wird ja schon überlegt, ob man den Namen ändert.
De Castro: Ich weiß, dass viele Kollegen mit dieser Begrifflichkeit ringen, und das ist auch sicherlich richtig. Manchmal bin ich glücklich darüber, dass unser Haus Linden-Museum heißt – nach dem Gründer Karl Graf von Linden.
Drost: Aber trotzdem steht ja im Untertitel "Museum für Völkerkunde".
De Castro: Das ist richtig. Sie haben sicherlich gelesen, dass sich Stadt und Land in Baden-Württemberg sehr stark dafür einsetzen, ein neues Haus, einen Neubau des Linden-Museums anzugehen, und da werden wir sicherlich noch mal über die Namensänderung oder über die Namensgebung unseres Hauses nachdenken.
Absage an Berlin war Entscheidung für Stuttgart und Gestaltungsspielraum
Drost: Inés de Castro, noch eine letzte Frage, die natürlich gerade vor kurzem wild in den Feuilletons diskutiert wurde. Warum haben Sie sich entschieden, in Stuttgart zu bleiben, anstatt Leiterin des Humboldt-Forums in Berlin zu werden?
De Castro: Dies ist eine eindeutige Entscheidung für Stuttgart, einem Ort, an dem ich mehr eigenverantwortlichen Gestaltungsspielraum wirklich für alle Bereiche des Museums habe, wo ich ein tolles Team habe und wirklich auch Unterstützung der Politik. Und sollte es, was wir wirklich hoffen, zu einem Neubau kommen, dann ist natürlich eine Neukonzeption eines Hauses eine sehr, sehr spannende Aufgabe für mich.
Drost: Spannender als die Neukonzeption in Berlin?
De Castro: Ja, auch spannender als die Neukonzeption in Berlin. Ich hätte mir dort persönlich wirklich einen stärkeren, einen eigenverantwortlicheren Auftritt der Museen gewünscht in dieser komplexen Struktur des Humboldt-Forums.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.