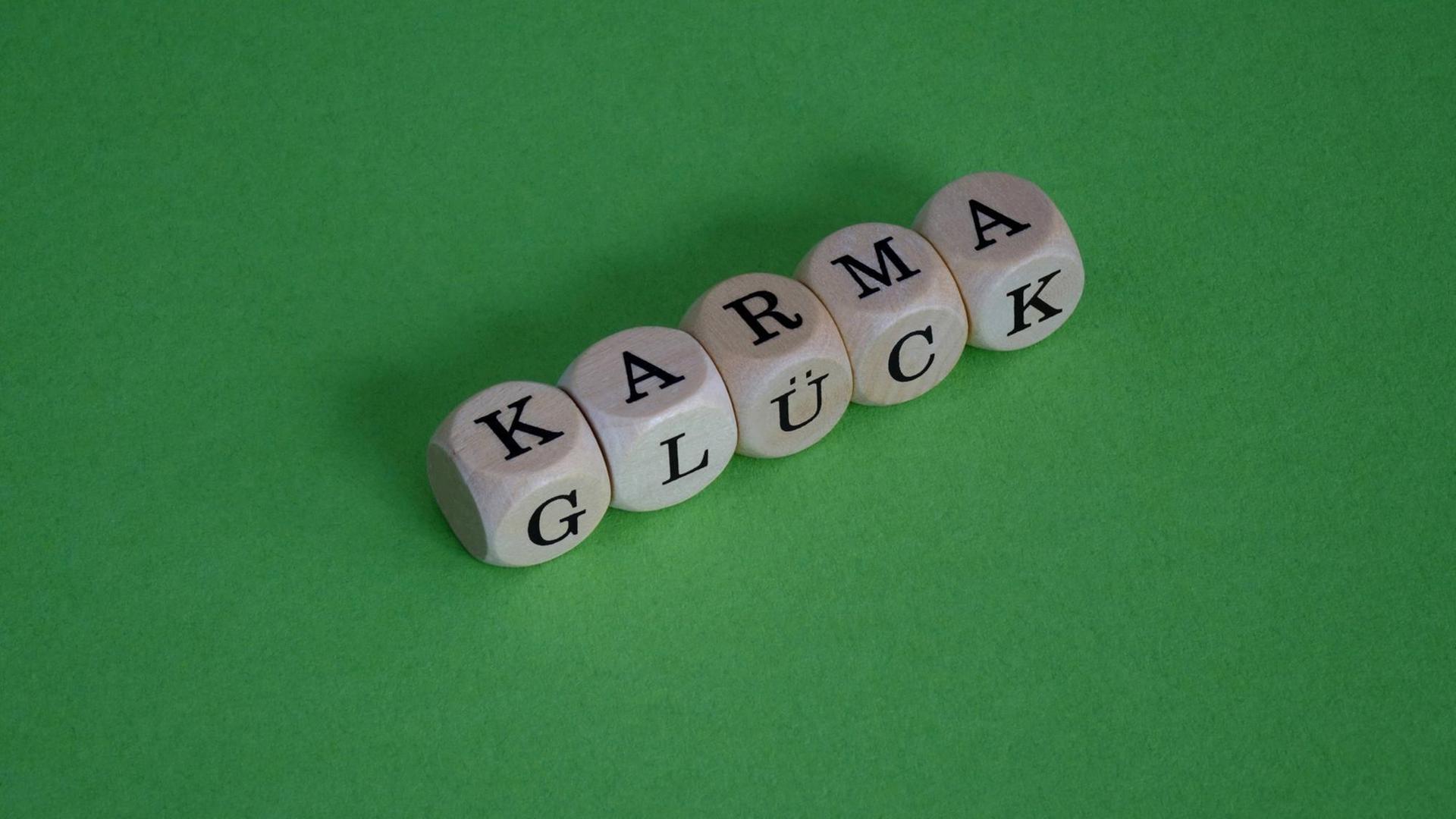Tübingen, Uppsala, Frankfurt am Main, Zürich und Los Angeles - das sind einige der Stationen im Leben des Religionsphilosophen Ingolf Dalferth. Noch viel länger ist die Liste der Bücher, die Ingolf Dalferth geschrieben hat: Es geht immer um die großen Menschheitsfragen: etwa ums Böse, um Gott, um Hoffnung oder wie in seinem jüngsten Buch: um "Sünde. Die Entdeckung der Menschlichkeit". Ingolf Dalferth hat in der Vergangenheit auch Essays für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben. Im Normalfall hält sich der evangelische Theologe in der deutschen Medienlandschaft aber eher zurück.
Was ist Sünde?
Andreas Main: Herr Dalferth, vor mir liegen 420 eng bedruckte Seiten. Verstehe ich Sie richtig, wenn ich behaupte, Ihr Sündenbuch ließe sich auf einen Satz eindampfen: Gott ist Schöpfer, der Mensch ist Geschöpf?
Ingolf Dalferth: Das ist die Hintergrundunterscheidung, die das ganze Buch prägt. Da haben Sie völlig recht.
Main: Und der Mensch, der diesen Unterschied nicht erkennt, ist Sünder. Was ist die Pointe Ihrer Theologie?
Dalferth: Die Pointe ist, dass wir uns an bestimmten Grundunterscheidungen im Leben orientieren, nicht orientieren müssen, aber immer schon orientieren, die sehr unterschiedlich sind. Und dass die Theologie, jedenfalls die christliche Theologie ganz wesentlich mit solchen Unterscheidungen arbeitet. Und die Dinge werden immer kompliziert oder unklar, wenn die Unterscheidungen, an denen man sich orientiert, nicht mehr klar und überzeugend entwickelt werden können.
Main: Welche Unterschiede meinen Sie?
Dalferth: Ich meine die Unterschiede, einen haben Sie schon genannt, zwischen Schöpfer und Geschöpf etwa. Oder den Unterschied zwischen Glaube und Unglaube. Oder den Unterschied zwischen Gut und Böse. Das sind Unterscheidungen, die in ganz unterschiedlichen, nicht nur religiösen Zusammenhängen auftreten, die aber in der Theologie in bestimmter Weise gebraucht werden und in den Theologien jeweils etwas anders. Und das bestimmt in vieler Hinsicht die internen Konflikte der Theologie und auch die in der Kirche und im Interagieren von Kirche und Gesellschaft.
Main: Herr Dalferth, vielleicht brauchen wir eine Begriffsklärung am Anfang unseres Gesprächs. Was ist Sünde?
Dalferth: Sünde ist, wenn man es ganz einfach sagen wollte: Blindheit für die Quelle des Lebens - oder Blindheit dafür, was man Gott verdankt.
Main: Also, nichts Moralisches im engeren Sinne?
Dalferth: Blindheit ist zunächst mal ein ganz offener Begriff. Der kann gehen von der natürlichen Gottesblindheit, mit der jedes Leben beginnt, bis hin zur aggressiven Ablehnung. Also, ich suche einen Begriff zunächst einmal, der sehr unterschiedlichen menschlichen Einstellungen und Verhaltensweisen gerecht werden kann. Der Grundpunkt ist, dass man etwas, das das eigene Leben bestimmt, nicht zur Kenntnis nimmt.
Was unterscheidet Sünde von Moralin oder Bigotterie?
Main: Es gibt aber auch Menschen, die weniger kirchlich gebunden sind. Gerade auch jüngere Menschen, die kaum eine klassische christliche Erziehung erlebt haben. Die haben dann aber trotzdem immer wieder den Reflex, dass es bei Sünde um Moral oder Moralin oder Bigotterie geht. Sehen Sie die Gefahr, dass Sie von einer breiteren Öffentlichkeit missverstanden werden?
Dalferth: Davon bin ich ausgegangen. Deshalb habe ich das Buch geschrieben. Ich hatte am Anfang überlegt: Wie kann man eigentlich aus theologischer Sicht unsere europäische westliche Entwicklung kritisch noch einmal gegenlesen? Es gibt da Großgeschichten, wie die zu lesen sind.
Da bin ich auf den Sündenbegriff gekommen als den, der am unwahrscheinlichsten ist, dass den noch irgendjemand ernst nimmt. Und zwar aus Gründen, die mit der Geschichte dieses Begriffs zu tun haben.
Es gibt beinahe keinen Vorwurf gegen das, was mit Sünde so bezeichnet wird, der nicht irgendwo im Verlauf der Geschichte auch berechtigte Anhaltspunkte hat. Und deshalb kann eine Geschichte der Sünde – in der Weise, wie ich es versucht habe zu schreiben – nicht nur eine sein, in der ein bestimmtes Konzept sozusagen affirmativ vertreten wird, sondern in dem die Fehlentwicklungen und die missglückten Versuche aufgezeigt werden.
Und warum Sünde? Weil wahrscheinlich kein anderer Topos in der christlichen Theologie so lebensnah und wirkungsmächtig geworden ist über viele Jahrhunderte hinweg wie dieser Begriff und die Reaktionen dagegen unsere Gegenwart nach wie vor bestimmen.
Main: Also, dass es Menschen gibt, bei denen alle Alarmglocken läuten, wenn sie den Sündenbegriff hören, da haben Sie erst mal Verständnis?
Dalferth: Na, mehr als das. Ich gehe genau davon aus und frage mich: Warum ist das so? Sind die Alarmglocken zu Recht angegangen, weil man verstanden hat, worum es geht, oder weil man einem der vielen möglichen und faktischen Missverständnisse aufgesessen ist?
Main: Was ist das Hauptmissverständnis? Nennen Sie mal ein Beispiel?
Dalferth: Der dominierende Sachverhalt hat damit zu tun, dass die Sünde in der Bußpraxis der Kirche – vor allem der katholischen Tradition, aber in Fortsetzungen auch in der evangelischen Tradition, eine so zentrale Rolle gespielt hat, weil er das ist, an dem die Kirche mit den einzelnen Menschen in unmittelbaren Kontakt kommt, und das, wofür sie steht, nämlich das Heil, an den, der dieses Heil sucht oder suchen sollte, vermittelt. Das ist der Hintergrund. Und um das effektiv tun zu können, muss man gute, jedem einzeln einleuchtende Beispiele haben. Und der Sündendiskurs in dieser moralorientierten Tradition ist der, der hier sehr effektiv das theologische Anliegen auf die Lebenswirklichkeit der Menschen bezogen hat.

Main: Mal ganz konkret: Welche Art und Weise von Sünde zu reden, braucht es definitiv nicht mehr?
Dalferth: So kann man das nicht formulieren, denke ich. Man muss aufpassen, in welchen Diskursen man sich bewegt. Es gibt einen Moraldiskurs der Sünde, der sehr dominierend gewesen ist und gegen den sich viele auflehnen, weil sie mit Recht sagen: Alle Moralfragen, die wir da aufwerfen können, sind keine Indikatoren für das Sündenproblem, sondern können mit Moralargumentationen auch beantwortet werden.
Dann gibt es einen Gerechtigkeitsdiskurs, der bis ins Politische hineingeht, der ähnlich strukturiert ist.
Dann gibt es seit Nietzsche und für das 20. Jahrhundert ganz wesentlich einen Krankheitsdiskurs. Und die Sünde ist sozusagen ein Krankheitssymptom, das kuriert werden muss. Und, wenn man sich in dem Diskurs bewegt, wird man anders argumentieren als im Moraldiskurs.
Insofern gibt es eben nicht die Lehre oder die Rede von der Sünde, sondern eine Vielfalt von Strängen, die man im Blick behalten muss.
Warum wirkt der Begriff Sünde so aus der Zeit gefallen?
Main: Herr Dalferth, wir sind theologisch eingestiegen. Ihre Art, von Sünde zu schreiben und zu reden, hat definitiv den Anspruch, die ganze Welt in den Blick zu nehmen und gesellschaftlich relevant zu sein. Warum wirkt der Begriff Sünde, warum wirkt womöglich auch unser Gespräch über Sünde so merkwürdig aus der Zeit gefallen?
Dalferth: Wir hier in Mitteleuropa, aber im weiteren Horizont auch in den USA, sind im Blick auf das Sündenthema durch die zwei schon angesprochenen Sachverhalte fundamental geprägt: Einmal eben die Moralisierung des ganzen Problems, dass es um Moralprobleme geht. Das Zweite, die im Gefolge vor allem von Nietzsches Christentums-Diagnosen sich unter den Intellektuellen vor allem ausgebreitete Haltung, dass im Grunde genommen die Sünde ein Problem anspricht, das sie erfindet, um dann ein Problem zu haben, das man lösen kann. Also, wir haben hier, wie Nietzsche das gesagt hat, es zu tun mit einer fiktiven Lösung eines fiktiven Problems. Und, wenn man sich auf diese Denkfigur einmal eingelassen hat, dann kann man die Problematik elegant entsorgen.

Main: Nun ist Nietzsche aber auch schon lange tot. Was ist in unserer aktuellen heutigen Gesellschaft der Punkt, der uns so sündenvergessen sein lässt?
Dalferth: Weil wir die Sache nicht mehr ernst nehmen. Das Buch endet mit einem Kapitel über die Trivialisierungstendenzen, die uns überall entgegenschlagen, wenn wir uns mit der Sündenfrage befassen. Das ist eine grundlegende, weit verbreitete Einstellung. Die Sache ist so trivial, dass man sie nur noch sozusagen in Scherzkontexten erwähnen kann, aber nicht mehr ernsthaft diskutiert. Das Ernsthafte daran war der Moraldiskurs. Der hat sich von der Sündenfrage gelöst und ist selbstständig geworden. Und deshalb braucht man diese ganze Thematik nicht mehr. Das scheint mir eine sehr verbreitete Einstellung zu sein.
Ist den Kirchen die Sünde fremd geworden?
Main: Die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff hat hier in dieser Sendung vor einigen Monaten den Kirchen vorgeworfen, auch sie hätten die Sünde auf den Müllhaufen der Theologiegeschichte geworfen, würden nicht mehr von Sünde und Erlösung predigen oder reden. Inwieweit teilen Sie diesen Eindruck, dass den Kirchen hierzulande die Sünde fremd geworden ist?
Dalferth: Da kann man viele Beispiele dafür anführen. Aber weil die Rede von Sünde immer mit einer bestimmten Interpretation dessen verknüpft ist, was man unter Sünde versteht, ist die Reaktion gegen die Sünde immer durch diese Interpretation geprägt. Und die kritische Frage ist jeweils eigentlich zu stellen, nämlich, ob damit auch das Problem entsorgt ist oder nur ein problematisches Verständnis, ein Missverständnis, ein verbesserungsfähiges Verständnis korrigiert wird.
Main: Ist den Kirchen die Sünde abhandengekommen?
Dalferth: Offiziell natürlich nicht. Denn wenn man nur den Gottesdienst und den Ablauf des Gottesdienstes sich vor Augen stellt, würden sehr viele Schritte in diesem Gottesdienst keinen Sinn machen, wenn sie nicht eine – ich sage es mal ganz allgemein – Vermittlung von Heil im Blick hätten. Aber was soll Heil sein, wenn nichts zu heilen ist? Also wird vorausgesetzt ein bestimmtes Verständnis des Menschen, das nun unterschiedlich akzentuiert werden kann. Negativ beschrieben oder eben – das versuche ich eher – so beschrieben, dass man verstehen kann, was mit Sünde gemeint ist, ohne in die Ablehnungen der Fehlverständnisse zu geraten, die damit immer verknüpft sind.
"Der Verzicht auf den Sünden-Begriff ist verständlich"
Main: Vielleicht sind die Kirchen ja auch wie die Gesellschaft durchdrungen von einem Denken, dass sie eben den Stachel im Fleisch nicht mehr erkennen wollen.
Dalferth: Ja, ich denke, das ist vielleicht auch eher anders herum, dass die Kirchen das berechtigte Anliegen haben, in der heutigen Gesellschaft und den Diskurs- und Gesprächs- und Verhaltenskontexten, die uns bestimmen, das, was sie zu sagen haben, verständlich zur Geltung zu bringen.
Begriffe wie Sünde sind so negativ belastet, dass man jeden Grund zu haben scheint, darauf zunächst einmal zu verzichten. Wenn man das tut, muss man allerdings gewissermaßen deutlich machen, wie man ohne den Begriff und ohne das positiv zu entfalten, was mit ihm gesagt werden sollte, das, was man nun eigentlich will, nämlich den Menschen zu verhelfen, ihr Leben menschlicher zu leben, wie man das vermitteln möchte.
Main: Also, Sie sagen, wer von Sünde redet, lebt menschlicher?
Dalferth: Ich sage, wenn man Sünde ausblendet und das ganze damit verbundene Problemfeld ausblendet, hat man etwas nicht ernstgenommen, was das menschliche Leben wesentlich bestimmt, nämlich, dass wir nicht Herren unserer selbst sind, dass wir nicht die Kontrolle über unser Leben in dem Sinne haben, dass wir zum Beispiel im moralischen Kontext das Gute, das wir anstreben, auch tatsächlich garantieren können, dass das herauskommt aus unserem Tun.
Oder dass wir nicht in der Lage sind, unser Dasein auf eigene Entscheidungen zurückzuführen. Sodass wir eingebunden sind in Vorgänge, Abhängigkeiten und Entscheidungen, die nicht wir, sondern andere zu verantworten haben, aber damit nun positiv umgehen müssen - und das nicht nur als Negativfolie für das eigentliche menschliche Leben, das angeblich immer im aktiven Tun und Selbstgestalten und Selbstverwirklichen besteht.
"Moralische und existenzielle Abgründe"
Main: Also, wenn der Mensch nicht Herr oder Frau seiner selbst ist und das nicht erkennt, dann besteht aus Ihrer Sicht sozusagen die Gefahr, in die Diktatur einer Selbsterlösungsideologie abzurutschen?
Dalferth: Was immer wir tun, wir müssen fragen, im Blick auf die Vernunft, im Blick auf die Freiheit, im Blick auf das Gute, das wir anstreben: Wo sind die Grenzen dessen, was wir hier versuchen? Wenn wir die Grenzproblematik nicht in den Blick nehmen, dann überschreiten wir oft bestimmte Punkte, in denen das, was wir positiv wollen, eigentlich in das Gegenteil umschlägt. Das ist eine alte Erfahrung und dafür gibt es auch viele Belege.
Wenn ich also die Vernunft nicht sich selbst überlassen will und ein Mittel, was die Vernunft ja ist, zum eigentlichen Ziel mache, das sich selber nicht mehr korrigieren kann, dann wird die Vernunft problematisch. Das ist seit Kant sozusagen eine Grundeinsicht. Und die Frage ist dann: Wie kann die Vernunft sich selbst Grenzen setzen?
Genau in diesem Zusammenhang würde ich auch das Sündenproblem ansiedeln: Wie kann man so von Sünde reden, dass deutlich wird, dass das eine Fragestellung ist, die auf wichtige und für uns besser zu beachtende Grenzen unseres Lebens hinweist?
Dazu gehören die eben schon angedeuteten Abgründe, möchte ich einmal sagen, die unser Leben hat: der moralische Abgrund, dass wir eben nicht garantieren können, dass das Gute, das wir wollen, auch Wirklichkeit wird. Sondern auch wenn wir Gutes wollen, haben wir immer wieder die Erfahrung, dass üble Folgen daraus hervorgehen. Oder: der existenzielle Abgrund, dass wir uns nicht selbst ins Dasein gebracht haben. Wir haben nicht per Entscheid uns in diese Wirklichkeit gebracht, verhalten uns in unserem Leben aber faktisch genau dazu. Das ist der Gedanke der Tiefenpassivität, auf den ich in verschiedenen Stellen im Buch dann zu sprechen komme.
Main: Was meinen Sie genau mit Tiefenpassivität?
Dalferth: Mit Tiefenpassivität meine ich, dass vor all unseren Aktivitäten, vor all unserem Handeln, und zwar dem Handeln und dem Lassen, etwas ist, das das überhaupt erst möglich macht. Wenn wir nicht da sind, können wir nicht handeln. Nur weil wir da sind, agieren wir auch, müssen auch agieren, müssen Entscheidungen treffen.
Aber dass wir da sind, ist keine Entscheidung, die wir getroffen haben. Deshalb unterliegt all unseren Aktivitäten und den Betroffenheiten, die wir im Leben erfahren und vollziehen, unterliegt dieser ganze Lebensvollzug einer Gesetztheit, die nicht auf unsere Entscheidung zurückgeht. Das meine ich mit Tiefenpassivität.
"Schlechthinnige Abhängigkeit"
Main: Ein Hörer, ein Religionslehrer, schrieb mir im Vorfeld dieses Gesprächs, ich müsse Sie unbedingt fragen – also, er hat das Buch gelesen – ob Tiefenpassivität eine Wortschöpfung von Ihnen ist oder an wen Sie sich da anlehnen?
Dalferth: Ich weiß, ich habe das ursprünglich englische gebraucht: Deep Passivity. Und ich hatte die so formuliert, dass es sozusagen Oberflächen-Passivitäten gibt, die im täglichen Leben uns allen vertraut sind. Wir sind Adressaten von Aktivitäten, von Dingen, die uns passieren, die wir sozusagen leitend entgegennehmen. Und wir sind Akteure im Leben.
Das ist eine Grundfigur, mit der Schleiermacher seinen Lebensbegriff entfaltet hat: Das Leben vollzieht sich im Aus-sich-Heraustreten und Von-außen-betroffen-Werden. Das sind die beiden Aktivitäts- und Passivitätsstrukturen. Er hat von einer schlechthinnigen Abhängigkeit gesprochen, die eben den gleichen …
Main: Von Gott.
Dalferth: Nein, nur von einer schlechthinnigen Abhängigkeit, die wir dann im Gottesgedanken symbolisieren. Wir erfahren uns als – heideggerianisch gesprochen – "ins Leben geworfen" oder mit Schleiermacher gesagt: Wir erfahren, dass wir da sind, obwohl wir uns nicht dazu entschieden haben. All unser Agieren-können und Erleiden- und Erfahren-können setzt etwas voraus, was nicht auf unsere eigene Setzung zurückgeht.
"Transhumane Entwürfe, die das Todesproblem lösen wollen"
Main: Jetzt mal ganz konkret in unserer Gesellschaft: Sehen Sie Beispiele für Selbstoptimierung, Sehnsucht für elitären Selbstverwirklichungswahn oder Weltrettungsideologien?
Dalferth: Oh, ja. Ich meine, das 20. Jahrhundert ist voll von diesen Versuchen. Man versucht, einen neuen, einen besseren, einen effektiveren Menschen zu schaffen. Das waren nicht nur die Versuche in den 20er- und 30er-Jahren in den bekannten Regimen. Das ist in der Gegenwart ganz massiv der Fall, wenn ich ins Silicon Valley blicke. Die Versuche, die Beschränktheiten und Begrenztheiten und Schwächen des Menschen, die vor allem von dort aus gesehen ins seinen körperlichen Bestimmtheiten liegen, führen dazu, dass man die Körperabhängigkeit des Menschen abbauen muss und dafür sich einsetzen sollte, dass es zu einer konstruktiven, produktiven Mensch-Maschine-Vereinigung kommt.
Das sind die transhumanen Entwürfe, die Zukunftsbilder sind, die nicht, wie viele andere Menschenbilder, versuchen, die Vernunft gegenüber dem Körper oder den Körper gegenüber der Vernunft starkzumachen, sondern diese ganze Geschichte so zu überwinden, dass wir aus der Körperlichkeit hinauskommen und mit den Maschinen in eine neue Symbiose begeben. Und warum ist das interessant? Weil das verknüpft wird mit Erwartungen, dass wir zum Beispiel auch das Todesproblem lösen können.

Dass wir sterben, hat mit der Endlichkeit unserer Körper zu tun. Wenn wir die aufheben können, dann hätten wir ja das Sterben und den Tod auch in den Griff bekommen. Und wenn wir es nicht ganz aufheben können, dann können wir es zumindest sehr lange hinauszögern. Und da gibt es mehr als ein Projekt, das an diesem Punkt arbeitet zurzeit.
Jeder ist daran interessiert, dass Krankheit, Leid, Übel korrigiert und - wenn möglich - vermieden und aufgehoben wird. Dass also das Leben übel-frei, gut und nicht unzeitig endet. Wenn man an diesem Punkt arbeitet, ist es auch gar nicht verwerflich, sondern die Frage wird dann immer die sein müssen: Wird damit die Grundgrenze, dass wir angefangen haben und unser Leben auch zu Ende gehen wird, wird die nur weiter hinausgezögert oder will man sie ganz aufheben? Wenn man sie ganz aufheben will, dann nimmt man sich zu viel vor. Wenn man sie hinauszögern möchte, also ein möglichst langes, gutes Leben für möglichst viele Menschen intendiert, dann kann man sehr viel heute machen, was man zum Glück machen kann und was in früheren Zeiten nicht der Fall war.
Nur: Auch ein langes Leben, ein viel längeres Leben als wir das heute kennen, wird ein endliches Leben sein. Wir müssen Endlichkeit nicht nur als ein negatives Phänomen, sondern als ein positives Phänomen wieder lernen zu würdigen.
Main: Jetzt mal jenseits der Forschungen im Silicon Valley. Erleben wir auch in der Gesundheitspolitik, also im Pandemieschutz ein solches Phänomen, also, dass wir die Begrenztheiten der Aufklärung, der Naturwissenschaft nicht erkennen und, um Sie zu zitieren, die Grenzen unserer Intention?
Dalferth: Ja. Ein Menschenbild, das zunächst mal nach diesem Grundgedanken der Perfektionierung entworfen ist, das wird die Probleme, die wir negativ ja alle erfahren, also die Übel, die Ungerechtigkeiten, die Krankheiten, an dem Punkt werden wir immer übereinstimmen. Was wir dagegen positiv setzen sollen, das ist immer das Strittige.
Wir haben also einen gesellschaftlichen Konsens, relativ schnell, im Blick auf das, was zu vermeiden ist. Aber wir haben überhaupt keinen Konsens im Blick auf das, was anzustreben ist. Und diese Struktur, die ernötigt dazu zu fragen: Was sind denn die Ideale, an denen wir uns orientieren?
Ideale müssen etwas sein, was nicht die Interessen der einen gegen die anderen ausspielt, sondern das zum Ausdruck bringt, was uns immer alle schon betrifft, worüber wir also nicht abstimmen müssen, ob wir da übereinstimmen wollen, sondern an denen wir uns gemeinsam orientieren sollten, weil es uns alle in gleicher Weise betrifft.
"Was ist es, was ein menschliches Leben auszeichnet?"
Main: Zum Schluss unseres Gesprächs zitiere ich Ihren Schlusssatz in Ihrem Buch auf Seite 418. Der besteht aus fünf Wörtern: "Wir stehen bestenfalls am Anfang." Haben Sie diesen Satz um der schönen Pointe willen geschrieben, dass das letzte Wort "Anfang" lautet? Oder was ist gemeint?
Dalferth: Ich meine damit, dass die Frage, was eigentlich ein menschliches Leben auszeichnet, die zentrale Frage ist, an der wir uns viel intensiver abarbeiten sollten. Die zentrale Frage scheint mir zu sein: Was ist es, was ein menschliches Leben auszeichnet oder auszeichnen sollte? Was also ist Menschlichkeit? Menschlichkeit ist etwas, was sich nicht von selbst einstellt, sondern das muss erarbeitet und errungen werden.
Ich zeichne die Sündenthematik insgesamt in dieses Menschlichkeitsprojekt ein. Die Frage danach, was Menschen menschlich macht. Und da genügt es nicht zu sagen, wir müssen vermeiden, dass wir unmenschlich werden. Das ist völlig richtig. Sondern wir brauchen ein positives Ziel, was denn die Menschlichkeit auszeichnet.
Meine Antwort ist: Ernstnehmen unserer Grenzen und ein Ernstnehmen dessen, dass wir faktisch uns dazu immer verhalten. Aber wie das im jeweiligen Fall konkretisiert werden muss, das ist das Projekt. Und das sagt der Schlusssatz, den Sie zitiert haben, bei dem wir allenfalls am Anfang stehen, das gemeinsam auszuformulieren. Nur, wenn wir uns dieser Aufgabe nicht stellen, dann versäumen wir den Punkt, auf den die ganze Rede von Sünde und Geschöpf in der christlichen Tradition hingewiesen hat.
Wir werden erst dann Mensch werden und menschlich leben können, wenn wir uns in rechter Weise von den Dingen unterscheiden, über die wir keine Kontrolle haben.
Ingolf Dalfert: "Sünde: Die Entdeckung der Menschlichkeit"
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 2020, 422 Seiten, 32 Euro
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 2020, 422 Seiten, 32 Euro
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.